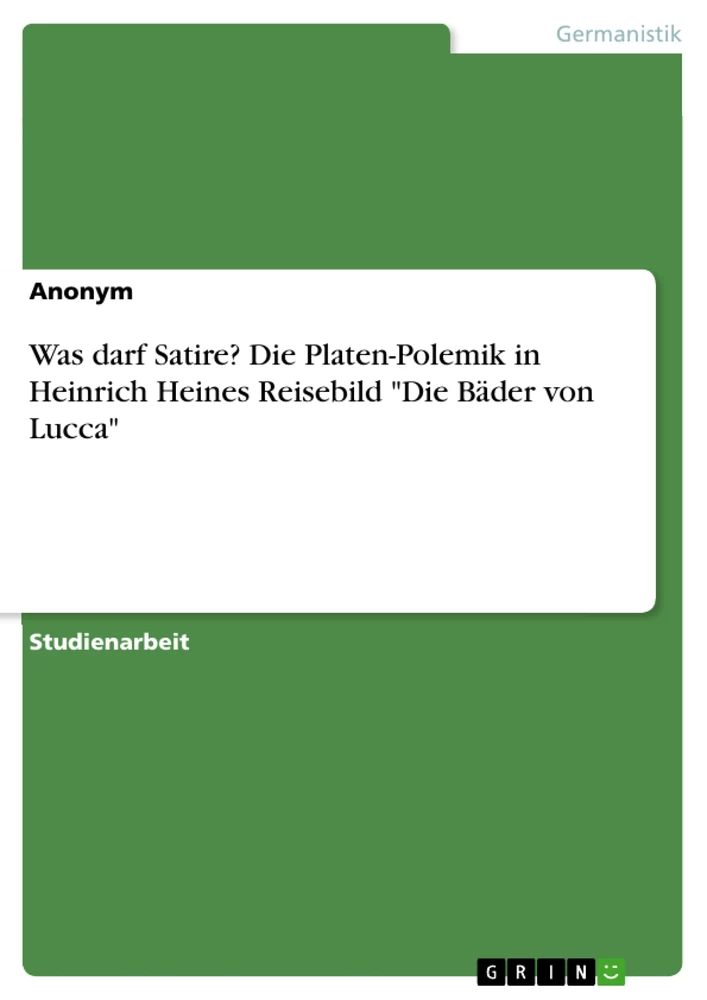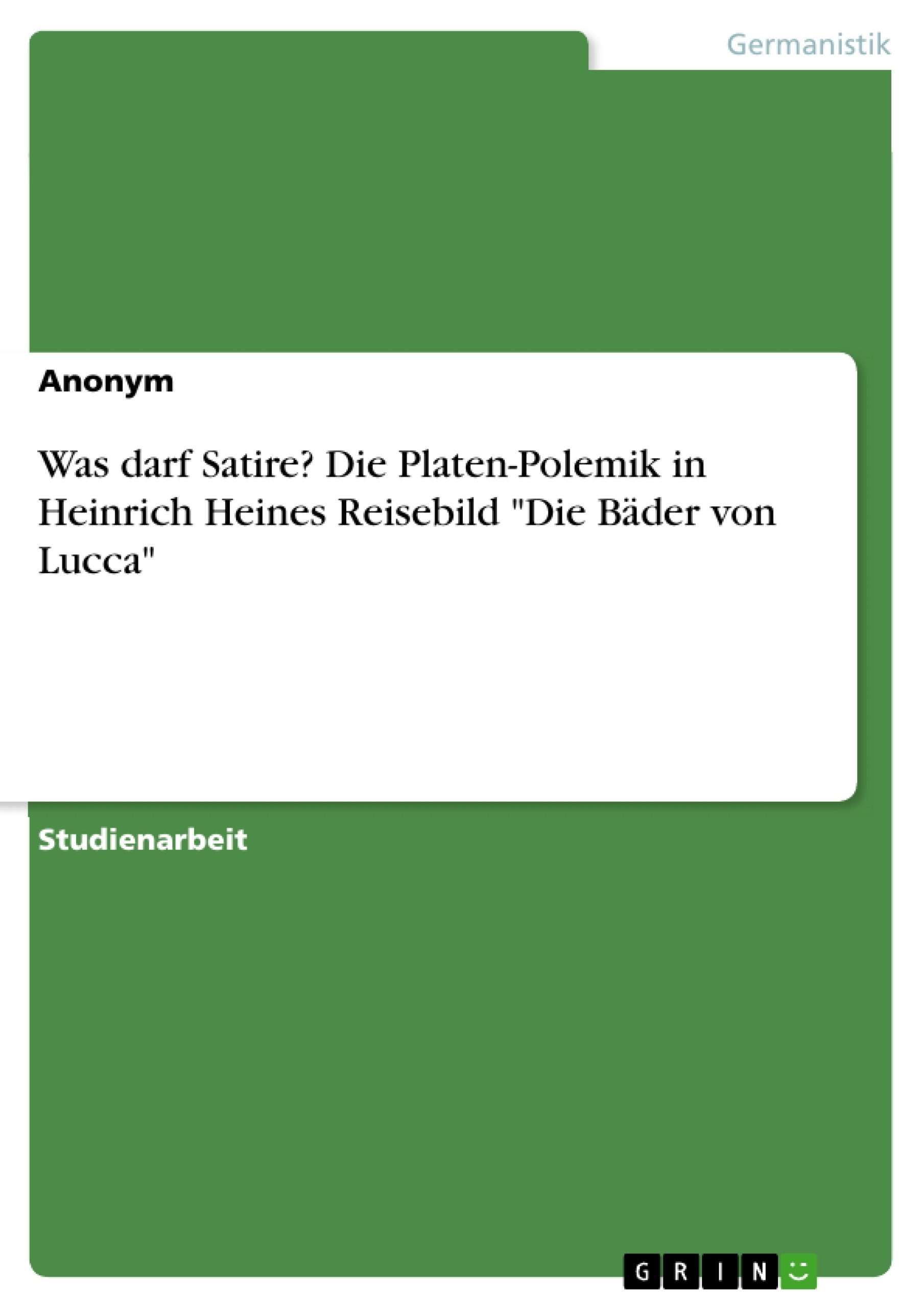Was darf Satire? Die vorliegende Arbeit versucht, diese Frage basierend auf Heinrich Heines "Die Bäder von Lucca" und dem "Literaturskandal" zwischen Heine und Platen zu bewantworten.
Obwohl die Geschichte der Literatur ebenso eine ihrer Skandale ist, erregte kaum einer mehr Aufsehen, als die Kontroverse zwischen Heinrich Heine und Graf August von Platen-Hallermünde , welche in Heines Reisebild "Die Bäder von Lucca" ihren Höhepunkt fand. Auslöser der Literaturfehde waren einige Xenien von Karl Leberecht Immermann. Heine, der seit 1822 in einer freundschaftlichen Beziehung zu diesem stand, druckte einige Distichen Immermanns im Anhang zur dritten Abteilung seiner Nordsee ab. Die Xenien kritisierten den forcierten Orientalismus, der in Anlehnung an Goethes "Divan" vor allem in Platens Ghaselen vorzufinden ist.
Der durch diese Zeilen gekränkte Platen holte mit seiner Komödie "Der romantische Ödipus" zum Gegenschlag gegen die beiden Literaten Immermann und Heine aus. In dem Lustspiel tritt Immermann als Gestalt des "Nimmermann" auf und wird als literarischer Versager abgekanzelt. Heine hingegen gerät vor allem wegen seiner jüdischen Abstammung ins Visier. Es ist die Rede vom "Samen Abrahams", dessen Küsse "Knoblauchgeruch" absondern, um nur einige Beispiele zu nennen.
Diesen Angriff auf seine Person zum Anlass nehmend rächte sich Heine mit der Platen-Polemik im 11. Kapitel seiner "Bäder von Lucca". In diesem outete er Platen als "warmen Freund" und betont den Ekel am homosexuellen Akt, indem er die "päderastische Aberration" mit Abführmittel, Durchfall und Klogeruch gleichsetzt. Durch seine gnadenlose Deutlichkeit und Schärfe, in der Heine Platen schonungslos aufs Persönliche angreift, verletzte er geschriebene und ungeschriebene Anstandsregeln bisheriger literarischer Fehden und entfachte eine bis heute andauernde Kontroverse über diesen literarischen Skandal. Was Satire darf oder eben nicht darf, soll Schwerpunkt dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Satire
- Polemik
- ,,Die Bäder von Lucca“ – Satire oder Polemik?
- Eine satirische Bädererzählung (Kapitel I- IX)
- Von der Satire zur Polemik? Das Schwellenkapitel (X)
- Die Platen-Polemik (Kapitel XI)
- Auswirkung des Skandals auf das Heine bzw. Platen-Bild
- Beurteilung des Skandals von Zeitgenossen
- Bewertung des Streits in der Heine bzw. Platen-Forschung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Platen-Polemik in Heinrich Heines Reisebild „Die Bäder von Lucca“ und befasst sich mit der Frage, was Satire darf. Dabei soll analysiert werden, ob Satire dazu genutzt werden darf, den Gegner aufgrund von sexuellen Neigungen gesellschaftlich zu ächten und persönlich anzugreifen.
- Begriffliche Abgrenzung von Satire und Polemik
- Analyse der satirischen Elemente in „Die Bäder von Lucca“
- Untersuchung der Platen-Polemik im 11. Kapitel
- Rezeption der Kontroverse durch Zeitgenossen und Forschung
- Auswirkungen des Skandals auf das Heine- und Platen-Bild
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit eröffnet mit einer Einordnung der Platen-Polemik in den Kontext der literarischen Fehden des Vormärz und stellt die zentrale Fragestellung nach der Freiheit der Satire.
- Begriffserklärung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Satire und Polemik, um die Analyse der Platen-Polemik in „Die Bäder von Lucca“ methodisch zu fundieren.
- ,,Die Bäder von Lucca“ – Satire oder Polemik?: Die Kapitel 1-9 werden als satirische Bädererzählung vorgestellt, während das 10. Kapitel als Übergangskapitel betrachtet wird, das die satirische Intention Heines hin zu einer direkten Polemik gegen Platen verschiebt.
- Auswirkung des Skandals auf das Heine bzw. Platen-Bild: Dieses Kapitel beleuchtet die Rezeption der Platen-Polemik durch Zeitgenossen und die Beurteilung des Skandals in der Heine- und Platen-Forschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Satire, Polemik, Literaturfehde, Vormärz, Heinrich Heine, Graf August von Platen-Hallermünde, „Die Bäder von Lucca“, Homosexualität und gesellschaftliche Normen. Diese Begriffe bilden den Rahmen für die Analyse der Platen-Polemik und die Diskussion über die Grenzen satirischer Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Worüber stritten Heinrich Heine und Graf Platen?
Es war eine literarische Fehde, die eskalierte, nachdem Platen Heine wegen seiner jüdischen Herkunft angriff und Heine daraufhin Platens Homosexualität öffentlich thematisierte.
Was ist der Inhalt der Platen-Polemik in „Die Bäder von Lucca“?
Im 11. Kapitel greift Heine Platen schonungslos persönlich an, indem er ihn als „warmen Freund“ outet und homosexuelle Akte satirisch herabwürdigt.
Wo liegt die Grenze zwischen Satire und Polemik?
Die Arbeit untersucht, ob Heines Angriff noch als Satire gilt oder die Grenze zur bösartigen, rein persönlichen Polemik überschritten hat.
Wie reagierten Zeitgenossen auf Heines Angriff?
Der Skandal verletzte viele Anstandsregeln der damaligen Zeit und führte zu einer kontroversen Beurteilung von Heines Charakter und Werk.
Was war der Auslöser der Fehde?
Der Streit begann mit Kritik an Platens forciertem Orientalismus in Heines „Nordsee“-Anhang, woraufhin Platen mit dem Lustspiel „Der romantische Ödipus“ antwortete.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Was darf Satire? Die Platen-Polemik in Heinrich Heines Reisebild "Die Bäder von Lucca", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498682