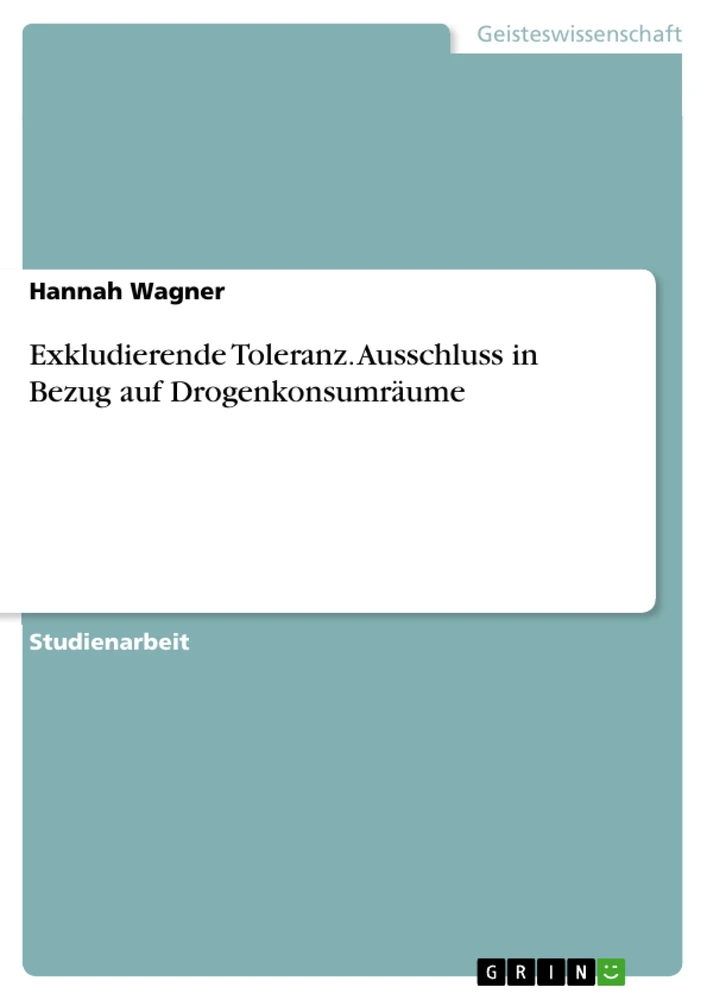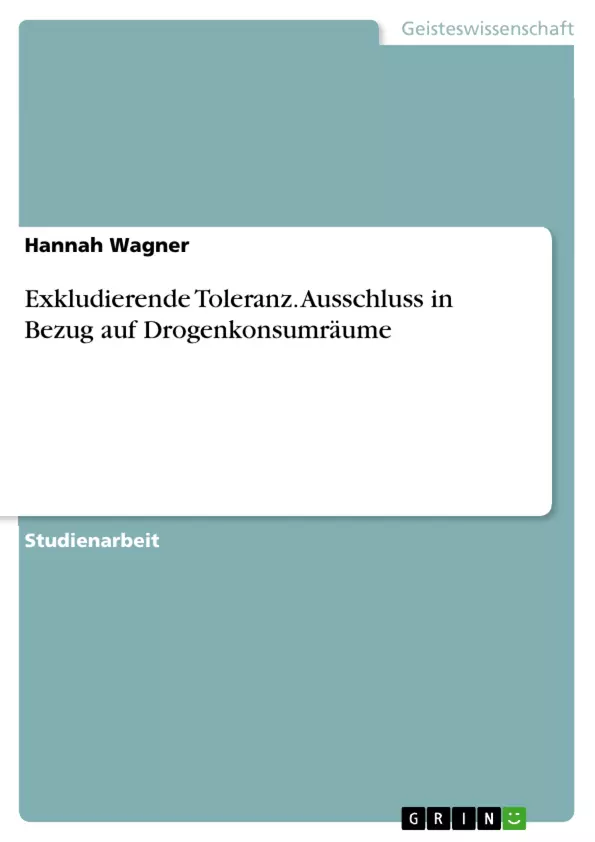Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema des Ausschlusses in Bezug auf Drogenkonsumräume und deren Besucher und geht der Frage nach, ob dieses Instrument der Drogenhilfe dazu beiträgt, dass Konsumierende Teil der Gesellschaft bleiben beziehungsweise werden oder ob durch die räumliche Abgrenzung und Stigmatisierung das Gegensätzliche, also die Ausschließung, befördert wird.
Zu betrachten sind dafür die Entwicklungen der Drogenhilfe ab 1980 bis hin zum akzeptierenden Ansatz, welcher Konsumräume beinhaltet und stark fördert. Dieser Ansatz vertritt überwiegend die Auffassung, dass die Vorteile der Konsumräume ausschlaggebend sind und im Sinne der Konsumierenden gehandelt wird. Das wechselnde Etikett von Kriminalität hinzu Krankheit wird durch den "labeling-approach"-Ansatz verdeutlicht und steht im Zusammenhang mit Ausschluss aus dem sozialen und physischen Raum.
Dies ist zu beleuchten, auch in Bezug auf Kontrolle durch staatliche Institutionen und deren Teilhabe, durch Finanzierung und dadurch resultierender Entscheidungsgewalt. Zuletzt sind die positiven Aspekte der Konsumräume aufzuführen, um eine Abwägung treffen zu können, inwieweit Konsumräume im Sinne von Konsumierenden sind.
Exemplarisch werden dazu oftmals die Erfahrungen aus der Stadt Frankfurt am Main herangezogen. Durch die vielen Drogenkonsumräume und den sogenannten "Frankfurter Weg" ein Symbol der akzeptierenden Drogenarbeit. Im Laufe der Gentrifizierung des Frankfurter Bahnhofsviertels im letzten Jahr, ist es wichtig, sich mit Ausschluss der Konsumierenden aus dem öffentlichen Raum zu beschäftigen und deren Hintergründe zu hinterfragen.
Generell ist die Frage, ob die Akzeptierende Drogenhilfe mit Konsumräumen einen sicheren Ort geschaffen hat, oder ob der Weg zur wirklichen Akzeptanz noch weitergehen muss. In diesem Kontext sind das aktuelle Betäubungsmittelgesetz und die aktuelle Kontrollpolitik in Kooperation mit der Polizei relevant.
Oftmals sehen sich Drogenkonsumierende mit einem Stigma konfrontiert und unter Generalverdacht gestellt, dessen Förderung durch Drogenkonsumräume und der daraus oft resultierende Verweis von öffentlichen Plätzen soll in Zusammenhang gestellt werden. Zu Beginn ist die Entwicklung der Drogenhilfe in Frankfurt und speziell der Drogenkonsumräume zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Geschichte der Drogenkonsumräume in Frankfurt
- Von der Kriminalisierung zur Pathologisierung
- Etikettierungsansatz
- Ausschluss aus sozialem und physischem Raum
- Konsumraum als Instrument der Kontrolle
- Positive Aspekte für Konsumierende
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Ausschluss von Drogenkonsumierenden durch Drogenkonsumräume und setzt sich mit der Frage auseinander, ob diese Einrichtungen zur Integration oder Ausgrenzung beitragen. Dabei werden die Entwicklungen der Drogenhilfe seit 1980 und die Entstehung des akzeptierenden Ansatzes mit Konsumräumen beleuchtet. Der Einfluss des "labeling approach" auf die Stigmatisierung von Drogenkonsumierenden und deren Ausschluss aus dem sozialen und physischen Raum wird ebenfalls betrachtet.
- Entwicklung der Drogenhilfe und die Einführung von Konsumräumen
- Der "labeling approach" und die Stigmatisierung von Drogenkonsumierenden
- Ausschluss aus dem sozialen und physischen Raum
- Kontrolle durch staatliche Institutionen und Finanzierung
- Positive Aspekte von Konsumräumen für Konsumierende
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Ausschlusses in Bezug auf Drogenkonsumräume und deren Besucher ein und beleuchtet die Problematik, ob diese Einrichtungen zur Integration oder Ausgrenzung beitragen.
Im ersten Teil des Hauptteils wird die Entwicklung der Drogenkonsumräume in Frankfurt seit den 1980er Jahren dargestellt. Dabei wird auf die Umstellung von Repressionen und Abstinenzorientierung hin zu einem akzeptierenden Ansatz eingegangen, der die Eröffnung von Konsumräumen ermöglicht hat. Die Entwicklung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) und die Bedeutung der "Frankfurter Resolution" für die akzeptierende Drogenhilfe werden beleuchtet.
Der zweite Teil des Hauptteils betrachtet den Weg von der Kriminalisierung zur Pathologisierung von Drogenkonsumierenden. Hier werden die historischen Entwicklungen des Opiumgesetzes und des BtMG sowie die Veränderungen in der Drogenhilfe von "kalter" Entgiftung hin zu einem zieloffenen Konzept dargestellt.
Der dritte Teil des Hauptteils beschäftigt sich mit dem "labeling approach" und der Stigmatisierung von Drogenkonsumierenden. Es wird argumentiert, dass abweichendes Verhalten nicht von Natur aus deviant ist, sondern von der Gesellschaft als abweichend definiert wird. Der Fall des Heroins wird als Beispiel für die Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung und die Kriminalisierung von Drogenkonsum herangezogen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit umfassen: Drogenkonsumräume, Ausschluss, Integration, akzeptierende Drogenhilfe, Stigmatisierung, "labeling approach", soziale und physische Teilhabe, Kontrolle durch staatliche Institutionen, Finanzierung und Entscheidungsgewalt.
- Arbeit zitieren
- Hannah Wagner (Autor:in), 2017, Exkludierende Toleranz. Ausschluss in Bezug auf Drogenkonsumräume, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498829