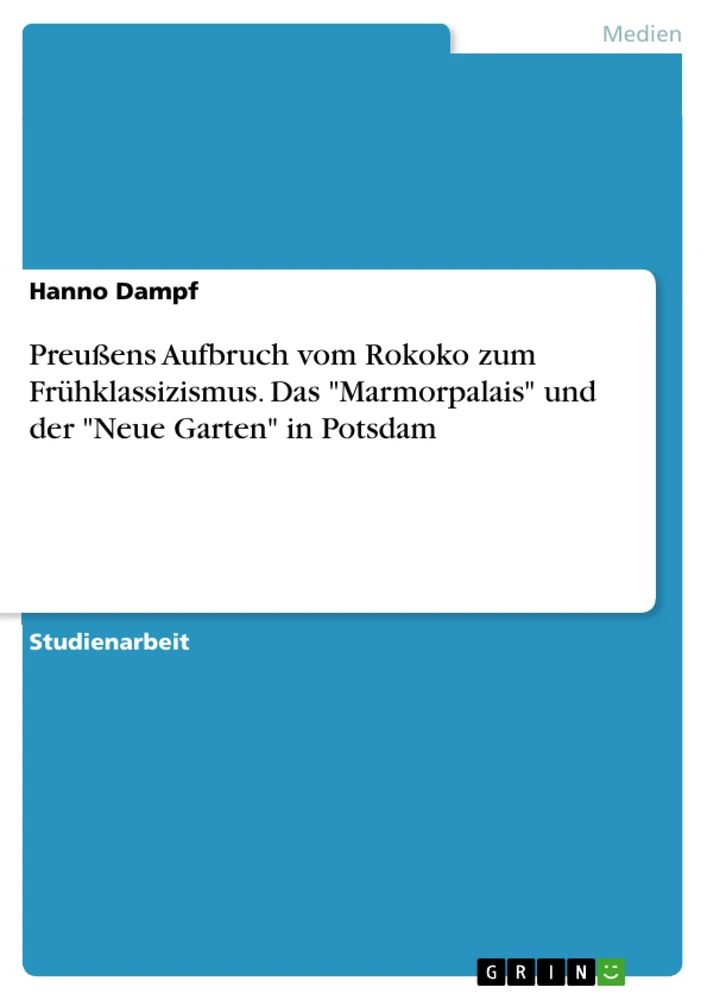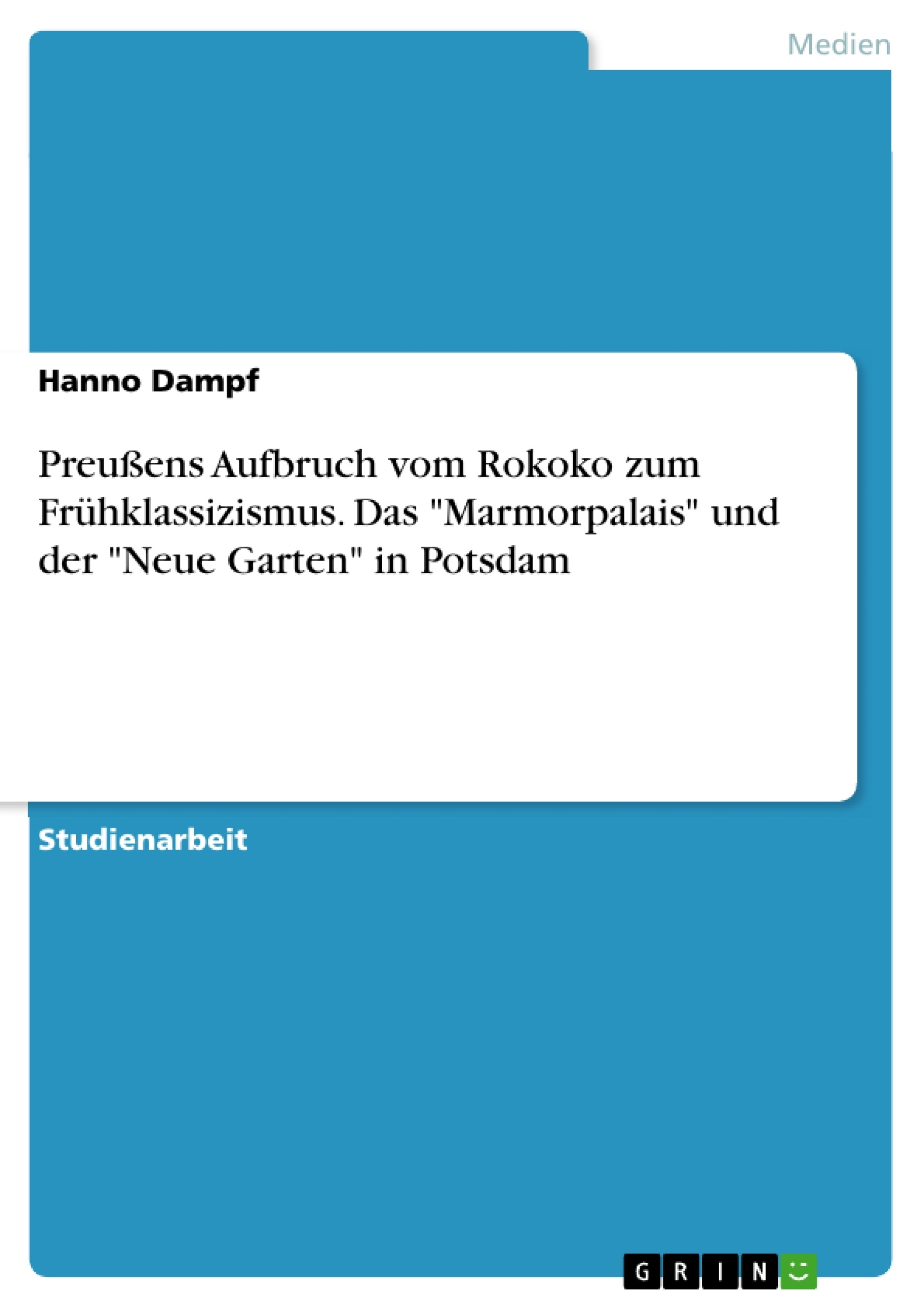Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt zunächst eine umfangreiche Bestandsaufnahme des Potsdamer "Mamorpalais" und des sich ihm anschließenden "Neuen Gartens" zu Zeiten seiner Entstehung im späten 18. Jahrhundert.
Des Weiteren wird auf die Wirkung Friedrich Wilhelms II. auf die Entfaltung der Künste in Preußen - mitsamt ihrer frühklassizistischen Tendenzen - eingegangen, ohne jedoch die historischen und politischen Kontexte jener Zeit außer Acht zu lassen.
Dabei werden das "Marmorpalais" sowie der ihm anschließende "Neue Garten" als Ausgangspunkt einer neuen Kunstepoche, das Zentrum dieser Ausführungen bilden, um so auf etwaige Vorbilder und architektonische Auseinandersetzungen mit anderen Schlossanlagen zu verweisen. Bevor jedoch die Betrachtung der Gesamtanlage des Palais erfolgen kann, wird zuvor ein kurzer historischer Exkurs über die Entwicklung des Preußischen Königreichs im ausgehenden 18. Jahrhundert vorangestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die historische Entwicklung des Preußischen Königreichs im 18. Jahrhundert
- Friedrich Wilhelm I.
- Friedrich II.
- Friedrich Wilhelm II.
- Die Anlage am Heiligen See – Ein historischer Einordnung
- Das Marmorpalais
- Das erste Geschoss
- Vestibül
- Parolekammer
- Musikzimmer
- Boisiertes Schreibkabinett
- Gelbe Schreibkammer
- Grüne Kammer
- Schlafkabinett
- Grottensaal
- Das zweite Geschoss
- Vorzimmer und Kammer En Camaieu
- Braune Kammer
- Landschaftszimmer
- Orientalisches Kabinett
- Konzertsaal
- Die Südgalerie
- Grünes Zimmer
- Ovaler Saal
- Kavalierwohnung
- Die Nordgalerie
- Rotes Zimmer
- Blaues Zimmer
- Grünes Kabinett
- Musenzimmer
- Kloeber-Saal
- Neuer Garten
- Gotische Bibliothek und Maurischer Tempel
- Pappelallee und Holländisches Etablissement
- Neugotische Meierei
- Neues Gothisches Haus
- Chinoisares Parasol, Obelisk und Artemis Ephesia
- Muschelgrotte
- Eremitage
- Orangerie und Eiskeller
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Marmorpalais und dem Neuen Garten in Potsdam, zwei bedeutenden Bauwerken des späten 18. Jahrhunderts. Sie analysiert die Anlage als ein Zeugnis des künstlerischen Aufbruchs vom Rokoko zum Frühklassizismus im preußischen Kontext. Dabei wird der Fokus auf die Rolle des Königs Friedrich Wilhelm II. als Förderer der Künste und Wegbereiter des frühen preußischen Klassizismus gelegt.
- Die Bedeutung Friedrich Wilhelms II. für die Entwicklung des frühen Klassizismus in Preußen
- Architektur und Ausstattung des Marmorpalais
- Die Gestaltung des Neuen Gartens und seine Bedeutung im Gesamtkontext
- Der Vergleich des Marmorpalais mit anderen Schlossanlagen und architektonischen Vorbildern
- Die historischen und politischen Rahmenbedingungen für die Entstehung der Bauwerke
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung des Marmorpalais als ein frühes Beispiel für den preußischen Klassizismus heraus und beleuchtet den Forschungsstand zu diesem Thema. Kapitel 2 widmet sich der historischen Entwicklung des Preußischen Königreichs im 18. Jahrhundert, wobei die Regierungszeiten Friedrich Wilhelms I., Friedrich II. und Friedrich Wilhelms II. im Detail betrachtet werden. Kapitel 3 gibt einen historischen Überblick über die Anlage am Heiligen See, die als Standort für das Marmorpalais und den Neuen Garten gewählt wurde.
Kapitel 4 untersucht das Marmorpalais, wobei die verschiedenen Räume und ihre Ausstattung detailliert beschrieben werden. Die Kapitel 5 bespricht den Neuen Garten mit seinen verschiedenen Gebäuden und Anlagen. Die Schlussbetrachtung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Bedeutung der Bauwerke für die Geschichte der preußischen Kunst und Architektur.
Schlüsselwörter
Preußen, Friedrich Wilhelm II., Marmorpalais, Neuer Garten, Potsdam, Frühklassizismus, Rokoko, Architektur, Gartenkunst, Kunstförderung, historischer Kontext, Schlossanlage.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Marmorpalais in Potsdam?
Es gilt als ein Hauptwerk des frühen preußischen Klassizismus und markiert den künstlerischen Übergang vom verspielten Rokoko Friedrichs II. zu einer strengeren, antikisierenden Formensprache unter Friedrich Wilhelm II.
Welche Rolle spielte Friedrich Wilhelm II. für die Architektur?
Er war ein bedeutender Förderer der Künste und initiierte den Bau des Marmorpalais und des Neuen Gartens, um sich bewusst vom baulichen Erbe seines Onkels Friedrichs des Großen abzugrenzen.
Welche Gebäude befinden sich im Neuen Garten?
Zu den markanten Gebäuden gehören die Gotische Bibliothek, das Holländische Etablissement, die Muschelgrotte, die Orangerie und die neugotische Meierei.
Wie ist das Marmorpalais im Inneren ausgestattet?
Das Palais verfügt über prachtvolle Räume wie den Grottensaal, den Konzertsaal und das Orientalische Kabinett, die mit wertvollen Materialien wie Marmor und Seide ausgestattet sind.
Was symbolisiert die Gotische Bibliothek?
Sie ist ein Beispiel für die Romantik und das erwachende Interesse am Mittelalter (Neugotik), das parallel zum Klassizismus im späten 18. Jahrhundert aufkam.
Warum wurde der Standort am Heiligen See gewählt?
Der Standort bot eine malerische Kulisse für die Verbindung von Architektur und Landschaftsgarten, ganz im Sinne der damals modernen Gartenkunst.
- Quote paper
- Hanno Dampf (Author), 2017, Preußens Aufbruch vom Rokoko zum Frühklassizismus. Das "Marmorpalais" und der "Neue Garten" in Potsdam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498929