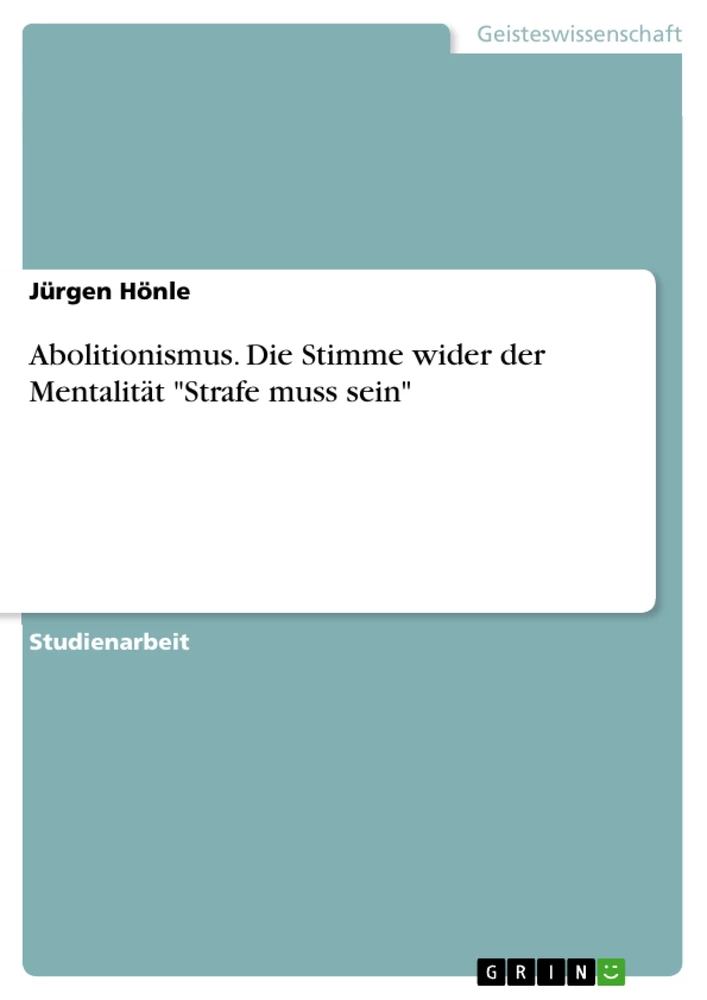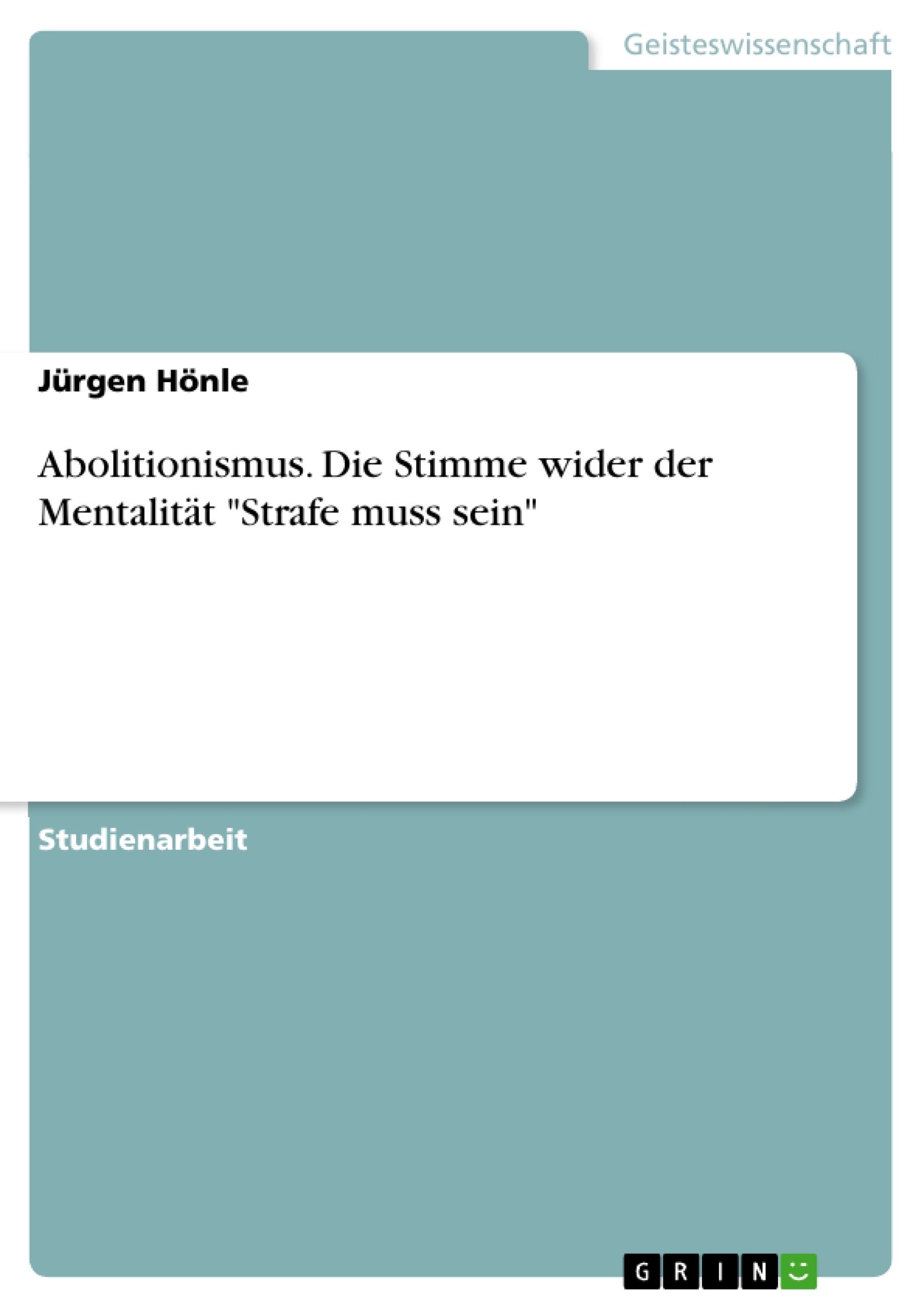Die vorliegende Arbeit gibt in einen kurzen Einblick in die Grundideen abolitionistischer Theorien, um anschließend die Philosophie des Strafens zu diskutieren und einige Alternativmodelle zur aktuellen Strafrechtspflege vorzustellen.
Ist Delinquenz kein Merkmal unverbesserlicher Charaktere, sondern die Folge eines kritisch verlaufenen Sozialisationsprozesses, in welchem Bestrafungen nur noch weitere das kriminelle Verhalten fördernde Einschnitte im Lebenslauf bedeuten, so scheint es durchaus legitim den eigentlichen Sinn und Zweck von Strafe zu hinterfragen und mögliche Reformideen zum vorherrschenden Strafrecht zur Debatte zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Abolitionismus
- Begriff und Geschichte
- Grundannahmen des Abolitionismus
- Die Philosophie des Strafens
- Die absoluten und relativen Theorien
- Kritik an den bestehenden Straftheorien
- Abolitionistische Gegenentwürfe
- Der moralische Rigorismus von Christie
- Der strukturelle Abolitionismus bei Gerlinda Smaus
- Alternativen zum Strafvollzug
- Täter-Opfer-Ausgleich
- Strafender Schadensersatz
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht abolitionistische Theorien im Kontext der Kriminalsoziologie. Ziel ist es, die Grundideen des Abolitionismus zu erläutern, die Philosophie des Strafens zu diskutieren und alternative Modelle zur aktuellen Strafrechtspflege vorzustellen. Die Arbeit beleuchtet kritisch die bestehenden Straftheorien und deren Auswirkungen.
- Der Abolitionismus als kritische Auseinandersetzung mit dem Strafrecht
- Philosophische Grundlagen des Strafens: absolute und relative Theorien
- Analyse abolitionistischer Gegenentwürfe und Alternativen zum Strafvollzug
- Bewertung der Effektivität bestehender strafrechtlicher Strukturen
- Vorstellung konkreter Alternativen wie Täter-Opfer-Ausgleich und strafender Schadensersatz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem eindrücklichen Zitat aus einem Gefängnistagebuch, das die negativen Folgen von Inhaftierung aufzeigt. Sie stellt die hohe Rückfallquote im deutschen Strafvollzug dar und hinterfragt den Sinn und Zweck von Strafe, indem sie die Notwendigkeit von Reformen im Strafrecht betont. Die Arbeit kündigt einen Überblick über abolitionistische Theorien, die Diskussion der Strafphilosophie und die Vorstellung alternativer Modelle an.
Der Abolitionismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Abolitionismus“ und seine historische Entwicklung. Es beschreibt den Weg vom ursprünglichen Verständnis als „Abschaffung“ von Anklagen im alten Rom bis hin zur modernen kriminalpolitischen Bewegung. Die Arbeit erläutert die unterschiedlichen abolitionistischen Strömungen, von der Abschaffung einzelner Straftatbestände bis zur vollständigen Abschaffung des Strafrechts, und betont deren gemeinsames Ziel: die soziale Konfliktlösung ohne repressive Mittel. Die Entwicklung abolitionistischer Ideen in Skandinavien und deren Ausbreitung werden ebenfalls thematisiert.
Die Philosophie des Strafens: Dieses Kapitel untersucht die philosophischen Grundlagen des Strafens, indem es die absoluten und relativen Straftheorien unterscheidet. Es analysiert kritisch die bestehenden Theorien und bereitet den Boden für die Diskussion abolitionistischer Alternativen. Es legt den Grundstein für die anschließende kritische Auseinandersetzung mit dem Strafrecht und bietet den Kontext für die Bewertung der abolitionistischen Ansätze.
Abolitionistische Gegenentwürfe: Das Kapitel präsentiert konkrete abolitionistische Gegenentwürfe, indem es den moralischen Rigorismus von Christie und den strukturellen Abolitionismus von Gerlinda Smaus vorstellt und vergleicht. Es beleuchtet unterschiedliche Strategien zur Konfliktlösung und zur Reduktion von Kriminalität jenseits des repressiven Strafrechts. Die verschiedenen Ansätze werden im Kontext bestehender sozialer Strukturen analysiert.
Alternativen zum Strafvollzug: Dieses Kapitel befasst sich mit konkreten Alternativen zum traditionellen Strafvollzug. Es beschreibt den Täter-Opfer-Ausgleich und den strafenden Schadensersatz als Möglichkeiten, Konflikte außergerichtlich und reparativ zu lösen, ohne auf traditionelle Bestrafungsformen zurückgreifen zu müssen. Die Vor- und Nachteile beider Ansätze werden im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Akzeptanz und Wirksamkeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Abolitionismus, Strafrecht, Kriminalsoziologie, Strafphilosophie, relative und absolute Straftheorien, Kriminalisierung, Stigmatisierung, Resozialisierung, Täter-Opfer-Ausgleich, strafender Schadensersatz, Alternativen zum Strafvollzug, Kriminalpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Abolitionistische Theorien im Kontext der Kriminalsoziologie
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit abolitionistischen Theorien im Kontext der Kriminalsoziologie. Sie erläutert die Grundideen des Abolitionismus, diskutiert die Philosophie des Strafens und stellt alternative Modelle zur aktuellen Strafrechtspflege vor. Die Arbeit beinhaltet eine kritische Beleuchtung bestehender Straftheorien und deren Auswirkungen, sowie die Vorstellung konkreter Alternativen wie Täter-Opfer-Ausgleich und strafender Schadensersatz.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Abolitionismus als kritische Auseinandersetzung mit dem Strafrecht; philosophische Grundlagen des Strafens (absolute und relative Theorien); Analyse abolitionistischer Gegenentwürfe und Alternativen zum Strafvollzug; Bewertung der Effektivität bestehender strafrechtlicher Strukturen; und die Vorstellung konkreter Alternativen wie Täter-Opfer-Ausgleich und strafender Schadensersatz.
Was versteht man unter Abolitionismus im Kontext dieser Arbeit?
Der Abolitionismus wird in der Arbeit als kritische Bewegung definiert, die sich mit dem Strafrecht auseinandersetzt. Sie reicht von der Abschaffung einzelner Straftatbestände bis zur vollständigen Abschaffung des Strafrechts, mit dem gemeinsamen Ziel der sozialen Konfliktlösung ohne repressive Mittel. Die Arbeit verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs und beleuchtet verschiedene abolitionistische Strömungen.
Welche philosophischen Grundlagen des Strafens werden diskutiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen absoluten und relativen Straftheorien und analysiert diese kritisch. Diese Analyse bildet die Grundlage für die Diskussion abolitionistischer Alternativen und die Bewertung des bestehenden Strafrechts.
Welche abolitionistischen Gegenentwürfe werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt den moralischen Rigorismus von Christie und den strukturellen Abolitionismus von Gerlinda Smaus vor und vergleicht diese. Es werden unterschiedliche Strategien zur Konfliktlösung und Kriminalitätsreduktion jenseits des repressiven Strafrechts beleuchtet und im Kontext bestehender sozialer Strukturen analysiert.
Welche Alternativen zum Strafvollzug werden vorgeschlagen?
Als konkrete Alternativen zum traditionellen Strafvollzug werden der Täter-Opfer-Ausgleich und der strafende Schadensersatz vorgestellt und diskutiert. Ihre Vor- und Nachteile hinsichtlich gesellschaftlicher Akzeptanz und Wirksamkeit werden bewertet.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Abolitionismus, zur Philosophie des Strafens, zu abolitionistischen Gegenentwürfen, zu Alternativen zum Strafvollzug und ein abschließendes Fazit/Zusammenfassung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Abolitionismus, Strafrecht, Kriminalsoziologie, Strafphilosophie, relative und absolute Straftheorien, Kriminalisierung, Stigmatisierung, Resozialisierung, Täter-Opfer-Ausgleich, strafender Schadensersatz, Alternativen zum Strafvollzug, Kriminalpolitik.
- Citar trabajo
- Jürgen Hönle (Autor), 2009, Abolitionismus. Die Stimme wider der Mentalität "Strafe muss sein", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499412