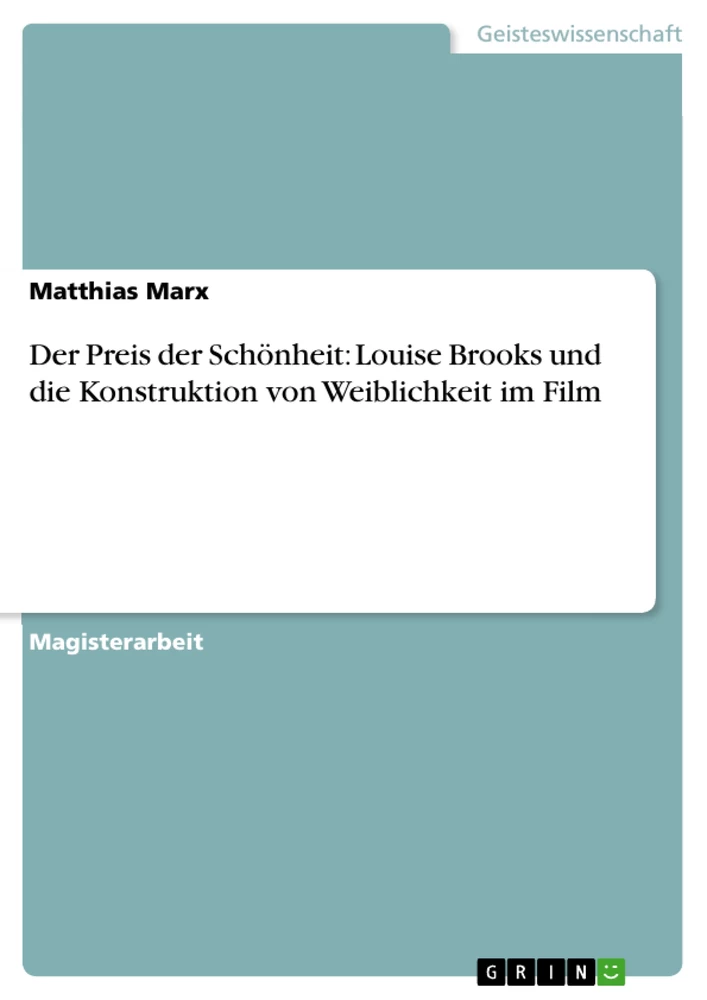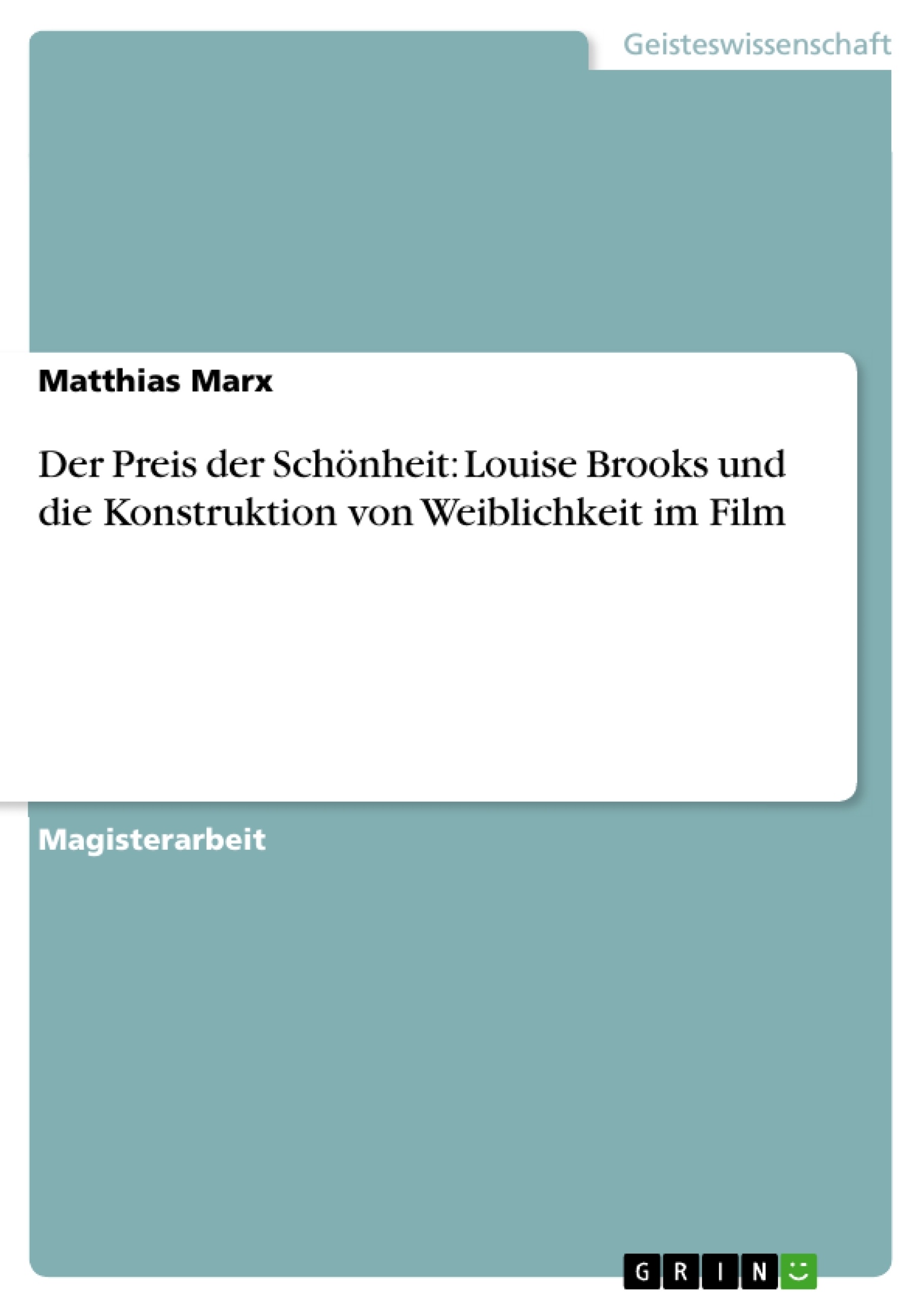„I learned to act while watching Martha Graham dance, and I learned to move in film from watching Chaplin.“ (Louise Brooks)
Der Film diente in seiner langen Geschichte immer wieder als Repräsentationsraum geschlechtlicher Rollenbilder einerseits und der Konstruktion von Paarbeziehungen andererseits. Die permanente Geschlechterproduktion erschöpft sich dabei nicht auf der Ebene der bloßen Reproduktion von Geschlechterverhältnissen, sondern schreibt diese kontinuierlich und zielgerichtet fort, um dem Betrachter eine Fülle von Identifikationsangeboten zu machen. Lange Zeit war das dominant-narrative Kino bemüht, über die Abbildung von Rollenbildern von Frauen und Männern in die persönliche Lebenswirklichkeit der Betrachter hineinzuwirken. Vor allem die Frauentypen auf der Leinwand, die sich spätestens seit den Zwanziger Jahren ausdifferenziert haben, wirken teilweise bis heute im Kino fort. Der Vamp, der Flapper oder die Femme fatale repräsentieren kulturelle und historische Typen, die eine jeweils unterschiedliche Vorstellung von Weiblichkeit reflektieren und nicht selten als Image einzelnen Schauspielerinnen zugeordnet werden können und sollen. Insofern erlaubt die Analyse von Frauenbildern im Film Rückschlüsse auf gesellschaftliche Bedingungen und Prozesse, die gerade durch das Massenmedium Film transportiert werden.
Es ist vor allem dem Unbehagen der Frauen geschuldet, wenn seit den letzten 30 Jahren der Diskurs über die kulturelle Repräsentation der Geschlechterdifferenz zunehmend kritisch geführt und die Position von Frauen gegenüber Männern im Film dabei hinterfragt wird.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich in diesem Sinne mit einer Schauspielerin, die gleich auf zweifache Weise als Repräsentationsfigur männlich-dominanter Bildzuschreibungen im Fokus der Filmgeschichte erscheint: Louise Brooks. Zum einen durch ihre Filme und den darin produzierten Frauenbildern und zum anderen durch einen erst später einsetzenden Personenkult, der Louise Brooks nachträglich zu einer Ikone ihrer Zeit stilisierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frauen Bilder
- Weiblichkeitstypen und ihre Voraussetzungen
- Die Femme fatale
- Die Neue Frau
- Der Flapper-Mythos
- Theoretische Exkursion
- Der Blick und die Schaulust
- Film, Psychoanalyse und der männliche Blick
- Kritik des männlichen Blicks
- Der weibliche Blick
- Der Blick auf das Geschlecht
- Geschlecht und Ideologie
- Der eigene Blick - Die Methodik
- Der Blick und die Schaulust
- The Girl Lulu - Lucienne
- Beggars Of Life (1928)
- Produktionsbedingungen
- Zur Handlung von Beggars Of Life
- The Girl
- Die Büchse der Pandora (1929)
- Produktionsbedingungen
- Zur Handlung von Die Büchse der Pandora
- Lulu
- Prix de Beauté (1930)
- Produktionsbedingungen
- Zur Handlung von Prix de Beauté
- Lucienne
- Beggars Of Life (1928)
- Zusammenfassung
- Rezeptionsgeschichte
- Louise Brooks im Fokus der Filmgeschichte
- Lulu in der Filmkritik
- Spurensuche
- Brooks-Zitate im Film
- Godard und Brooks: Vivre sa vie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Konstruktion von Weiblichkeit im Film anhand der Karriere der Schauspielerin Louise Brooks. Die Arbeit analysiert Brooks' Rollen in den Filmen "Beggars Of Life", "Die Büchse der Pandora" und "Prix de Beauté" und beleuchtet dabei die Wechselwirkungen zwischen den Geschlechterrollen und den Bildern, die Brooks auf der Leinwand verkörpert.
- Die Konstruktion von Weiblichkeit im Stummfilm
- Die Rolle des männlichen Blicks im Film
- Die Bedeutung von filmischen Stereotypen
- Die Rezeption von Louise Brooks in der Filmgeschichte
- Die Fortsetzung von Brooks' Erbe im modernen Film
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und führt die Thematik der Geschlechterrollen im Film ein. Sie betont die Bedeutung von Frauenbildern in der Filmwelt und die Relevanz der Analyse von Louise Brooks' Karriere.
- Das Kapitel "Frauen Bilder" analysiert verschiedene Weiblichkeitstypen, die im Film der 1920er Jahre etabliert wurden. Es untersucht die Rolle der Femme fatale, der Neuen Frau und des Flapper-Mythos in der Konstruktion von Weiblichkeit.
- Die "Theoretische Exkursion" widmet sich der Frage des männlichen Blicks im Film. Sie beleuchtet die Bedeutung der Psychoanalyse für die Filmtheorie und analysiert die Kritik am männlichen Blick als dominante Perspektive im Film.
- Das Kapitel "The Girl Lulu - Lucienne" konzentriert sich auf die Analyse von Louise Brooks' Rollen in drei Filmen: "Beggars Of Life", "Die Büchse der Pandora" und "Prix de Beauté". Es untersucht die Produktionsbedingungen der Filme, die Handlungsstränge und die Charakterisierung von Brooks' Rollen.
- Die "Rezeptionsgeschichte" beleuchtet die Rezeption von Louise Brooks in der Filmgeschichte. Sie untersucht die Filmkritik zu Brooks' Rollen als Lulu in "Die Büchse der Pandora" und analysiert den Einfluss der Schauspielerin auf die filmische Darstellung von Weiblichkeit.
- Das Kapitel "Spurensuche" verfolgt die Nachwirkungen von Louise Brooks' Filmarbeit. Es untersucht die Zitate von Brooks in späteren Filmen, insbesondere im Werk von Jean-Luc Godard, und analysiert die Kontinuität der Konstruktion von Weiblichkeit im Film.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit behandelt die Themen Geschlechterrollen, Weiblichkeit, Stummfilm, Filmtheorie, Louise Brooks, Femme fatale, Flapper, Psychoanalyse, männlicher Blick, Filmkritik, Godard, Rezeption, Kontinuität, Filmgeschichte, filmische Stereotypen.
- Arbeit zitieren
- Mag. Matthias Marx (Autor:in), 2005, Der Preis der Schönheit: Louise Brooks und die Konstruktion von Weiblichkeit im Film, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49947