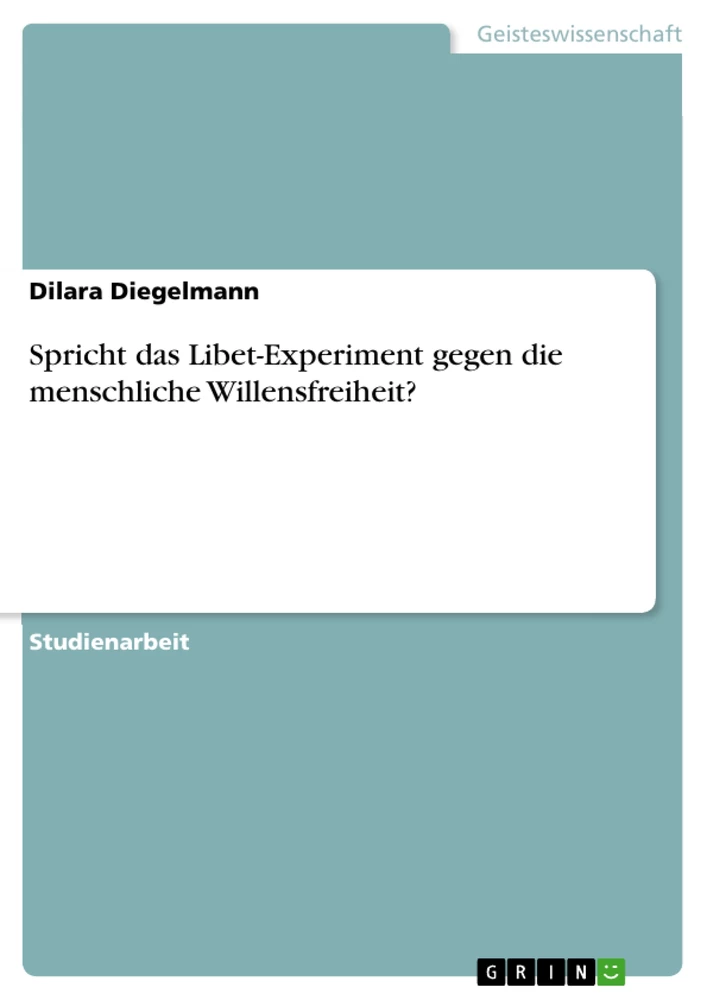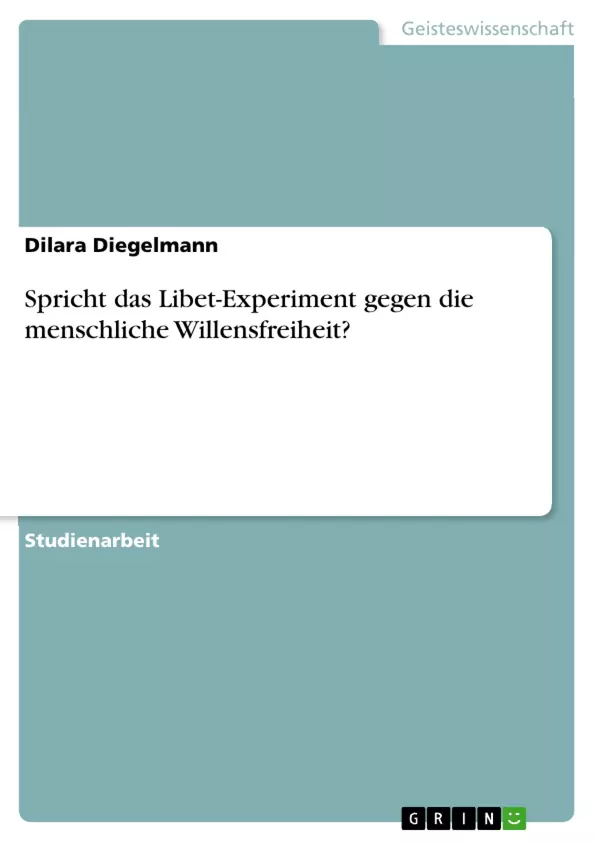Im sogenannten Libet-Experiment konnten unbewusste elektrische Voraktivierungen im Gehirn für Handlungen zeitlich vor dem Bewusst-werden der Handlungsabsicht nachgewiesen werden. Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, ob die Existenz dieser unbewussten neuronalen Veränderungen beweist, dass der Mensch keinen freien Willen hat.
Der Eindeutigkeit halber soll zunächst der Begriff der Willensfreiheit geklärt werden. Danach wird das Libet-Experiment wiedergegeben. Im Anschluss wird auf unterschiedliche Interpretationen des Experiments eingegangen. Dazu werden zuerst Argumente gegen die Willensfreiheit und darauf folgend die Schlussfolgerungen Libets diskutiert. Anschließend werden diverse Kritikpunkte am Versuchsaufbau, Libets Äußerungen sowie naturwissenschaftlichen Methoden klassisch philosophische Fragen anzugehen, aufgeführt. Zuletzt soll ein Fazit darüber, was Libets Experiment aussagt, gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Willensfreiheit?
- Kriterien eines starken Begriffs von Willensfreiheit
- Willensfreiheit vs. Handlungsfreiheit
- relative vs. absolute Freiheit
- Libets Definition von Willensfreiheit
- Inkompatibilismus
- Das Libet-Experiment
- Schlussfolgerungen
- Argumente gegen die Willensfreiheit
- Die Veto-Fähigkeit nach Libet
- Kritik
- Am Experiment
- An der Veto-Theorie Libets
- An naturwissenschaftlichen Methoden klassisch philosophische Fragen anzugehen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob das Libet-Experiment die menschliche Willensfreiheit widerlegt. Ziel ist es, die Kernaussagen des Experiments und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen für das Konzept der Willensfreiheit zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs der Willensfreiheit
- Präsentation des Libet-Experiments und seiner Methodik
- Diskussion der Interpretationen des Experiments in Bezug auf Willensfreiheit
- Kritik an den Schlussfolgerungen Libets und den angewandten naturwissenschaftlichen Methoden
- Zusammenfassung der zentralen Argumente und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Frage nach der Willensfreiheit und deren Relevanz für das Selbstverständnis und die menschliche Praxis in den Mittelpunkt. Sie führt in das Thema ein und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Was ist Willensfreiheit?: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Willensfreiheit als „starken“ Begriff mit den Kriterien der Selbstinitiierung, mentalen Verursachung von Handlungen und dem Prinzip alternativer Möglichkeiten. Es grenzt Willensfreiheit von Handlungsfreiheit ab und diskutiert verschiedene Freiheitsbegriffe.
- Das Libet-Experiment: Das Kapitel beschreibt das Libet-Experiment, welches die zeitliche Reihenfolge der bewussten Handlungsabsicht und der neuronalen Aktivierung im Gehirn untersucht. Es beleuchtet die Ergebnisse und deren Implikationen für die Willensfreiheitsdebatte.
- Schlussfolgerungen: Dieses Kapitel stellt Argumente gegen die Willensfreiheit vor, die aus dem Libet-Experiment abgeleitet werden. Es erläutert die Veto-Fähigkeit nach Libet, die besagt, dass wir bewusste Entscheidungen noch vor ihrer Ausführung unterdrücken können.
- Kritik: Das Kapitel kritisiert das Libet-Experiment selbst, Libets Interpretation der Ergebnisse und die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden auf philosophische Fragen. Es beleuchtet diverse Schwachstellen des Experiments und der Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Willensfreiheit, Libet-Experiment, neuronale Aktivität, Selbstinitiierung, Bewusstsein, mentale Verursachung, Prinzip alternativer Möglichkeiten, Veto-Fähigkeit, Inkompatibilismus, Naturwissenschaft, Philosophie, methodische Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Ergebnis des Libet-Experiments?
Das Experiment zeigte, dass im Gehirn ein Bereitschaftspotenzial für eine Handlung messbar ist, bevor der Person ihre eigene Handlungsabsicht bewusst wird.
Beweist das Libet-Experiment, dass es keinen freien Willen gibt?
Dies ist umstritten. Während einige Forscher darin einen Beweis gegen die Willensfreiheit sehen, argumentieren andere, dass bewusste Kontrolle dennoch möglich bleibt.
Was versteht Benjamin Libet unter der "Veto-Fähigkeit"?
Libet schlug vor, dass der Mensch zwar die Handlung nicht unbewusst initiiert, aber die bewusste Fähigkeit besitzt, eine bereits eingeleitete Handlung kurz vor der Ausführung zu stoppen (Veto).
Welche Kritik gibt es am Versuchsaufbau des Libet-Experiments?
Kritisiert werden unter anderem die künstliche Laborsituation, die Einfachheit der geforderten Handlungen und die Schwierigkeit, den exakten Zeitpunkt eines "Bewusstwerdens" objektiv zu messen.
Was ist der Unterschied zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit?
Handlungsfreiheit bedeutet, tun zu können, was man will. Willensfreiheit geht tiefer und fragt, ob man in seinen Wünschen und Entscheidungen selbstbestimmt und unabhängig von neuronalen Vorbedingungen ist.
- Quote paper
- Dilara Diegelmann (Author), 2018, Spricht das Libet-Experiment gegen die menschliche Willensfreiheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499746