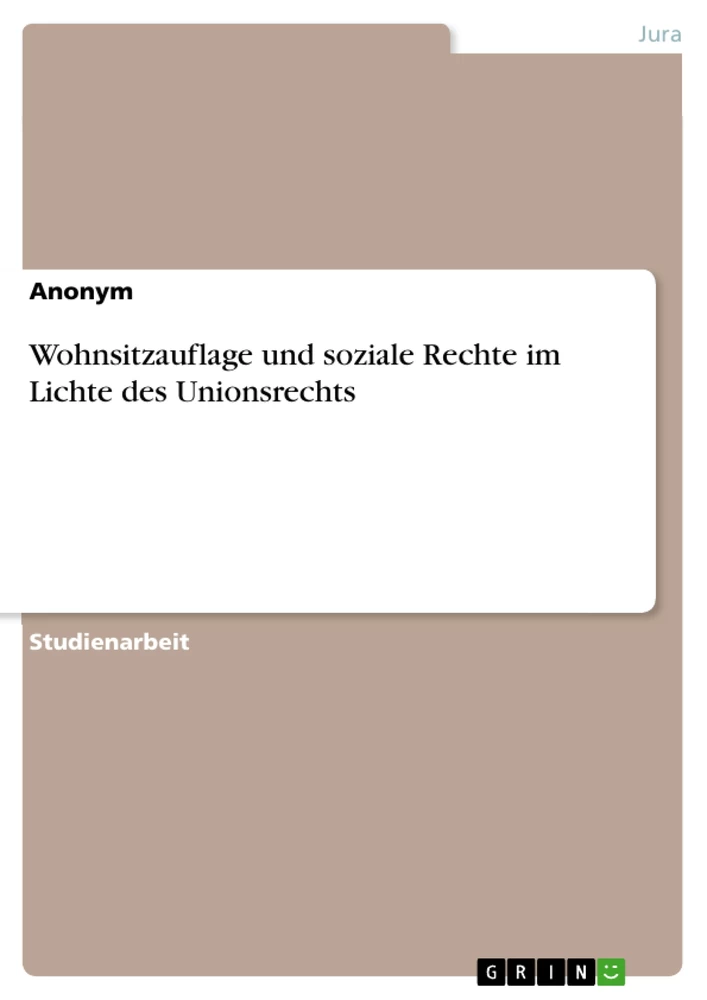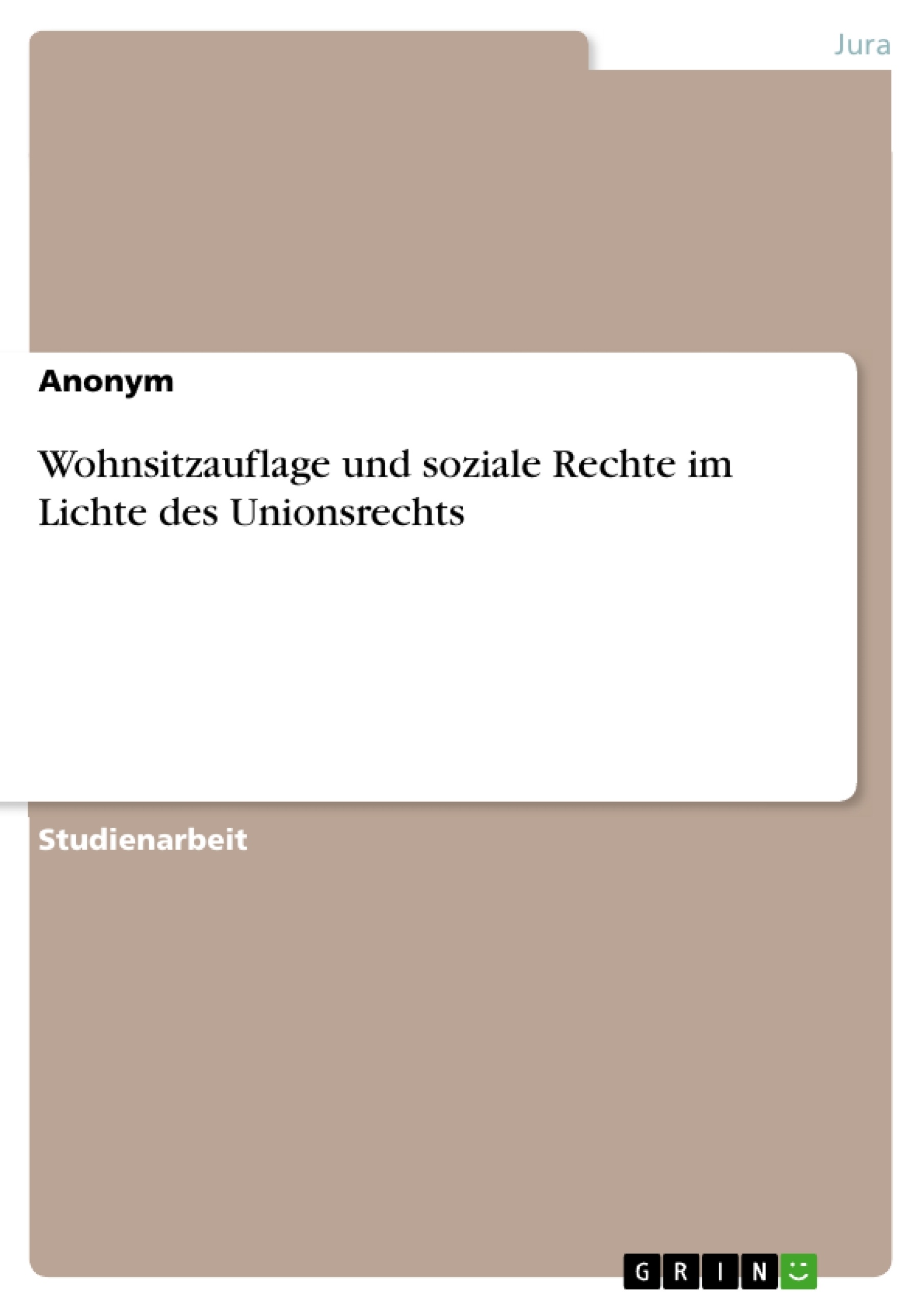Im Jahr 2015 haben in Deutschland circa eine halbe Million Menschen Asyl beantragt. Mit Blick auf eine verstärkte Zuwanderung von Schutzberechtigten wurde 2016 eine besondere Regelung mit dem Ziel einer Steuerung der Wohnsitznahme eingeführt.
Am 06.08.2016 wurde mit einem Integrationsgesetz § 12a Aufenthaltsgesetz beschlossen. Damit wurde eine Spezialnorm neben den allgemeinen Regelungen des § 12 Aufenthaltsgesetz geschaffen, die auf eine Wohnsitzregelung für Asylberechtigte und subsidiäre Schutzberechtige abzielt.
Hintergrund für diese Spezialnorm war, dass die Zuwanderung dieser Personengruppe das Bedürfnis einer verbesserten Steuerung des Wohnsitzes bedarf um eine integrationshemmende Segregation zu vermeiden . Hinzu kommt, dass für diesen Zweck die allgemeine Regelung des § 12 Aufenthaltsgesetz nicht ausreicht.
Die Regelung sollte gemäß Artikel 8 Absatz 5 Integrationsgesetz am 06.08.2019 wieder außer Kraft treten. Eine Entfristung dieser Regelung war jedoch vor Ablauf dieses Zeitpunkts bereits vorgesehen.
Diese Wohnsitzregelung sieht für diese Personengruppen für einen Zeitraum von drei Jahren eine gesetzliche Verpflichtung vor, die Wohnsitznahme im Land der Erstzuweisung im Asyl- bzw. Aufnahmeverfahren vorzunehmen und orientiert sich u.a. an den europarechtlichen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs vom 01. März 2016 . Nach diesen Vorgaben ist eine solche Auflage für international Schutzberechtigte ohne integrationspolitische Begründung nicht zulässig.
Häufig wird jedoch diskutiert, ob diese Auflage zur Bestimmung des Wohnsitzes mit dem EU-Recht und dem Völkerrecht vereinbar ist. Offensichtlich sind nämlich Schutzberechtigte in
ihrer Freizügigkeit eingeschränkt.
Auf diese Frage und was genau der § 12a Aufenthaltsgesetz regelt, werde ich im weiteren Verlauf eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Literaturverzeichnis
- II. Gesetzestext
- 1. Einleitung
- 2. § 12a Aufenthaltsgesetz
- 2.1 Die Idee und der Zweck
- 2.2 Die Normstruktur
- 2.3 Das Integrationsgesetz - Inkrafttreten im Jahr 2016
- 2.4 Das Integrationsgesetz - Entfristung im Jahr 2019
- 3. Anwendungsbereich
- 3.1 Von der Wohnsitzauflage Betroffene
- 3.1.1 Subsidiäre Schutzberechtigte
- 3.1.2 Flüchtlinge mit Flüchtlingseigenschaft nach der GFK
- 3.2 Ausnahmen
- 3.2.1 Beschäftigung
- 3.2.2 Berufsausbildung, Studien- und Ausbildungsverhältnis
- 3.2.3 Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder minderjähriges Kind
- 3.3 Erstreckung auf nachziehende Familienangehörige
- 3.1 Von der Wohnsitzauflage Betroffene
- 4. Durchführungsbestimmungen
- 4.1 Regelungsinhalt zugunsten der Länder
- 4.2 Folgen eines Verstoßes gegen die Wohnsitzauflage
- 5. Vereinbarkeit mit Völkerrecht und EU-Recht
- 5.1 Völkerrecht
- 5.2 EU-Recht
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der rechtlichen Einordnung der Wohnsitzauflage für subsidiär Schutzberechtigte im Lichte des Unionsrechts. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen der Wohnsitzauflage und diskutiert ihre Vereinbarkeit mit den Grundfreiheiten des Unionsrechts.
- Die rechtlichen Grundlagen der Wohnsitzauflage nach dem Aufenthaltsgesetz
- Die Bedeutung des Integrationsgedankens im Zusammenhang mit der Wohnsitzauflage
- Die Vereinbarkeit der Wohnsitzauflage mit den Grundfreiheiten des Unionsrechts, insbesondere dem freien Personenverkehr
- Die Auswirkungen der Wohnsitzauflage auf die soziale Rechte von subsidiär Schutzberechtigten
- Die Bedeutung von Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Bereich der Wohnsitzauflage
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung liefert einen Überblick über die Thematik der Wohnsitzauflage für subsidiär Schutzberechtigte im Lichte des Unionsrechts und beschreibt die Relevanz der Thematik für das deutsche Rechtssystem.
- Kapitel 2: § 12a Aufenthaltsgesetz: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen der Wohnsitzauflage im Aufenthaltsgesetz, insbesondere die Zielsetzung, die Normstruktur und die Integration des Gesetzes in das deutsche Rechtssystem.
- Kapitel 3: Anwendungsbereich: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Kreis der Personen, die von der Wohnsitzauflage betroffen sind, sowie mit den Ausnahmen von der Wohnsitzauflage, die im Aufenthaltsgesetz geregelt sind.
- Kapitel 4: Durchführungsbestimmungen: Hier werden die Regelungen bezüglich der Durchführung der Wohnsitzauflage durch die Länder und die Folgen eines Verstoßes gegen die Wohnsitzauflage beleuchtet.
- Kapitel 5: Vereinbarkeit mit Völkerrecht und EU-Recht: Dieser Abschnitt analysiert die Vereinbarkeit der Wohnsitzauflage mit den völkerrechtlichen Vorgaben sowie mit den Grundfreiheiten des Unionsrechts, insbesondere dem freien Personenverkehr.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Wohnsitzauflage, subsidiärer Schutz, Integrationsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Unionsrecht, Grundfreiheiten, freier Personenverkehr, soziales Recht, Rechtsprechung des EuGH, Rechtssicherheit, Diskriminierung, menschenrechtliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt die Wohnsitzauflage nach § 12a Aufenthaltsgesetz?
Die Regelung verpflichtet Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte für einen Zeitraum von drei Jahren, ihren Wohnsitz in dem Bundesland zu nehmen, dem sie im Asylverfahren zugewiesen wurden.
Was ist der Zweck der Wohnsitzregelung?
Ziel ist eine verbesserte Steuerung der Zuwanderung, um integrationshemmende Segregation (Ghettoisierung) zu vermeiden und eine gleichmäßige Verteilung der sozialen Lasten auf die Kommunen zu erreichen.
Ist die Wohnsitzauflage mit EU-Recht vereinbar?
Dies wird kontrovers diskutiert. Laut EuGH ist eine solche Auflage für international Schutzberechtigte nur zulässig, wenn sie eine konkrete integrationspolitische Begründung hat und die Freizügigkeit nicht unverhältnismäßig einschränkt.
Gibt es Ausnahmen von der Wohnsitzauflage?
Ja, Ausnahmen bestehen bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, bei Berufsausbildung, Studium oder wenn Kernfamilienmitglieder (Ehegatten, Kinder) an einem anderen Ort leben.
Wer ist von der Wohnsitzregelung betroffen?
Betroffen sind anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention sowie subsidiär Schutzberechtigte, denen nach dem 01.01.2016 Schutz gewährt wurde.
Was passiert bei einem Verstoß gegen die Wohnsitzauflage?
Ein Verstoß kann rechtliche Konsequenzen haben, wie die Verweigerung von Sozialleistungen am nicht zugelassenen Wohnort oder ordnungsrechtliche Maßnahmen durch die Ausländerbehörden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Wohnsitzauflage und soziale Rechte im Lichte des Unionsrechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499790