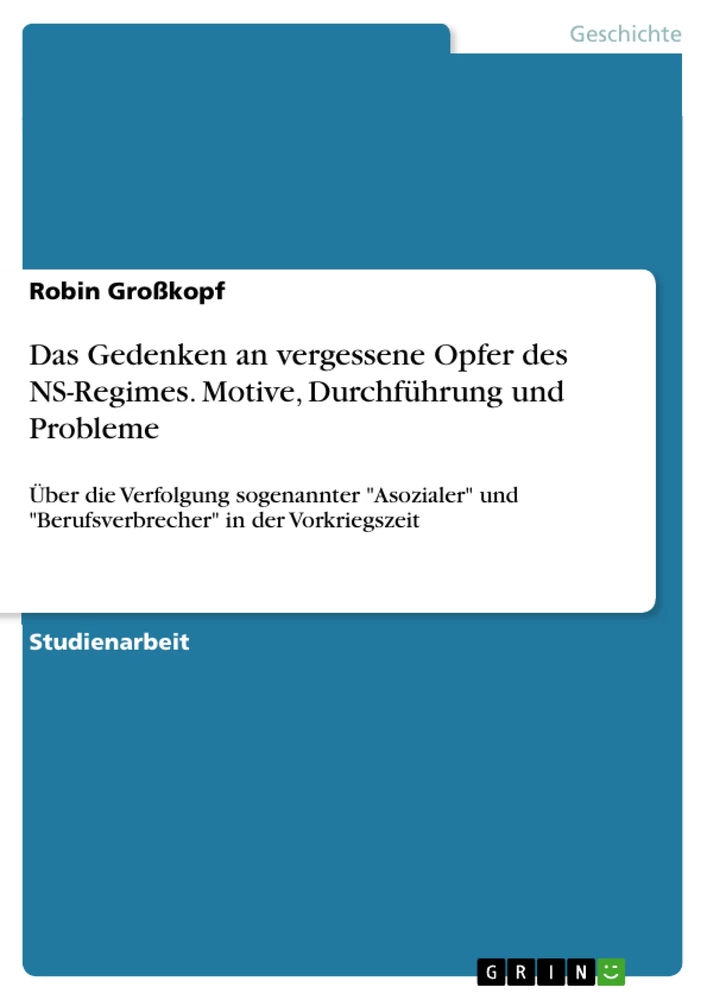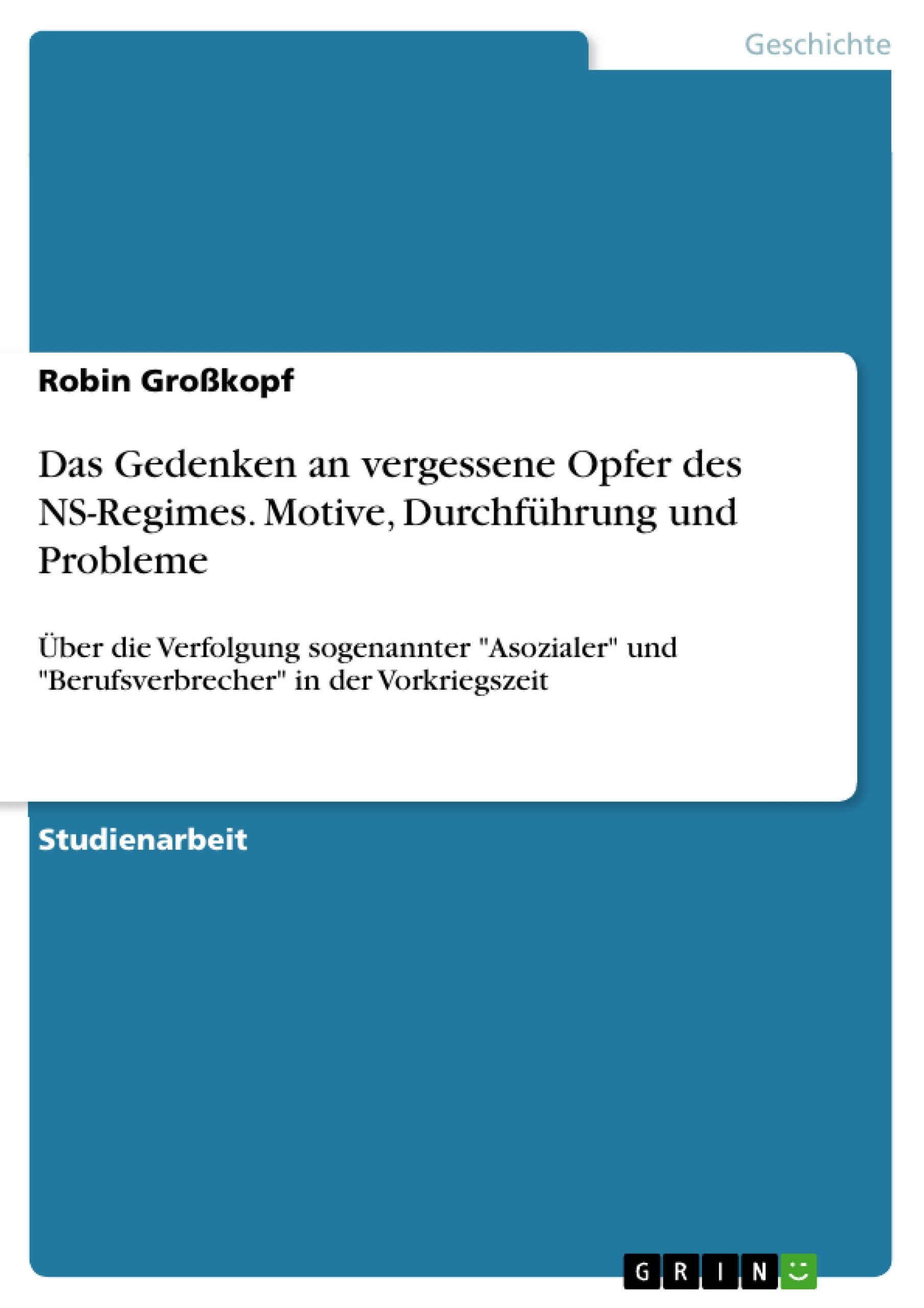Unter der Fragestellung "Vergessene Opfer des NS-Regimes? Wer waren die so genannten Asozialen und Berufsverbrecher und wie wurde mit ihnen bis zum Kriegsbeginn verfahren?" widmet sich diese Arbeit einem Teil der sozialrassistischen Verfolgungen im deutschen Faschismus in der Zeit vor dem Kriegsausbruch 1939 unter den Aspekten der (ideologischen) Vorgeschichte, den durchgeführten Maßnahmen und den Problemen beim Gedenken an diese Opferkategorie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte in der Weimarer Republik und ideologische Aspekte.
- Historische Voraussetzungen – Sozialpolitik und Wirtschaftskrise 1929.
- Eugenik in Deutschland..
- „Verhütung asozialen Nachwuchses“.
- „Vorbeugende Verbrechensbekämpfung“.
- Verfolgungsmaßnahmen gegen „Asoziale“ und „Berufsverbrecher”
- ,,Aktion Arbeitsscheu Reich\".
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich den Verfolgungen von sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ im nationalsozialistischen Deutschland. Sie untersucht, wie diese Personen definiert wurden, welche Maßnahmen gegen sie ergriffen wurden und wie ihre Erfahrungen im Kontext der „Vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“ und der „Verhütung asozialen Nachwuchses“ einzuschätzen sind.
- Die historischen Voraussetzungen der Verfolgung von „Asozialen“ in der Weimarer Republik, insbesondere die Wirtschaftskrise und die Eugenik.
- Die konkrete Umsetzung der Verfolgung von „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ im Nationalsozialismus, einschließlich der Gesetzgebung, der Razzien und der Einweisungen in Konzentrationslager.
- Die Problematik des Gedenkens an diese Häftlingskategorie und die Diskussion um die Bezeichnung „Vergessene Opfer“.
- Der Forschungsstand zur Verfolgung von „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“, insbesondere die Arbeiten von Wolfgang Ayaß und Julia Hörath.
- Der Vergleich mit der Verfolgung von Sinti und Roma.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beginnt mit einem aktuellen Beispiel für den Einsatz des Begriffs „drohende Gefahr“ in einem Polizeigesetz, das an die Verfolgungsmaßnahmen gegen „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ im Nationalsozialismus erinnert. Die Arbeit stellt die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit vor.
Vorgeschichte in der Weimarer Republik und ideologische Aspekte: Dieses Kapitel untersucht die historischen Voraussetzungen für die Verfolgung von „Asozialen“ im Nationalsozialismus. Es beleuchtet die Sozialpolitik in der Weimarer Republik im Kontext der Wirtschaftskrise 1929 und die Bedeutung der Eugenik als Grundlage der „Rassenhygiene“.
Historische Voraussetzungen - Sozialpolitik und Wirtschaftskrise 1929: Der Abschnitt beleuchtet die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Weimarer Republik und die Folgen für das soziale Leben. Es wird gezeigt, wie die wachsende Armut und die Zunahme von Wohnungslosigkeit die Verfolgung von „Asozialen“ begünstigten.
Eugenik in Deutschland: Dieser Abschnitt diskutiert die Eugenik als wissenschaftliche Lehre und deren Einfluss auf die Ideologie des Nationalsozialismus. Es wird erklärt, wie die Eugenik zur Rechtfertigung der Verfolgungsmaßnahmen gegen „Asozialen“ diente.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Verfolgung von „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ im Nationalsozialismus. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: „Asoziale“, „Berufsverbrecher“, „Vorbeugende Verbrechensbekämpfung“, „Verhütung asozialen Nachwuchses“, „Rassenhygiene“, „Eugenik“, „Konzentrationslager“, „Vergessene Opfer“, „Forschungsstand“, „Weimarer Republik“, „Wirtschaftskrise 1929“.
Häufig gestellte Fragen
Wer wurde im Nationalsozialismus als "Asoziale" oder "Berufsverbrecher" verfolgt?
Unter diese Kategorien fielen Menschen, die nicht in das nationalsozialistische Ideal der "Volksgemeinschaft" passten, darunter Obdachlose, Bettler, Prostituierte, Alkoholkranke sowie Personen mit Vorstrafen, die als "gemeinschaftsfremd" eingestuft wurden.
Was war die "Aktion Arbeitsscheu Reich"?
Dies war eine massive Verhaftungswelle im Jahr 1938, bei der tausende Männer, die als "arbeitsscheu" galten, in Konzentrationslager eingewiesen wurden, um sie zur Zwangsarbeit zu nutzen und aus der Gesellschaft zu entfernen.
Welche Rolle spielte die Eugenik bei dieser Verfolgung?
Die Eugenik lieferte die pseudowissenschaftliche Begründung. Man glaubte, "Asozialität" sei erblich bedingt. Durch Maßnahmen wie Zwangssterilisationen sollte die Vermehrung dieses "minderwertigen Erbguts" verhindert werden.
Warum werden diese Gruppen oft als "vergessene Opfer" bezeichnet?
Lange Zeit erhielten diese Opfergruppen keine gesellschaftliche Anerkennung oder Entschädigung, da die Vorurteile gegen sie auch nach 1945 fortbestanden. Erst in den letzten Jahrzehnten rückte ihr Schicksal stärker in den Fokus der Forschung und des Gedenkens.
Wie hingen Wirtschaftskrise und Verfolgung zusammen?
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 führte zu Massenarmut und Obdachlosigkeit. Die daraus resultierenden sozialen Probleme wurden bereits in der Weimarer Republik kriminalisiert, was den Nationalsozialisten den Weg für ihre radikalen Verfolgungsmaßnahmen ebnete.
Was versteht man unter "Vorbeugender Verbrechensbekämpfung"?
Dies war ein Prinzip der NS-Polizei, bei dem Personen nicht für begangene Taten, sondern aufgrund einer vermuteten künftigen Straffälligkeit oder ihrer Lebensweise präventiv in "Schutzhaft" genommen wurden.
- Citar trabajo
- Robin Großkopf (Autor), 2019, Das Gedenken an vergessene Opfer des NS-Regimes. Motive, Durchführung und Probleme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/500002