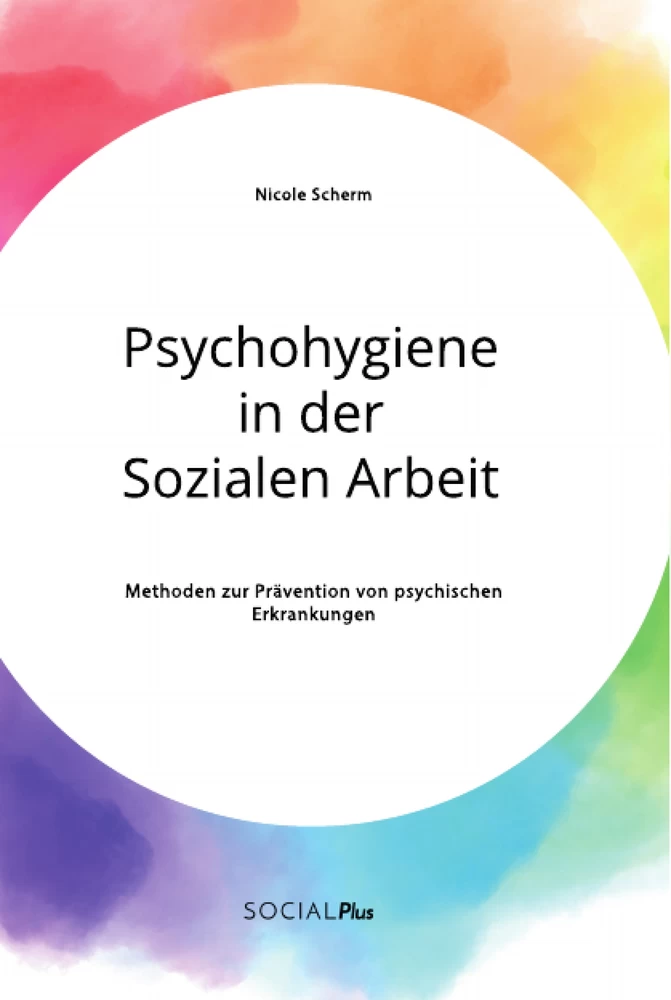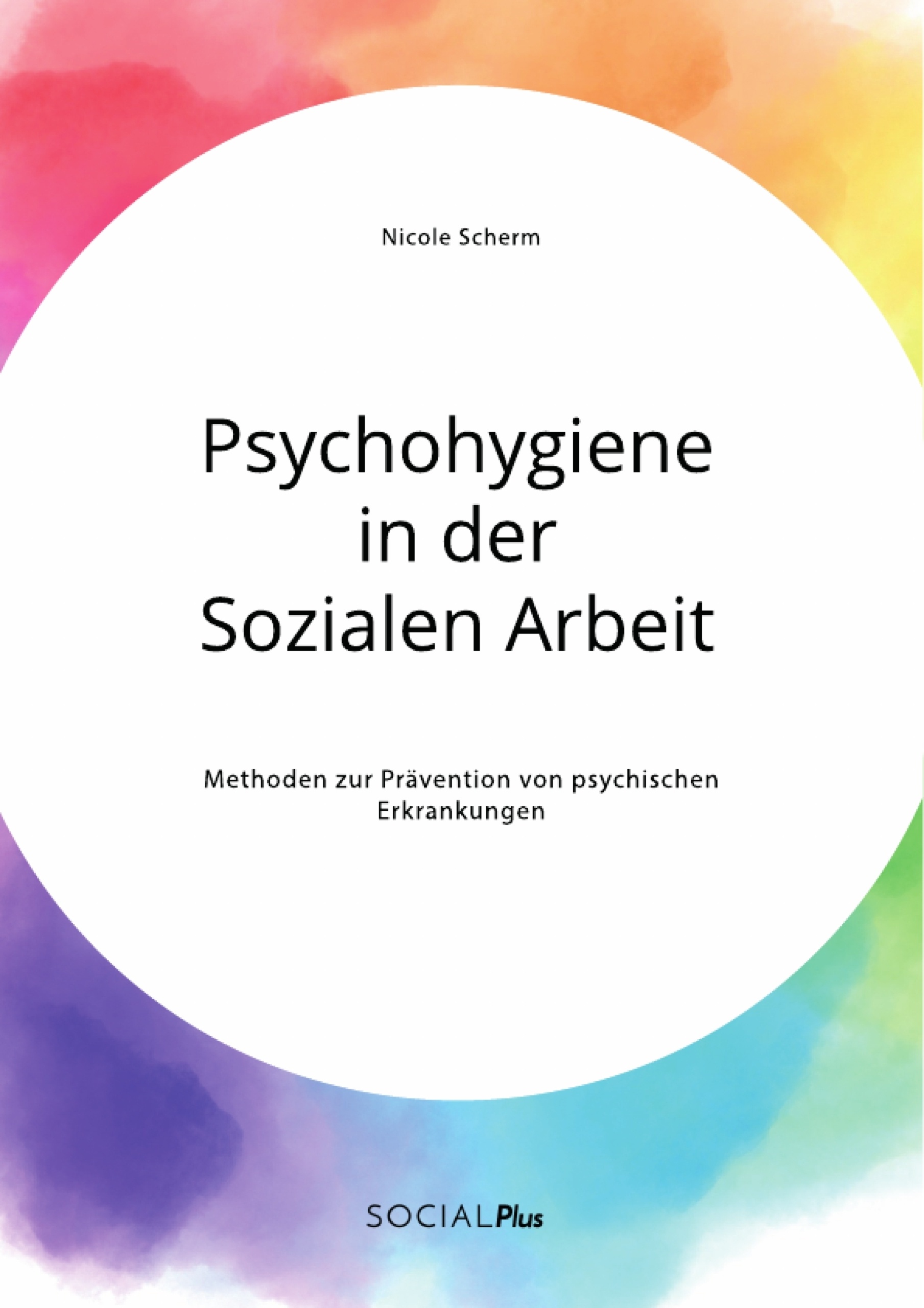Immer mehr Menschen erleiden psychische Erkrankungen und müssen vorzeitig aus dem Berufsleben austreten. Dies gilt insbesondere für Sozialarbeiter, die vielfältigen Belastungen in ihrem Berufsalltag ausgesetzt sind. Psychohygienische Maßnahmen können Stress und Belastungen entgegenwirken und psychischen Erkrankungen vorbeugen.
Was sind die Ursachen von psychischen Belastungen? Welche gesundheitlichen Folgen von psychischen Belastungen gibt es? Und wie können sich Sozialarbeiter konkret vor Stress und Belastungen schützen?
Die Autorin Nicole Scherm gibt einen Überblick über die möglichen Ursachen von psychischen Belastungen bei Sozialarbeitern. Darauf aufbauend stellt sie verschiedene Coping-Strategien vor und prüft diese auf ihre Wirksamkeit. Außerdem leitet sie konkrete Handlungsempfehlungen zur Prävention von psychischen Belastungen ab.
Aus dem Inhalt:
- Soziale Arbeit
- Stressempfinden
- Burnout
- Depression
- Stressbewältigungsmaßnahmen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Relevanz für die Soziale Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Teil I: Theoretische Grundlagen zur Psychohygiene
- 2.1 Definition
- 2.2 Ursprung des Begriffs
- 2.3 Geschichte der Psychohygiene
- 2.4 Psychohygiene im Kontext der Rassenhygiene im Dritten Reich
- 2.5 Soziale Berufszweige mit besonderem Risiko einer hohen psychischen Belastung
- 2.6 Mögliche Ursachen für psychische Belastung von Sozialarbeitern
- 2.6.1 Das “Helfersyndrom”
- 2.6.2 Empathie
- 2.6.3 Gefühl von Machtlosigkeit
- 2.6.4 Mangelnde Wertschätzung und Anerkennung
- 2.6.5 Störung des Gleichgewichts von Nähe und Distanz zu Klienten
- 2.6.5.1 Klienten als persönliche Kontakte in sozialen Netzwerken
- 2.6.5.2 Räumliche Nähe zum Arbeitsplatz
- 2.7 Maßnahmen der Psychohygiene zur Prävention von psychischer Belastung
- 2.7.1 Unterstützung durch Einrichtung und Kollegen
- 2.7.1.1 Kollegiale Beratung bzw. Intervision
- 2.7.1.2 Einzelsupervision
- 2.7.1.3 Teamsupervision
- 2.7.1.4 Coaching
- 2.7.2 Reflexion des professionellen Handelns
- 2.7.3 Methoden zur Abgrenzung
- 2.7.3.1 Achtsamkeitsübungen
- 2.7.3.2 Nutzung eines Diensttelefons
- 2.7.3.3 Klare Abgrenzung zwischen beruflichem und privatem Handeln
- 2.7.4 Schützende Faktoren
- 2.7.4.1 Das Kohärenzgefühl
- 2.7.4.2 Familiäres und soziales Umfeld
- 2.7.5 Parallelen zur Schlafhygiene
- 2.8 Mögliche Folgen bei Nicht-Anwendung von psychohygienischen Maßnahmen
- 2.8.1 Burnout
- 2.8.2 Depression
- 2.8.3 Suchterkrankungen
- 2.8.4 Psychosomatische Erkrankungen
- 2.9 Zwischenfazit
- 3 Teil II: Empirische Studie zur Verbreitung von beruflicher Überlastung und Angeboten zum Schutz vor Überlastung
- 3.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung
- 3.2 Begründung der Wahl der Forschungsmethode
- 3.3 Durchführung
- 3.4 Umfrageergebnisse
- 3.5 Auswertung und Interpretation
- 4 Fazit und Diskussion
- 5 Handlungsempfehlungen
- Psychische Belastungen im Beruf der Sozialen Arbeit
- Methoden der Psychohygiene zur Stressprävention
- Wirkung von Supervision, Coaching und kollegialer Beratung
- Einfluss von individuellen Stressbewältigungsstrategien
- Handlungsempfehlungen für Sozialarbeiter und Einrichtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die psychischen Belastungen von Sozialarbeitern und analysiert präventive Maßnahmen im Kontext der Psychohygiene. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen im Beruf zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für Sozialarbeiter und Institutionen abzuleiten.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es die steigende Anzahl psychischer Erkrankungen bei Sozialarbeitern beleuchtet und die Relevanz psychohygienischer Maßnahmen hervorhebt. Es wird die Problematik der Berufswahl aus idealistischen Motiven anstatt fundierter Interessen und der damit verbundenen Gefahr der Überlastung diskutiert. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, bestehend aus einem theoretischen und einem empirischen Teil.
2 Teil I: Theoretische Grundlagen zur Psychohygiene: Dieser Teil bietet eine umfassende Darstellung der Psychohygiene. Es werden Definitionen erläutert, der Ursprung und die historische Entwicklung des Konzepts beleuchtet, inklusive seiner problematischen Verbindung zur Rassenhygiene im Dritten Reich. Soziale Berufsgruppen mit erhöhtem Risiko für psychische Belastungen werden benannt, und es wird eingehend auf die Ursachen dieser Belastungen eingegangen, z.B. das Helfersyndrom, die Rolle von Empathie, Machtlosigkeit, fehlende Wertschätzung und ein gestörtes Gleichgewicht von Nähe und Distanz zu Klienten. Schließlich werden Methoden zur Prävention vorgestellt, inklusive individueller Strategien, Supervision, Coaching und kollegialer Beratung, sowie schützenden Faktoren wie dem Kohärenzgefühl und einem unterstützenden sozialen Umfeld.
Schlüsselwörter
Psychohygiene, psychische Belastung, Sozialarbeit, Burnout, Depression, Helfersyndrom, Empathie, Machtlosigkeit, Supervision, Coaching, kollegiale Beratung, Stressbewältigung, Kohärenzgefühl, Prävention, Gesundheitsförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Psychische Belastung und Psychohygiene in der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit den psychischen Belastungen von Sozialarbeitern und analysiert präventive Maßnahmen im Kontext der Psychohygiene. Sie untersucht die Herausforderungen im Beruf und leitet Handlungsempfehlungen für Sozialarbeiter und Institutionen ab.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Psychische Belastungen im Beruf der Sozialen Arbeit, Methoden der Psychohygiene zur Stressprävention, die Wirkung von Supervision, Coaching und kollegialer Beratung, den Einfluss individueller Stressbewältigungsstrategien und Handlungsempfehlungen für Sozialarbeiter und Einrichtungen. Sie umfasst einen theoretischen Teil mit Definitionen, der Geschichte der Psychohygiene (inkl. kritischer Auseinandersetzung mit der Rassenhygiene im Dritten Reich) und Ursachenanalyse psychischer Belastungen (z.B. Helfersyndrom, Empathie, Machtlosigkeit). Ein empirischer Teil beinhaltet eine Studie zur Verbreitung beruflicher Überlastung und Schutzangebote.
Welche Methoden der Psychohygiene werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Methoden der Psychohygiene zur Prävention psychischer Belastung, darunter Unterstützung durch Einrichtung und Kollegen (kollegiale Beratung, Intervision, Einzel- und Teamsupervision, Coaching), Reflexion des professionellen Handelns, Methoden zur Abgrenzung (Achtsamkeitsübungen, Diensttelefon, klare Trennung Beruf/Privatleben), und schützenden Faktoren wie das Kohärenzgefühl und ein unterstützendes soziales Umfeld. Parallelen zur Schlafhygiene werden ebenfalls gezogen.
Welche Folgen können bei Nicht-Anwendung psychohygienischer Maßnahmen auftreten?
Die Arbeit nennt Burnout, Depressionen, Suchterkrankungen und psychosomatische Erkrankungen als mögliche Folgen, wenn keine psychohygienischen Maßnahmen angewendet werden.
Welche Art von empirischer Studie wurde durchgeführt?
Die Arbeit enthält einen empirischen Teil mit einer Studie (die genaue Methode wird im Text spezifiziert, aber hier nicht im Detail aufgeführt), welche die Verbreitung beruflicher Überlastung und die vorhandenen Schutzangebote untersucht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen im Beruf der Sozialen Arbeit zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen für Sozialarbeiter und Institutionen abzuleiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychohygiene, psychische Belastung, Sozialarbeit, Burnout, Depression, Helfersyndrom, Empathie, Machtlosigkeit, Supervision, Coaching, kollegiale Beratung, Stressbewältigung, Kohärenzgefühl, Prävention, Gesundheitsförderung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil zur Psychohygiene, einen empirischen Teil mit einer Studie, ein Fazit, und Handlungsempfehlungen. Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der theoretische Teil beschreibt die Psychohygiene umfassend, inklusive Ursachen und Präventionsmaßnahmen. Der empirische Teil präsentiert die Ergebnisse der Studie. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und leitet Handlungsempfehlungen ab.
- Quote paper
- Nicole Scherm (Author), 2020, Psychohygiene in der Sozialen Arbeit. Methoden zur Prävention von psychischen Erkrankungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/500104