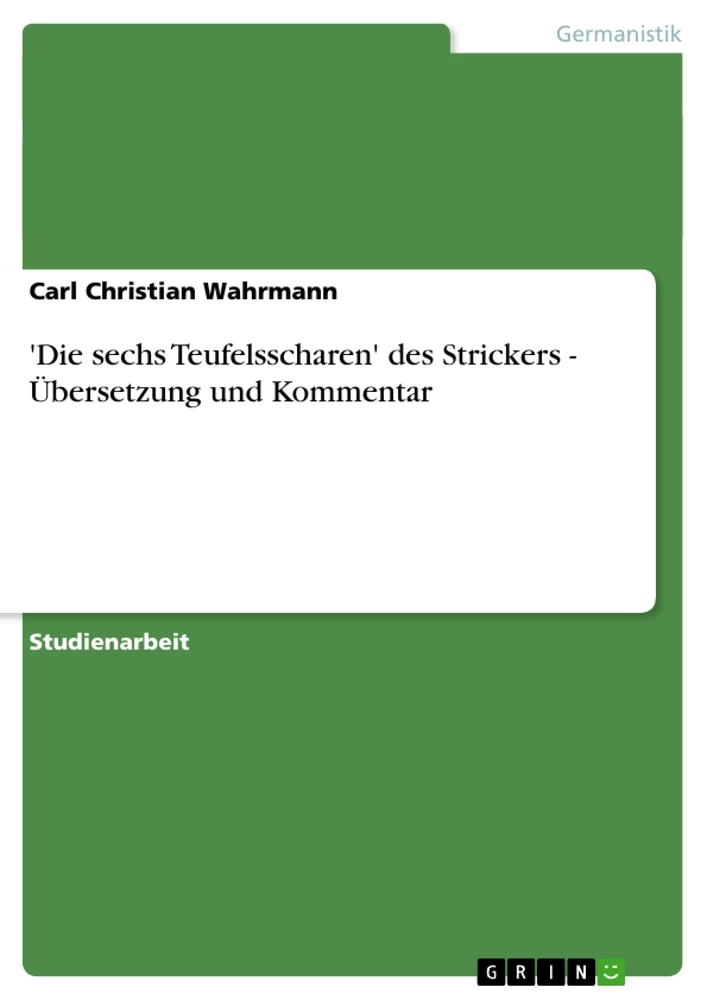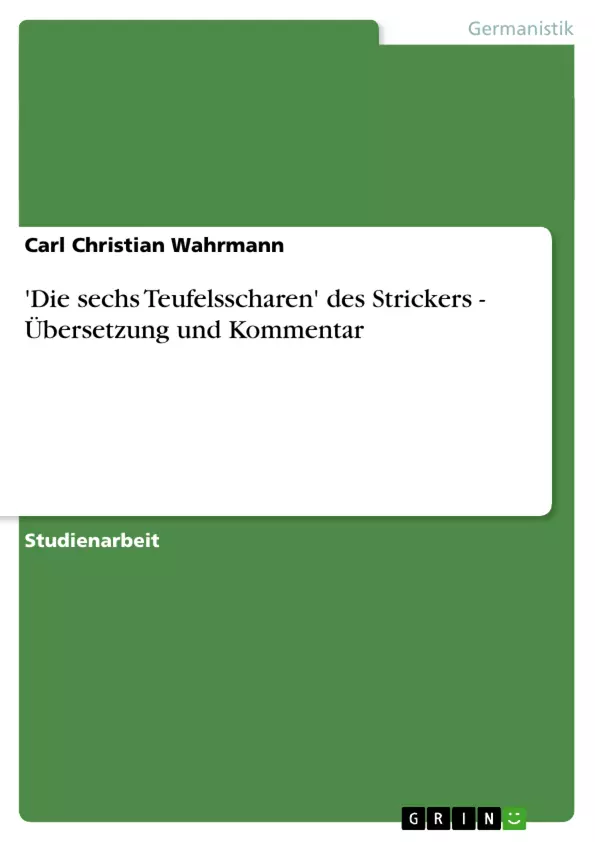Als der Stricker in der Mitte des 13. Jahrhunderts seine Kleindichtungen verfasste, hatte er dabei vielfach ein Publikum im Auge, das durch die Texte belehrt und zu einem guten Leben erzogen werden sollte. Ein interessantes Beispiel dieser didaktischen Literatur sind „Die sechs Teufelsscharen“, in denen vor den verschiedenen Gefahren gewarnt wird, die den Menschen an einem gottgefälligen Leben hindern können. Für jede dieser Gefahren ist eine Gruppe von Teufeln verantwortlich.1Der Text gehört zu den diskursiven Kleindichtungen des Strickers, genauer zur Gruppe der Reihen und Katalogreden. Die Belehrung des Lesers/Hörers erfolgt bei diesem Texttyp nicht allein durch die vorgebrachten Argumente, es ist vor allem die Anzahl der vorgebrachten Argumente, die überzeugend wirkt.
Wie kaum ein zweiter Autor der Zeit zeichnet sich der Stricker durch die Vielseitigkeit seines Werkes aus. Zunächst sind da die großen Erzählungen zu nennen, die auch von der Forschung bevorzugt untersucht worden sind. Im Karl verarbeitet der Stricker die Geschichte um den Spanienfeldzug Karls des Großen, im Daniel von den blühendem Tal nimmt er Elemente der Artusdichtung auf, zeigt sich hier also als Autor, der sich mit höfischen Themen befasst. Einer nichthöfischen Thematik wendet sich der Stricker im Schwankroman um den Pfaffen Amîs zu, dessen Hauptfigur Amîs seine Mitmenschen mit seinen Streichen und Betrügereien narrt.
Neben diesen umfangreichen Werken werden dem Stricker noch weitere Kleindichtungen (bis um 1000 Verse) zugeschrieben, die häufig einen belehrenden Charakter haben.
Diese Vielseitigkeit macht es plausibel, dass es sich beim Stricker um einen Berufsdichter gehandelt hat, der für seine jeweiligen Auftraggeber Schriften verfasste. Die häufige Verwendung geistlicher Themen legt es zudem nahe, dass der Stricker über eine theologische Ausbildung verfügte, die er zur Erziehung seines Publikums einsetzte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung und Kommentar
- Quellen und Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Kleindichtung „Die sechs Teufelsscharen“ des Strickers, die im 13. Jahrhundert entstand. Der Autor belehrt sein Publikum durch die Warnung vor verschiedenen Gefahren, die ein gottgefälliges Leben verhindern. Diese Gefahren werden jeweils von einer Gruppe von Teufeln repräsentiert. Die Arbeit bietet eine Übersetzung des Textes und einen umfassenden Kommentar.
- Didaktischer Charakter der Kleindichtung
- Die sechs Teufelsscharen als Symbol für verschiedene Lebensgefahren
- Analyse der Sprache und Form des Textes
- Der Stricker als Autor und seine Werke
- Rezeption und Bedeutung des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Werk „Die sechs Teufelsscharen“ des Strickers vor und erklärt den didaktischen Charakter der Dichtung. Sie gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen des Textes und stellt die Rolle der Teufelsscharen als Repräsentanten für Lebensgefahren dar. Außerdem wird der Stricker als Autor vorgestellt und sein Werk in den Kontext der mittelalterlichen Literatur eingeordnet.
Übersetzung und Kommentar
Dieser Abschnitt bietet eine Übersetzung der Kleindichtung „Die sechs Teufelsscharen“ und einen detaillierten Kommentar. Die Übersetzung berücksichtigt den Wortlaut der von Wolfgang Moelleken herausgegebenen Ausgabe und erläutert Besonderheiten der Sprache und Form des Textes. Der Kommentar beleuchtet die einzelnen Abschnitte der Dichtung und analysiert die Bedeutung der verschiedenen Teufelsscharen.
Schlüsselwörter
Kleindichtung, Stricker, Teufelsscharen, didaktische Literatur, Lebensgefahren, Übersetzung, Kommentar, mittelalterliche Literatur, Geistlichkeit, Moral, Gesellschaft, Sprache, Form.
Häufig gestellte Fragen
Wer war "Der Stricker"?
Der Stricker war ein vielseitiger Berufsdichter des 13. Jahrhunderts, bekannt für seine didaktischen Kleindichtungen, Schwänke (wie "Pfaffe Amîs") und höfischen Erzählungen.
Worum geht es in der Dichtung "Die sechs Teufelsscharen"?
Es ist ein belehrender Text, der vor verschiedenen Gefahren warnt, die ein gottgefälliges Leben verhindern, wobei jede Gefahr symbolisch durch eine Gruppe von Teufeln dargestellt wird.
Was ist das Ziel didaktischer Literatur im Mittelalter?
Das Ziel war die moralische Erziehung und Belehrung des Publikums, um es zu einem besseren, christlich geprägten Lebenswandel zu führen.
Zu welcher Gattung gehört dieser Text?
Der Text gehört zu den diskursiven Kleindichtungen, speziell zur Gruppe der Reihen- und Katalogreden.
Besaß der Stricker eine theologische Ausbildung?
Die häufige Verwendung geistlicher Themen und die erzieherische Absicht legen nahe, dass er über eine fundierte theologische Bildung verfügte.
- Quote paper
- M.A. Carl Christian Wahrmann (Author), 2005, 'Die sechs Teufelsscharen' des Strickers - Übersetzung und Kommentar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50034