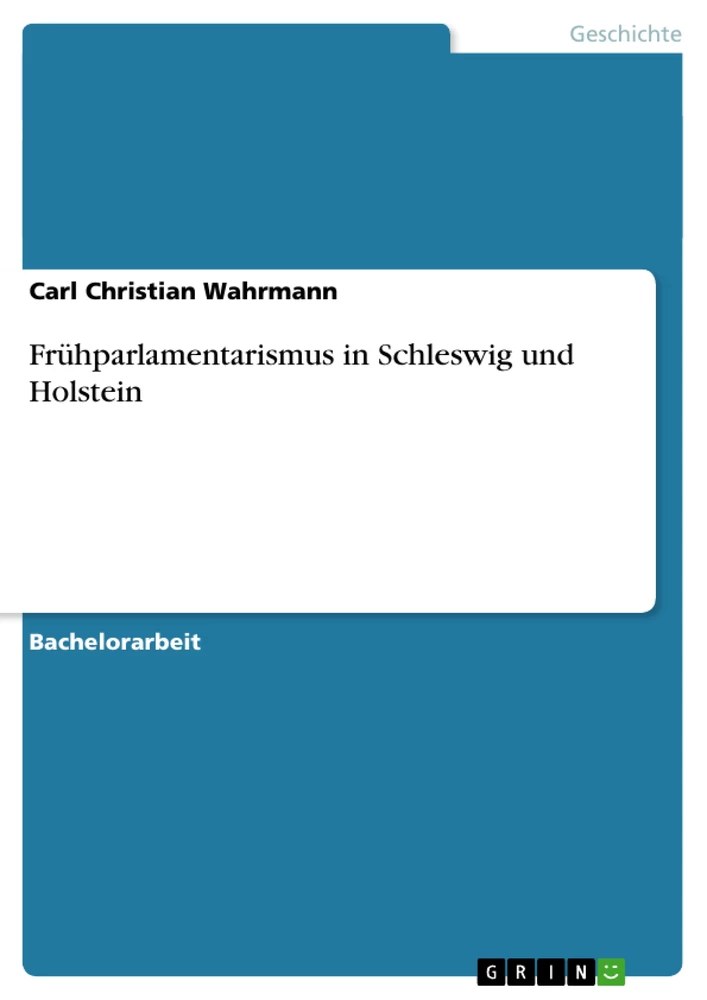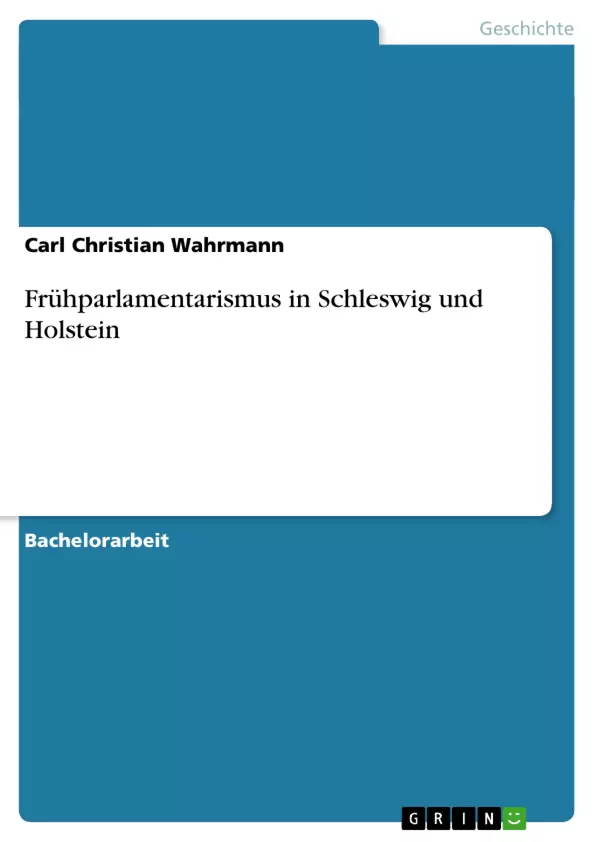In der europäischen Geschichte der Neuzeit gibt es zwei Herrschaftsmodelle, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite der Parlamentarismus, die Regierung durch Räte, ermächtigt durch Wahl oder Geburt, die über die Geschicke eines Landes abstimmen, auf der anderen Seite steht der Absolutismus, die unumschränkte Macht des Monarchen, der ohne rechtliche Bindung an menschliche Instanzen nach eigenem Ermessen regieren kann. Beide Modelle konkurrierten häufig miteinander um die entscheidenden Machtpositionen. Zu Beginn der Epoche, am Beginn des 16. Jahrhunderts, dominieren republikanische Elemente, die später in weiten Teilen von fürstlicher Gewalt abgelöst wurden. Auch in Schleswig und Holstein lässt sich dieser Vorgang beobachten. Am Ende des Mittelalters sind die Stände die beherrschende Kraft im Lande. Sie wählen den Landesherrn, ihren Entscheidungen ist er in vielen Bereichen unterworfen. Erst nach mehr als zweihundert Jahren endet die Mitbestimmung der Stände. 1675 fand der letzte Landtag statt, ab diesem Zeitpunkt regierte der Herrscher ohne direkte Mitsprache der Einwohner.
Nur wenige republikanische Territorien errreichten ihre Unabhängigkeit von fürstlicher Herrschaft. Die Schweiz und die nördlichen Niederlande sind hierfür die bekanntesten Beispiele. Da jedoch in den meisten Fällen keine Seite bereits in der Frühzeit dominierte, waren sowohl die Stände als auch der Fürst aufeinander angewiesen. Die Stände benötigten den Fürsten als oberste Instanz, die ihnen Schutz vor äußeren Feinden garantierte und die innere Odnung wahrte. Der Fürst war dafür auf „Rat und Hilfe“, besonders die Steuerbewilligung der Stände angewiesen, um dieser Aufgabe gerecht werden zu können.
Die Möglichkeit, die eigenen Forderungen oder Bitten vorzubringen und gemeinsam Politik zu betreiben, war die Einberufung eines Landtages. Auf dieser Versammlung fanden die Verhandlungen statt, seine Entscheidungen waren verbindlich. Hier trafen sich der Landesherr oder sein Vertreter und die Stände zur Beratung. Im allgemeinen setzte sich die ständische Seite aus Vertretern der Geistlichkeit, des Adels und der Städte zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Forschungsstand
- 3. Schleswig und Holstein am Ende des Mittelalters
- 4. Die Wahl Christians I. zum Landesherrn 1460
- 5. Der Vertrag von Ripen und seine Bewertung
- 5.1 Wahlmodus
- 5.2 Landesverwaltung
- 5.3 Privilegien
- 5.4 Gerichtswesen
- 6. „Tapfere Verbesserung“ von Kiel
- 7. Entwicklung des ständischen Einflusses nach 1460
- 7.1 Durchsetzung der Landeseinheit
- 7.2 Wahlrecht
- 7.3 Indigenat
- 7.4 Steuerhoheit
- 8. Ausblick: Der Vertrag von Ripen und das 19. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erlangung und den Umfang der Dominanz der Stände in der Politik Schleswig-Holsteins am Ende des Mittelalters. Der Fokus liegt auf den Verträgen von 1460 (Ripen und Kiel) als Schlüsselereignisse, die die Rechte und Pflichten der Stände definierten und ihren Einfluss auf die politische Wirklichkeit beleuchteten. Die Arbeit analysiert die fortdauernde Bedeutung dieser Verträge und deren Einfluss auf das spätere Verständnis des schleswig-holsteinischen Staates.
- Die Machtstellung der Stände in Schleswig-Holstein am Ende des Mittelalters
- Analyse der Verträge von Ripen und Kiel von 1460
- Die Durchsetzung und Erhaltung der ständischen Rechte
- Der Einfluss der Verträge auf die politische Entwicklung
- Die Bedeutung der Verträge im Kontext des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung stellt die Gegenüberstellung von Parlamentarismus und Absolutismus in der europäischen Geschichte dar und beschreibt den Übergang von ständischer Dominanz zu fürstlicher Herrschaft in Schleswig-Holstein. Sie führt in die Fragestellung ein: Wie erlangten die Stände ihre Dominanz und welche Bedeutung hatten die Verträge von 1460 für die politische Entwicklung Schleswig-Holsteins? Die Arbeit zielt darauf ab, die Artikel der Verträge zu untersuchen und deren Einfluss auf die politische Realität zu analysieren, sowie die Frage zu klären, inwieweit die einmal erlangte Stellung der Stände aufrechterhalten werden konnte. Der Ausblick auf das 19. Jahrhundert soll die langfristige Bedeutung der Verträge von 1460 beleuchten.
2. Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zur Ständeproblematik in Schleswig-Holstein. Es wird auf die Arbeit von Ulrich Lange eingegangen und die Schwierigkeit, neue Erkenntnisse zu präsentieren, hervorgehoben.
3. Schleswig und Holstein am Ende des Mittelalters: Dieses Kapitel beschreibt die politische und soziale Situation in Schleswig und Holstein vor der Wahl Christians I. Es legt die Grundlage für das Verständnis der Machtverhältnisse und der Rolle der Stände vor dem Hintergrund des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit. Die wirtschaftliche und politische Stärke der einzelnen Stände (Adel, Geistlichkeit, Städte) wird beleuchtet und ihre Bedeutung im Kontext des Landtages erläutert. Der Kapitel liefert den historischen Kontext für die Ereignisse von 1460.
4. Die Wahl Christians I. zum Landesherrn 1460: Dieses Kapitel beschreibt die Wahl Christians I. zum Landesherrn und deren Bedeutung für die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Landesherrn und den Ständen. Es beleuchtet die Umstände und die Folgen der Wahl und setzt den Kontext für die Verträge von 1460. Die Kapitel erörtert die Bedeutung der Wahl für die Stärkung der ständischen Position und den Beginn einer Periode relativer ständischer Macht in Schleswig-Holstein.
5. Der Vertrag von Ripen und seine Bewertung: Dieses Kapitel analysiert den Vertrag von Ripen von 1460, der die Machtverteilung zwischen dem Landesherrn und den Ständen regelte. Es untersucht die einzelnen Aspekte des Vertrages, einschließlich des Wahlmodus, der Landesverwaltung, der Privilegien der Stände und des Gerichtswesens. Die Zusammenfassung analysiert die Bedeutung jedes Punktes und dessen Auswirkungen auf das politische System. Die Kapitel wird den Einfluss des Vertrages auf die weitere Entwicklung des Landes beleuchten.
6. „Tapfere Verbesserung“ von Kiel: Dieses Kapitel behandelt den zweiten wichtigen Vertrag von 1460, die „Tapfere Verbesserung“ von Kiel. Die Zusammenfassung wird die Besonderheiten dieses Vertrags im Vergleich zum Vertrag von Ripen analysieren und die Bedeutung für das politische System Schleswig-Holsteins herausarbeiten. Der Fokus wird auf den spezifischen Einfluss des Kieler Vertrags auf die Macht der Stände liegen und dessen Zusammenspiel mit dem Vertrag von Ripen.
7. Entwicklung des ständischen Einflusses nach 1460: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Einflusses der Stände nach 1460. Es analysiert, inwieweit die Stände ihre Machtposition behaupten konnten und welche Faktoren dazu beitrugen oder sie beeinträchtigten. Die Zusammenfassung wird die Aspekte der Landeseinheit, des Wahlrechts, des Indigenats und der Steuerhoheit untersuchen und ihren Einfluss auf die ständische Macht analysieren. Es beleuchtet auch Konflikte und Veränderungen der Machtverhältnisse im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Frühparlamentarismus, Schleswig-Holstein, Stände, Landtag, Christian I., Vertrag von Ripen, „Tapfere Verbesserung“ von Kiel, ständische Rechte, Landesherr, Machtverhältnisse, Wahlrecht, Steuerhoheit, Indigenat, Landesverwaltung, Mittelalter, Neuzeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Stände in Schleswig-Holstein am Ende des Mittelalters
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Erlangung und den Umfang der Dominanz der Stände in der Politik Schleswig-Holsteins am Ende des Mittelalters. Der Fokus liegt auf den Verträgen von 1460 (Ripen und Kiel) als Schlüsselereignisse, die die Rechte und Pflichten der Stände definierten und ihren Einfluss auf die politische Wirklichkeit beleuchteten. Die Arbeit analysiert die fortdauernde Bedeutung dieser Verträge und deren Einfluss auf das spätere Verständnis des schleswig-holsteinischen Staates.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Machtstellung der Stände, die Analyse der Verträge von Ripen und Kiel, die Durchsetzung und Erhaltung ständischer Rechte, den Einfluss der Verträge auf die politische Entwicklung und die Bedeutung der Verträge im Kontext des 19. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die politische und soziale Situation in Schleswig und Holstein vor der Wahl Christians I., die Wahl Christians I. selbst und die Entwicklung des ständischen Einflusses nach 1460, einschließlich Aspekte wie Landeseinheit, Wahlrecht, Indigenat und Steuerhoheit.
Welche Verträge stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentralen Dokumente der Analyse sind der Vertrag von Ripen und die „Tapfere Verbesserung“ von Kiel, beide aus dem Jahr 1460. Die Arbeit untersucht die einzelnen Aspekte dieser Verträge, einschließlich Wahlmodus, Landesverwaltung, Privilegien der Stände und Gerichtswesen, um deren Auswirkungen auf das politische System zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung und Fragestellung, Forschungsstand, Schleswig und Holstein am Ende des Mittelalters, Die Wahl Christians I. zum Landesherrn 1460, Der Vertrag von Ripen und seine Bewertung, „Tapfere Verbesserung“ von Kiel, Entwicklung des ständischen Einflusses nach 1460 und Ausblick: Der Vertrag von Ripen und das 19. Jahrhundert.
Wie wird der Forschungsstand berücksichtigt?
Kapitel 2 gibt einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zur Ständeproblematik in Schleswig-Holstein. Es wird auf die Arbeit von Ulrich Lange eingegangen und die Schwierigkeit, neue Erkenntnisse zu präsentieren, hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frühparlamentarismus, Schleswig-Holstein, Stände, Landtag, Christian I., Vertrag von Ripen, „Tapfere Verbesserung“ von Kiel, ständische Rechte, Landesherr, Machtverhältnisse, Wahlrecht, Steuerhoheit, Indigenat, Landesverwaltung, Mittelalter, Neuzeit.
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung lautet: Wie erlangten die Stände ihre Dominanz und welche Bedeutung hatten die Verträge von 1460 für die politische Entwicklung Schleswig-Holsteins?
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Artikel der Verträge von 1460 und deren Einfluss auf die politische Realität. Sie analysiert, inwieweit die einmal erlangte Stellung der Stände aufrechterhalten werden konnte und beleuchtet die langfristige Bedeutung der Verträge im 19. Jahrhundert. Details zu den spezifischen Schlussfolgerungen finden sich in den jeweiligen Kapitelzusammenfassungen.
- Quote paper
- M.A. Carl Christian Wahrmann (Author), 2004, Frühparlamentarismus in Schleswig und Holstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50036