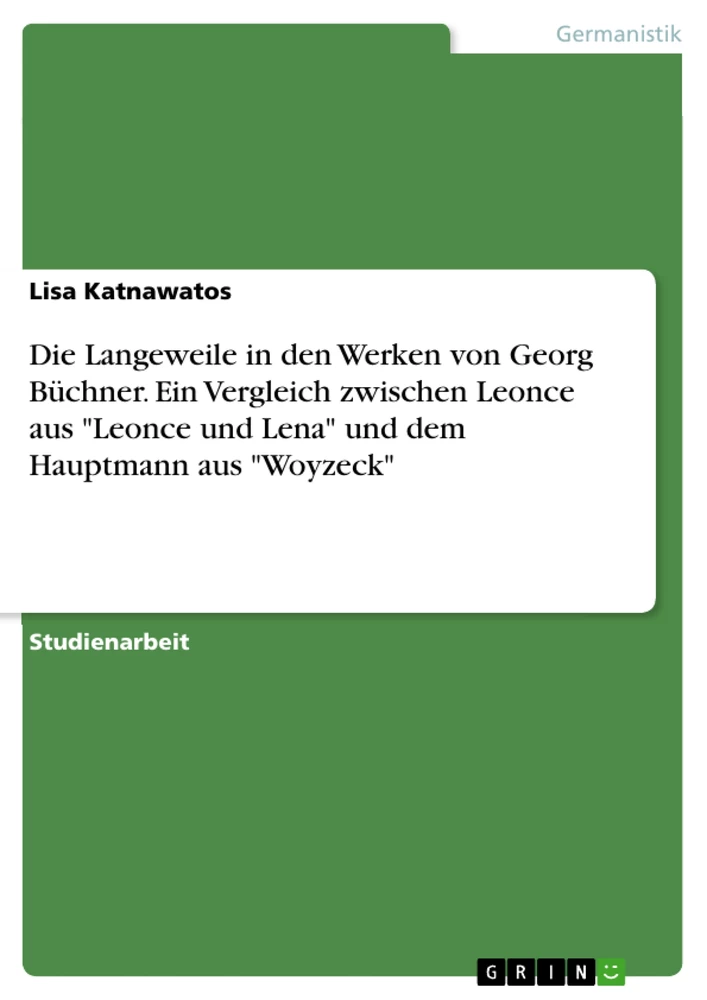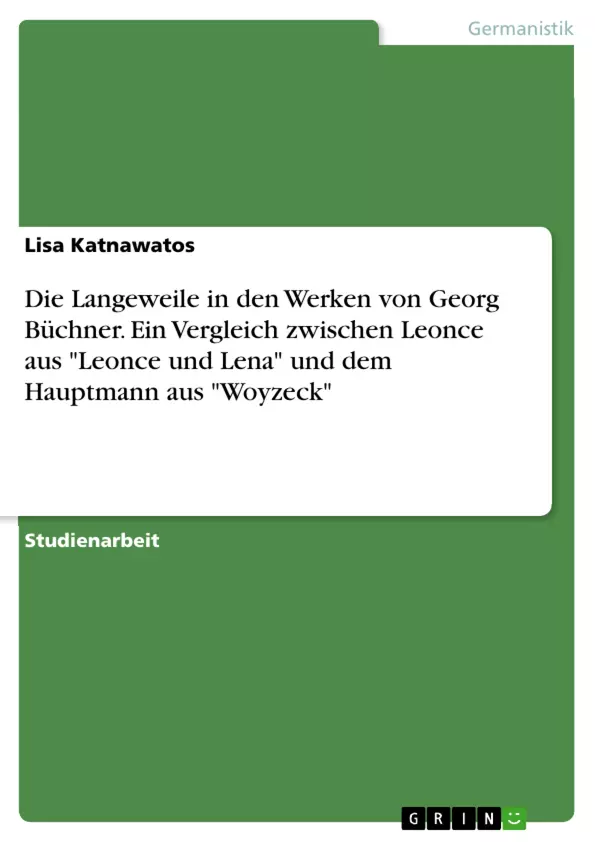In der vorliegenden Arbeit werden die Figur des Leonce aus Georg Büchners "Leonce und Lena" und die des Hauptmann aus "Woyzeck" in Hinblick auf das Thema der Langeweile untersucht und verglichen. Die Langeweile ist ein wiederkehrendes Motiv bei Büchner, das vor allem in seinem Lustspiel "Leonce und Lena" in vielfältiger Weise einfließt. Während Prinz Leonce die Sinnlosigkeit seines Daseins erkennt und aufgrund dessen unter anhaltender Langeweile leidet, die durch sinnlose Beschäftigungen, Spiel und Abwechslung nicht verdrängt werden kann, findet sich in den Figuren Valerio und König Peter eine Form des Nichtstuns, die kontrastiv nicht mit Langeweile einhergeht. Auf diese Art zieht sich das Motiv der Langeweile durch das gesamte Stück, das Büchner dort auf komische Weise kritisiert.
In der Forschung wird das Langeweile-Motiv in Büchners Werken zumeist über einen Kamm geschoren: Wird das Motiv näher untersucht, so geschieht dies in der Regel durch Heranziehen verschiedener Textstellen aus sämtlichen Werken Büchners. Es wird nicht zwischen den Figuren differenziert. Stellt man die Figuren jedoch einander gegenüber, so ergeben sich in ihrem Langeweile-Empfinden nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede, denn sie mögen zwar alle die leidige Erfahrung der Langeweile machen, stellen aber Figuren mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften dar. Im Zuge dessen gehen sie mit ihrem Langeweile-Empfinden auch unterschiedlich um.
Da es im Rahmen dieser Hausarbeit nicht möglich ist, alle drei zentralen Figuren, die unter der von Büchner kritisierten Langeweile des Adels leiden, zu vergleichen, beschränkt sie sich auf Leonce und den Hauptmann. Dies bietet sich an, da Büchner sein Lustspiel "Leonce und Lena" und seine Tragödie "Woyzeck" als Doppelprojekt entworfen hat und die beiden Stücke sowieso erst zusammen betrachtet in ihrer Gänze verstanden werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Definition und Entwicklung des Begriffs der Langeweile
- Langeweile als „,Krankheit des Jahrhunderts“
- Büchners Doppelprojekt Woyzeck / Leonce und Lena
- Vergleich der Figuren in Bezug auf das Motiv der Langeweile
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Erklärungsversuch für die auftretenden Unterschiede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Motiv der Langeweile in Büchners Werken "Leonce und Lena" und "Woyzeck" und befasst sich insbesondere mit den Figuren Leonce und dem Hauptmann. Die Analyse fokussiert auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Langeweile-Empfinden der beiden Figuren und zielt darauf ab, Leonce durch die Betrachtung dieser Unterschiede in ein besseres Licht zu rücken.
- Das Motiv der Langeweile in Büchners Werken
- Der Vergleich von Leonce und dem Hauptmann
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Langeweile-Empfinden
- Die Kritik an der Langeweile des Adels
- Büchners Doppelprojekt "Woyzeck" und "Leonce und Lena"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Langeweile und dessen Bedeutung in Büchners Werken ein. Sie erläutert den Begriff der Langeweile und seine Entwicklung, insbesondere im Kontext des 19. Jahrhunderts. Zudem wird auf Büchners Doppelprojekt "Woyzeck" und "Leonce und Lena" eingegangen und die Relevanz der ausgewählten Stücke für die vorliegende Analyse begründet.
Kapitel 1 befasst sich mit der Definition und Entwicklung des Begriffs der Langeweile. Es wird die Bedeutung des Begriffs zu Büchners Zeit thematisiert und auf die spezifischen Aspekte der Langeweile in seinen Werken eingegangen.
Kapitel 2 untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Langeweile-Empfinden von Leonce und dem Hauptmann. Es analysiert, inwiefern beide Figuren die von Büchner kritisierte Langeweile des Adels verkörpern und welche spezifischen Charaktereigenschaften ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit Langeweile prägen.
Schlüsselwörter
Langeweile, Georg Büchner, "Leonce und Lena", "Woyzeck", Adel, Sozialkritik, Doppelprojekt, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Figurenvergleich, Existentielle Langeweile, „Taedium vitae“
- Arbeit zitieren
- Lisa Katnawatos (Autor:in), 2018, Die Langeweile in den Werken von Georg Büchner. Ein Vergleich zwischen Leonce aus "Leonce und Lena" und dem Hauptmann aus "Woyzeck", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/500584