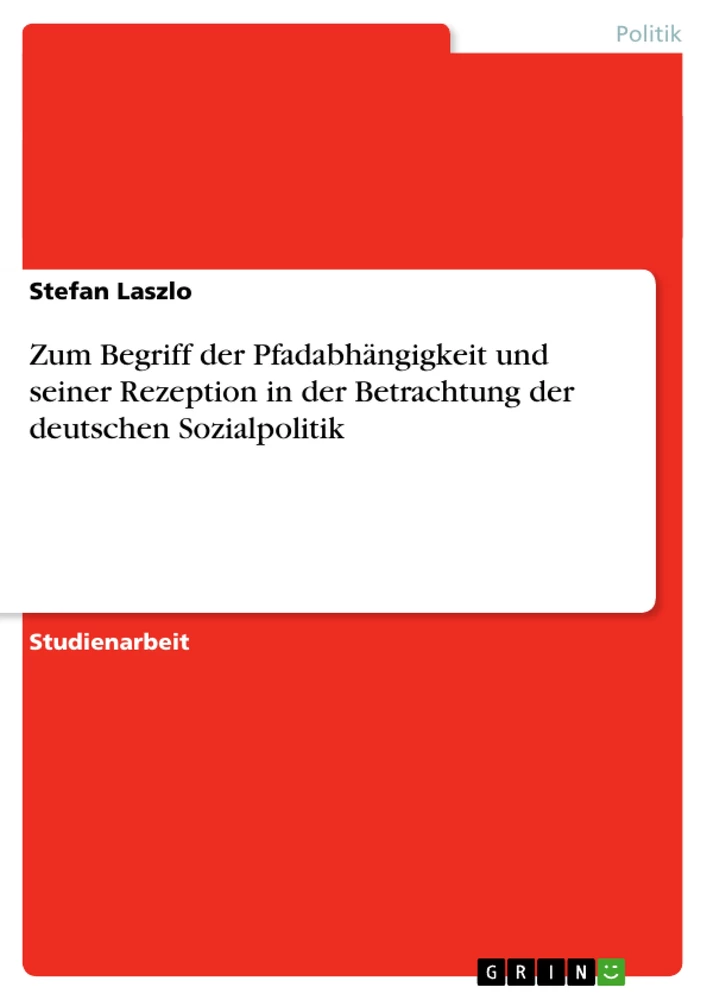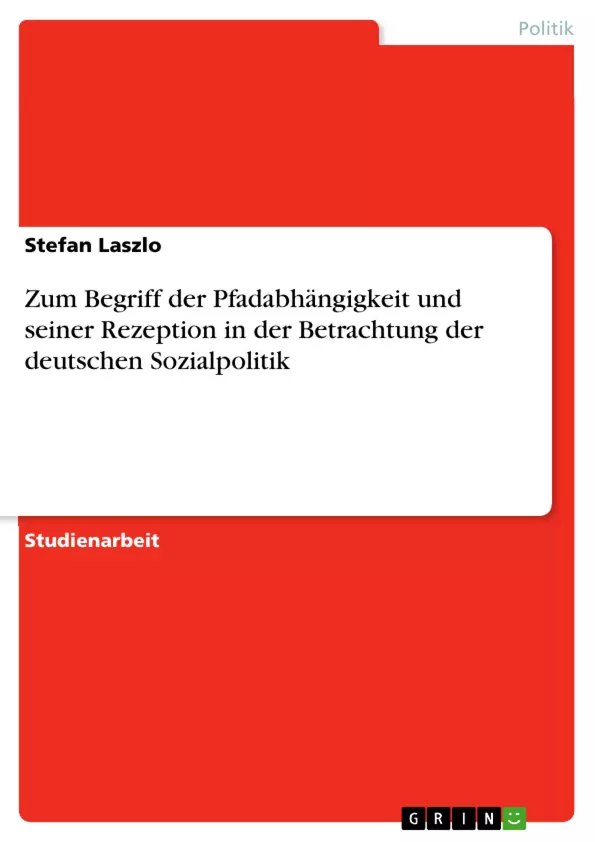Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der "Pfadabhängigkeit" (engl. "path dependency") und zwar in einem spezifischen Kontext: unter Zuhilfenahme und Anwendung der path dependency-Konzeption werden in der wissenschaftlichen Forschung nicht nur genuin ökonomische - dem eigentlichen Herkunftsfeld der Konzeption - Sachverhalte diskutiert. Der Begriff wurde auch von der Politikwissenschaft "adaptiert" und in unterschiedlichen Politikforschungsfeldern angewandt.
Dabei soll die Darstellung des Gebrauches der path dependency-Konzeption für Politikfeldforschung weiter verengt werden: zu betrachten sind Entwicklung und Folgen der Bismarckschen Sozialgesetzgebung für die Handlungsträger der deutschen Sozialpolitik. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich von den Bismarckschen Gründungsjahren bis zur Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland.
Erkenntnisleitendes Motiv ist dabei die Frage nach der tatsächlichen Handlungsfreiheit späterer Politikgenerationen ob des eingeschlagenen Weges, der in den 1880er Jahren eingeschlagen wurde. Anders gesagt: inwiefern prädestinierten die vollzogenen Reformen die Auswahl der Handlungsoption späterer Politik-Akteure.
Inhaltlich ist die vorliegende Arbeit in zwei Abschnitte unterteilt. Zunächst soll der Begriff und das Konzept der "Pfadabhängigkeit" und dessen wirtschaftsgeschichtlicher Hintergrund und Kontext dargestellt werden. In einem weiteren Schritt soll aufgezeigt werden, auf welche Art und Weise der Begriff auch für die Politikwissenschaft nutzbar gemacht wurde und welche Verwendung er hier findet. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich schließlich mit der eingangs erwähnten Thematik, i.e. dem Gebrauch des Begriffes in der Betrachtung der deutschen Sozialpolitik.
Ziel der Arbeit ist es, die grundsätzliche Bedeutung von Pfadabhängigkeit zu illustrieren. Absicht dieses Motivs ist sicherlich, den Hintergrund aktueller Diskussionen um das Gerangel der Reform der Sozialversicherungssysteme verständlich zu machen und auf die "historische Komponente" der aktuellen Diskussion zu verweisen, die für die Behäbigkeit und Reformschwierigkeit des deutschen Sozialversicherungssystems sicherlich von Relevanz ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Teil
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Zum Begriff der "Pfadabhängigkeit"
- 1.2.1 Wirtschafts- und technikgeschichtlicher Kontext
- 1.2.2 David und die "Economics of QWERTY"
- 1.3 Rezeption des Pfadabhängigkeitsbegriffes in der politischen Forschung
- 1.3.1 Pierson, North und Esping- Andersen
- II. Teil
- 2.1 Pfadabhängigkeit in der Betrachtung der deutschen Sozialpolitik
- 2.1.2 Der deutsche "Sonderweg": historische Eckdaten
- 2.1.3 Die Bismarcksche Sozialgesetzgebung: Prägung eines unabänderlichen Pfades?
- 2.1.3.1 Entwicklungstendenzen deutscher Sozialpolitik
- 2.1.3.2 Der lange Pfad deutscher Alterssicherung
- 2.2 Schlußbetrachtung
- 2.1 Pfadabhängigkeit in der Betrachtung der deutschen Sozialpolitik
- III. Teil
- 3.1 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der "Pfadabhängigkeit" im Kontext der deutschen Sozialpolitik. Sie befasst sich mit der Anwendung der Pfadabhängigkeitskonzeption auf die Entwicklung und Folgen der Bismarckschen Sozialgesetzgebung für die Handlungsträger der deutschen Sozialpolitik, von den Bismarckschen Gründungsjahren bis zur Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland.
- Der Begriff und das Konzept der "Pfadabhängigkeit" und dessen wirtschaftsgeschichtlicher Hintergrund.
- Die Rezeption des Pfadabhängigkeitsbegriffes in der politischen Forschung.
- Der Gebrauch des Begriffes in der Betrachtung der deutschen Sozialpolitik.
- Die Bedeutung von Pfadabhängigkeit für die Reform der Sozialversicherungssysteme.
- Die "historische Komponente" der aktuellen Diskussionen um die Reform der Sozialversicherungssysteme.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1.1: Einleitung
Dieses Kapitel stellt das Konzept der "Pfadabhängigkeit" vor und erläutert seinen Einsatz in der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere in der Politikwissenschaft. Es fokussiert sich auf die Anwendung der Pfadabhängigkeitskonzeption auf die Entwicklung und Folgen der Bismarckschen Sozialgesetzgebung in Deutschland.
Kapitel 1.2: Zum Begriff der "Pfadabhängigkeit"
Dieses Kapitel beleuchtet den Ursprung und die Entwicklung des Pfadabhängigkeitsbegriffes. Es erklärt, wie der Begriff aus der Wirtschafts- und Technikgeschichte stammt und auf welchen wissenschaftlichen Arbeiten er basiert. Zudem wird die Bedeutung des Konzeptes von Paul A. David und seiner Analyse der QWERTY-Tastatur erläutert.
Kapitel 1.3: Rezeption des Pfadabhängigkeitsbegriffes in der politischen Forschung
Dieses Kapitel zeigt auf, wie der Pfadabhängigkeitsbegriff von verschiedenen Politikwissenschaftlern aufgegriffen und für ihre Forschungen verwendet wurde. Es stellt die Konzeptionen von Paul Pierson, Douglass C. North und Gøsta Esping-Andersen vor und beleuchtet ihre jeweiligen Schwerpunkte.
Kapitel 2.1: Pfadabhängigkeit in der Betrachtung der deutschen Sozialpolitik
Dieses Kapitel behandelt die Anwendung des Pfadabhängigkeitsbegriffes auf die deutsche Sozialpolitik. Es untersucht, wie die Bismarcksche Sozialgesetzgebung die Entwicklung der deutschen Sozialpolitik beeinflusst hat und inwiefern die Entscheidungen der damaligen Politikgeneration die Handlungsoptionen späterer Politikakteure prägten.
Schlüsselwörter
Pfadabhängigkeit, path dependency, Sozialpolitik, Sozialversicherungssysteme, Bismarcksche Sozialgesetzgebung, deutscher Sonderweg, historische Komponente, Reform, Handlungsfreiheit, Politikfeldforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Pfadabhängigkeit" in der Politikwissenschaft?
Pfadabhängigkeit (path dependency) beschreibt, wie einmal getroffene Entscheidungen oder Reformen den Handlungsspielraum zukünftiger Generationen einschränken, da ein Verlassen des eingeschlagenen Weges mit hohen Kosten verbunden ist.
Welchen Einfluss hatte Bismarck auf die heutige Sozialpolitik?
Die Bismarcksche Sozialgesetzgebung der 1880er Jahre legte den Grundstein für das deutsche Versicherungssystem, dessen Strukturen bis heute die Reformmöglichkeiten prägen.
Warum ist das deutsche Sozialsystem so reformträge?
Aufgrund der Pfadabhängigkeit führen etablierte Institutionen und Erwartungshaltungen zu einer "Behäbigkeit", die radikale Systemwechsel politisch und ökonomisch erschwert.
Was ist das "Economics of QWERTY"-Beispiel?
Es illustriert Pfadabhängigkeit anhand der Tastaturbelegung: Obwohl QWERTY nicht die effizienteste Lösung ist, hat sie sich so tief etabliert, dass ein Wechsel zu besseren Systemen kaum noch möglich ist.
Was versteht man unter dem deutschen "Sonderweg" der Sozialpolitik?
Es bezeichnet die spezifische historische Entwicklung der deutschen Sozialversicherung, die sich deutlich von liberalen oder skandinavischen Modellen unterscheidet.
- Quote paper
- Stefan Laszlo (Author), 2003, Zum Begriff der Pfadabhängigkeit und seiner Rezeption in der Betrachtung der deutschen Sozialpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50064