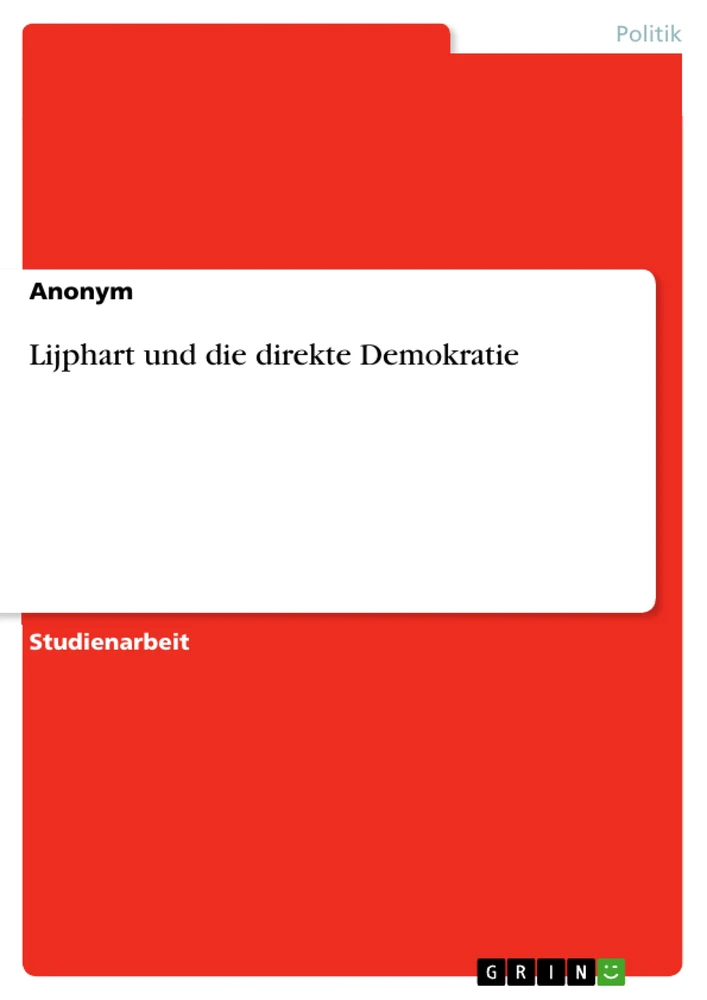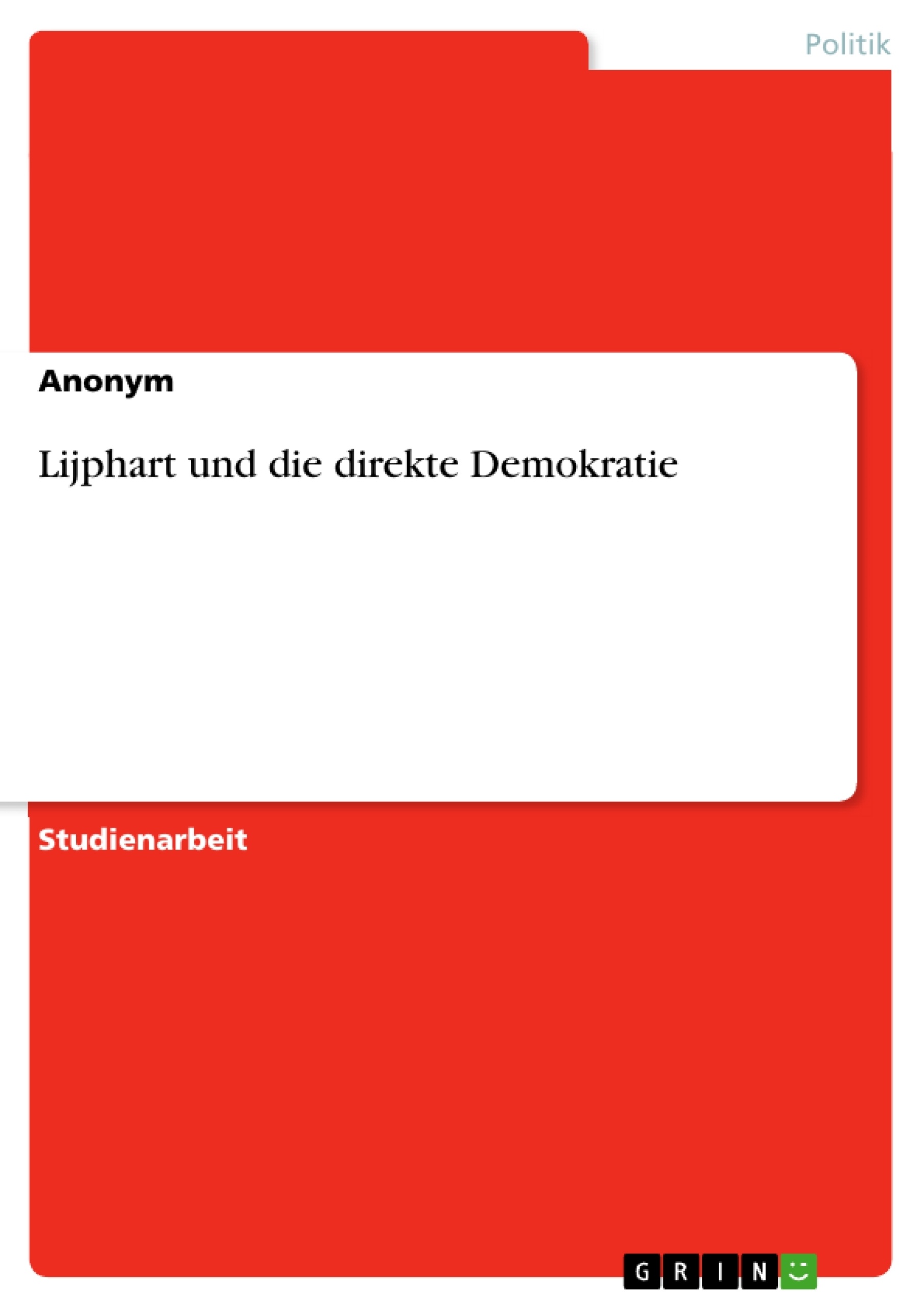Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem System der direkten Demokratie. Die direkte Demokratie gewinnt immer mehr an politischer Bedeutung. In Ländern, in denen direktdemokratische Verfahren ohnehin schon einen hohen Stellenwert einnehmen, werden sie weiterausgebaut, namentlich in der Schweiz, in Kalifornien und in Italien. Auch der Trend, direktdemokratische Institutionen in die Verfassung aufzunehmen, steigt weiter an. Die Politikwissenschaft kommt der rasanten Entwicklung der direkten Demokratie aber nicht hinterher. In der vergleichenden Demokratieforschung wird der direkten Demokratie nur wenig Beachtung geschenkt und die Akteure stoßen weitläufig auf große Probleme, direktdemokratische Elemente in ihren Typologien einzugliedern.
Es wird analysiert, ob und wenn ja sich direktdemokratische Verfahren in die Typologie Lijpharts einbetten lassen. Dabei werden elementare Gründe für den fehlerhaften Umgang mit der direkten Demokratie in der vergleichenden Politikforschung herausgestellt. Die Studie Lijpahrts wird einer kritischen Analyse unterworfen sowie modifiziert, um direktdemokratische Verfahren in seineTypologie aufzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Direkte Demokratie in der vergleichenden Politikforschung
- Mehrheitsdemokratie und Konsensusdemokratie nach Lijphart
- Kritische Untersuchung der Studie
- Aufarbeitung der Studie nach Jung
- Veto-Punkte
- Konzeptualisierung der direkten Demokratie
- Einbettung der direkten Demokratie in die Mehrheitsdemokratie und Konsensusdemokratie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Einordnung von direktdemokratischen Verfahren in die Typologie der Mehrheits- und Konsensusdemokratie nach Arend Lijphart. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Studie Lijpharts und der Herausarbeitung der Defizite bei der Einbettung direktdemokratischer Elemente. Ziel ist es, die Studie zu modifizieren und direktdemokratische Verfahren in die Typologie aufzunehmen.
- Konzeptualisierung und Bedeutung der direkten Demokratie
- Analyse der Typologie von Lijphart
- Defizite der Studie Lijpharts bei der Einordnung der direkten Demokratie
- Modifikation der Typologie zur Einbeziehung von Direktdemokratie
- Relevanz von direkter Demokratie im Kontext der vergleichenden Politikforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die wachsende Bedeutung der direkten Demokratie und die Problematik ihrer Einordnung in die vergleichende Demokratieforschung dar. Sie führt in die Studie Lijpharts und die Analyse seines Ansatzes ein.
- Direkte Demokratie in der vergleichenden Politikforschung: Dieses Kapitel behandelt die Gründe, warum eine Einordnung der direkten Demokratie in Regierungstypologien in der vergleichenden Politikwissenschaft bisher gescheitert ist. Es wird die fehlerhafte Konzeptualisierung der direkten Demokratie, die induktive Vorgehensweise und allgemeine Defizite der Studien behandelt.
- Mehrheitsdemokratie und Konsensusdemokratie nach Lijphart: Dieses Kapitel präsentiert die Studie Lijpharts und seine Typologie der Mehrheits- und Konsensusdemokratie. Es beschreibt die 10 Merkmale der beiden Idealtypen und erklärt die grundlegenden Unterschiede.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, Mehrheitsdemokratie, Konsensusdemokratie, Typologie, Lijphart, Vergleichende Politikforschung, Referenden, Volksentscheide, Regierungssysteme, Politische Institutionen.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Mehrheitsdemokratie von Konsensusdemokratie?
Lijphart unterscheidet diese anhand von 10 Merkmalen. Während die Mehrheitsdemokratie auf Machtkonzentration setzt, strebt die Konsensusdemokratie eine breite Machtverteilung und Übereinstimmung an.
Wer ist Arend Lijphart?
Arend Lijphart ist ein renommierter Politikwissenschaftler, der für seine Typologie von Regierungssystemen in der vergleichenden Demokratieforschung bekannt ist.
Warum wird direkte Demokratie in der Forschung oft vernachlässigt?
Akteure der vergleichenden Politikwissenschaft haben oft Probleme, direktdemokratische Elemente in bestehende Typologien einzugliedern, da sie oft als Fremdkörper in repräsentativen Systemen wirken.
Was sind Veto-Punkte in einem politischen System?
Veto-Punkte sind institutionelle Hürden, an denen politische Entscheidungen blockiert werden können. Direktdemokratische Verfahren wie Referenden können als solche Veto-Punkte fungieren.
Wie lassen sich Referenden in Lijpharts Typologie einbetten?
Die Arbeit untersucht, wie die Studie von Lijphart modifiziert werden kann, um Volksentscheide und Referenden systematisch in die Kategorien Mehrheits- oder Konsensusdemokratie aufzunehmen.
In welchen Ländern gewinnt direkte Demokratie an Bedeutung?
Besonders in der Schweiz, in Kalifornien (USA) und in Italien nehmen direktdemokratische Verfahren einen hohen Stellenwert ein und werden stetig weiter ausgebaut.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Lijphart und die direkte Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501045