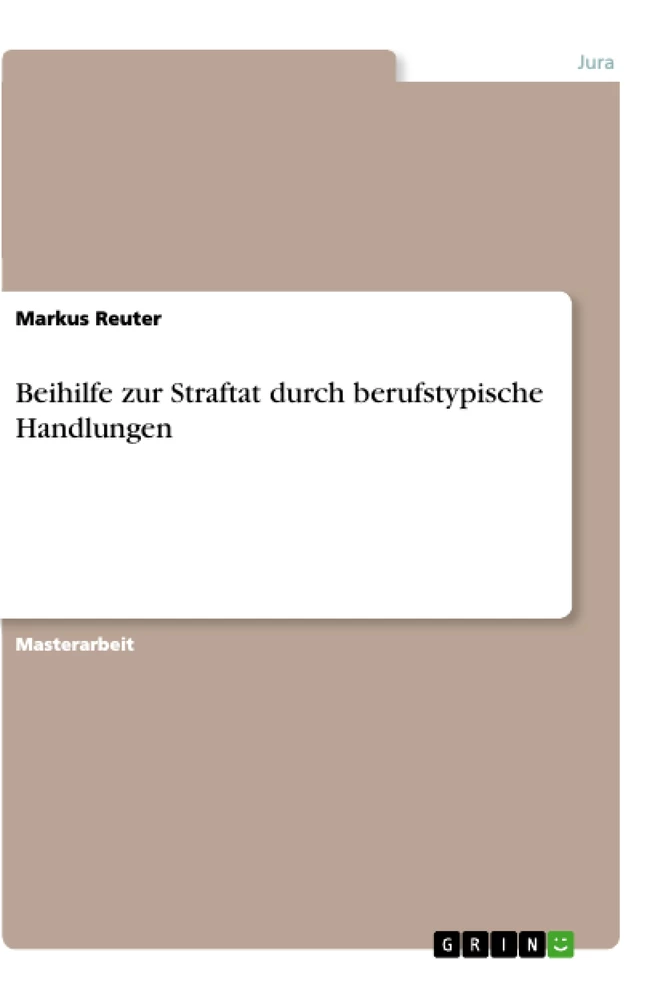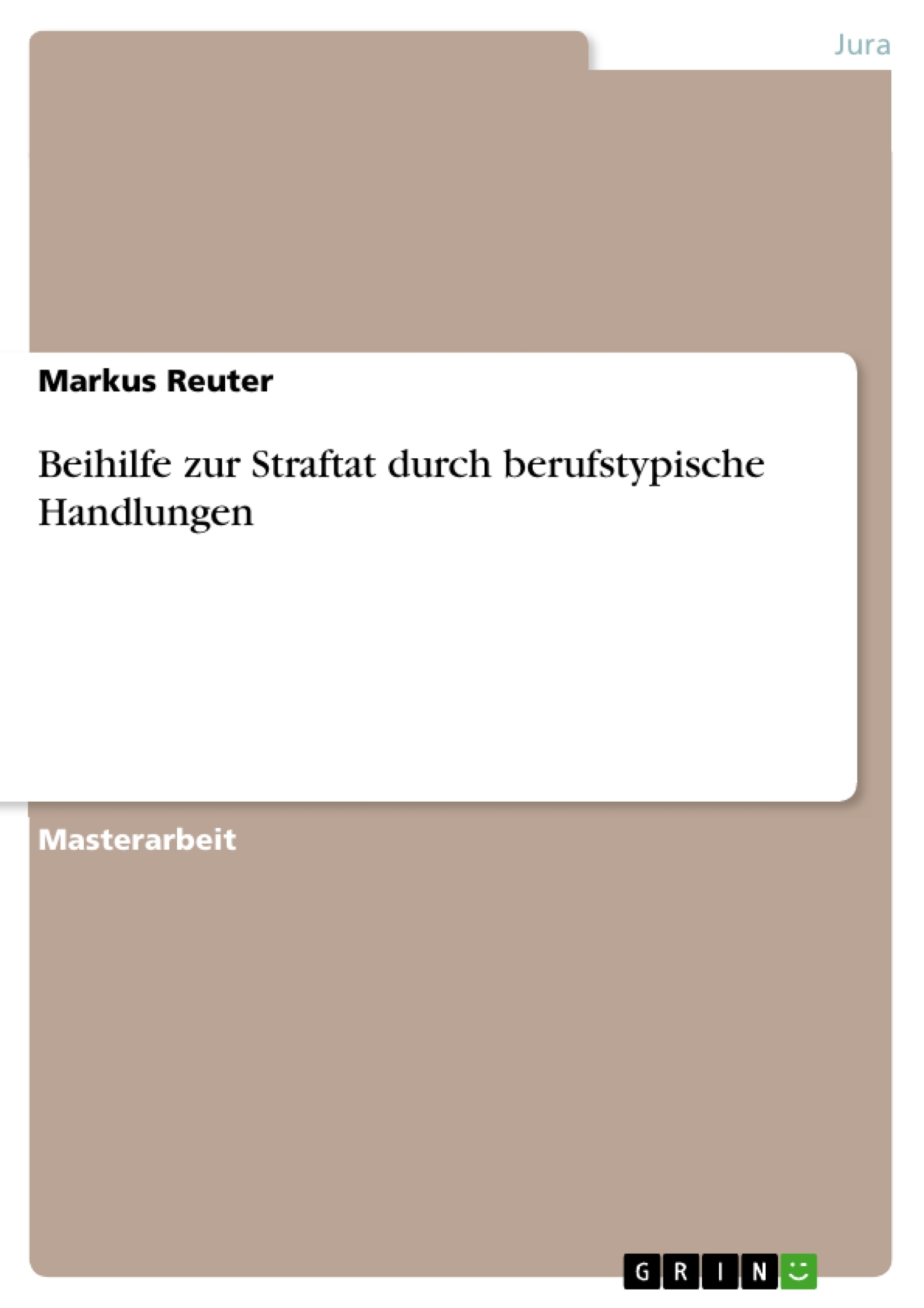Die Fragen rund um die Gehilfenstrafbarkeit neutraler oder berufstypischer Handlungen ist seit jeher umstritten. Das Problem der neutralen Beihilfe ist vielmehr eine der meistdiskutierten Fragen der letzten Zeit in der strafrechtlichen Literatur. Ziel der Untersuchung ist es, den aktuellen Stand der Diskussion zu ergründen, indem die zur Lösung der Problematik in Rechtsprechung und Literatur entwickelten Meinungen umfassend dargestellt werden. Am Ende wird auch ein Ausblick gegeben, inwieweit sich die Diskussion entwickeln könnte oder sollte.
Neben allgemeinen Erwägungen zum Begriff der "berufstypischen Handlung" und grundsätzlichen strafrechtsdogmatischn Grundlagen, wird zunächst in einem kurzen Überblick die Strafbarkeit der "normalen" Beihilfe beleuchtet. Es werden die verschiedenen Formen von neutralen, berufstypischen Handlungen in Fallgruppen unterteilt, zum einen für einen besseren Überblick über die Vielgestaltigkeit der Handlungen, zum anderen weil an die Strafbarkeit beziehungsweise die Voraussetzungen einer Einschränkung derselben (teilweise) besondere Anforderungen gelten können. Anschließend werden die in der Literatur vertretenen Ansichten zur Lösung der Problematik umfassend untersucht und die an den jeweiligen Ansichten geäußerte Kritik dargestellt. In Kapitel G wird die Kasuistik der Judikatur zur Thematik der berufstypischen Handlungen untersucht, ausgehend von einigen historischen Entscheidungen des Reichsgerichts sowie einigen älteren Entscheidungen des BGH.
Danach geht es in einem eigenen Abschnitt um eine beachtliche Entwicklung der Rechtsprechung in den vergangenen 20 Jahren, ausgehend von einigen wichtigen Entscheidungen um das Jahr 2000 herum. Abschließend werden auch einige jüngst ergangene Entscheidungen des BGH untersucht. Ein gesondertes Kapitel widmet diese Arbeit der berufstypischen Handlung durch die anwaltliche Berufstätigkeit. Diese Fallgruppe weist gewisse Besonderheiten auf, die ausgehend von der Stellung des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege dargestellt werden. Abschließend wird der Streitstand in Rechtsprechung und Literatur kurz zusammengefasst und darüber hinaus ein Ausblick hinsichtlich der künftigen Entwicklung zum Umgang mit berufstypischen Handlungen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Problemstellung
- II. Ziel der Untersuchung
- III. Gang der Untersuchung
- B. Der Begriff der „berufstypischen Handlung“
- I. Der Begriff des „Berufs“
- II. Der Begriff der „Typik“
- III. Begriffliche Definitionen in Literatur und Rechtsprechung
- IV. Zwischenergebnis
- C. Rechtliche Grundlagen und Vorgaben der Strafbarkeit „berufstypischer Handlungen“
- I. Verfassungsrechtliche Grundlagen
- 1. Bestimmtheitsgebot, Art. 103 Abs. 2 GG
- 2. Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG
- a) Schutzbereich
- b) Eingriff
- c) Rechtfertigung
- aa) Drei-Stufen-Theorie
- bb) Verhältnismäßigkeitsprinzip, § 20 Abs. 3 GG
- II. Strafrechtsdogmatische Grundlagen
- 1. Aufgabe und Grenze des Strafrechts
- a) Rechtsgüterschutz
- 2. Grundlagen des Verbrechensaufbaus
- III. Strafgrund der Beihilfe
- D. Strafbarkeit der „normalen“ Beihilfe gem. § 27 StGB
- I. Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme
- 1. Gemäßigte subjektive Theorie
- 2. Tatherrschaftslehre
- II. Objektiver Tatbestand des § 27 Abs. 1 StGB
- 1. Vorsätzliche, rechtswidrige Haupttat
- 2. „Hilfe leisten“ im Sinne des § 27 Abs. 1 StGB
- a) Zeitpunkt der Beihilfe
- b) Mittel der Beihilfe
- aa) Physische Beihilfe
- bb) Psychische Beihilfe
- c) Kausalität zwischen „Hilfe leisten“ und Haupttat
- III. Subjektiver Tatbestand
- E. Fallgruppen „berufstypischer Handlungen“
- I. Verkauf und sonstiger Austausch von Tatwerkzeugen oder Tatobjekten
- 1. Gewerblicher Verkauf
- 2. Güteraustausch unter Privaten
- II. Gewerbliche oder freiberufliche Dienstleistungen
- 1. Personen- oder Gütertransport
- 2. Rechtsanwaltliche Auskunft, Beratung und Gestaltung
- 3. Tätigkeiten weiterer freier Berufe wie Steuerberater und Notar
- 4. Bankenspezifische Dienstleistungen
- 5. Sonstige Dienstleistungen
- III. Sonderproblem: Tätigkeit als Arbeitnehmer
- F. Streitstand zur Beihilfestrafbarkeit „berufstypischer Handlungen“ in der Literatur
- G. Ansicht der Rechtsprechung zur Beihilfestrafbarkeit „berufstypischer Handlungen“
- H. Besonderheiten der Einschränkung der Beihilfestrafbarkeit bei Rechtsanwälten
- I. Fazit
- 1. Zusammenfassung
- 2. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Strafbarkeit von Beihilfehandlungen, die im Rahmen berufstypischer Tätigkeiten erfolgen. Ziel ist es, die Rechtslage zu analysieren und die verschiedenen theoretischen Ansätze und Rechtsprechungsentscheidungen kritisch zu beleuchten.
- Abgrenzung von Täterschaft und Beihilfe
- Definition und Abgrenzung „berufstypischer Handlungen“
- Rechtliche Grundlagen der Beihilfe (§ 27 StGB)
- Analyse der Rechtsprechung des BGH zu diesem Thema
- Besondere Herausforderungen bei der Beihilfe durch Rechtsanwälte
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Dieses einführende Kapitel beschreibt die Problemstellung der Strafbarkeit von berufstypischen Handlungen im Kontext der Beihilfe, benennt das Ziel der Untersuchung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
B. Der Begriff der „berufstypischen Handlung“: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der „berufstypischen Handlung“ im Detail. Es werden die Begriffe „Beruf“ und „Typik“ definiert und begriffliche Definitionen aus Literatur und Rechtsprechung kritisch geprüft. Das Zwischenergebnis fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und legt die Grundlage für die weiteren Kapitel.
C. Rechtliche Grundlagen und Vorgaben der Strafbarkeit „berufstypischer Handlungen“: Dieses Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtlichen Grundlagen (Bestimmtheitsgebot, Berufsfreiheit) und strafrechtsdogmatischen Grundlagen (Aufgabe und Grenzen des Strafrechts, Verbrechensaufbau) für die Strafbarkeit von Beihilfehandlungen. Der Strafgrund der Beihilfe wird erläutert und bildet den Rahmen für die anschließende Untersuchung.
D. Strafbarkeit der „normalen“ Beihilfe gem. § 27 StGB: Dieses Kapitel behandelt die allgemeine Strafbarkeit von Beihilfe nach § 27 StGB. Es differenziert zwischen Täterschaft und Teilnahme, untersucht den objektiven und subjektiven Tatbestand und liefert damit die Grundlage für die spätere Betrachtung der Besonderheiten berufstypischer Handlungen.
E. Fallgruppen „berufstypischer Handlungen“: In diesem Kapitel werden verschiedene Fallgruppen berufstypischer Handlungen im Kontext der Beihilfe detailliert dargestellt. Hierzu gehören der Verkauf von Tatwerkzeugen, die Erbringung gewerblicher oder freiberuflicher Dienstleistungen und die Tätigkeit als Arbeitnehmer.
F. Streitstand zur Beihilfestrafbarkeit „berufstypischer Handlungen“ in der Literatur: Dieses Kapitel präsentiert den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion zur Strafbarkeit berufstypischer Handlungen im Kontext der Beihilfe. Es werden verschiedene Theorien (extensive Theorie, objektive Theorien, gemischt objektiv-subjektive Theorien, Theorie des Ausschlusses der Rechtswidrigkeit) vorgestellt und kritisch diskutiert.
G. Ansicht der Rechtsprechung zur Beihilfestrafbarkeit „berufstypischer Handlungen“: Dieses Kapitel analysiert die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Strafbarkeit von Beihilfehandlungen im Kontext berufstypischer Tätigkeiten. Es werden sowohl historische als auch aktuelle Entscheidungen kritisch beleuchtet und ihre Entwicklung aufgezeigt.
H. Besonderheiten der Einschränkung der Beihilfestrafbarkeit bei Rechtsanwälten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen der Beihilfestrafbarkeit bei Rechtsanwälten. Es untersucht verschiedene Meinungen in der Literatur und Rechtsprechung bezüglich der Erteilung von Rechtsauskünften, rechtlichen Rats und rechtlichen Gestaltungshandlungen.
Schlüsselwörter
Beihilfe, § 27 StGB, berufstypische Handlung, Strafbarkeit, Rechtsprechung BGH, Täterschaft, Teilnahme, Rechtsanwalt, Verfassungsrecht, Strafrecht, Literatur, Theorien der Beihilfe, objektive Zurechnung, Sozialadäquanz, professionelle Adäquanz.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Strafbarkeit berufstypischer Handlungen im Kontext der Beihilfe
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Strafbarkeit von Beihilfehandlungen, die im Rahmen berufstypischer Tätigkeiten erfolgen. Sie analysiert die Rechtslage, beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze und kritisch Rechtsprechungsentscheidungen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung von Täterschaft und Beihilfe, der Definition und Abgrenzung „berufstypischer Handlungen“, den rechtlichen Grundlagen der Beihilfe (§ 27 StGB), der Analyse der Rechtsprechung des BGH, und den besonderen Herausforderungen bei der Beihilfe durch Rechtsanwälte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einführung, Definition des Begriffs „berufstypische Handlung“, rechtliche Grundlagen der Strafbarkeit, Strafbarkeit der „normalen“ Beihilfe nach § 27 StGB, Fallgruppen berufstypischer Handlungen, Streitstand in der Literatur, Rechtsprechungsübersicht, Besonderheiten bei Rechtsanwälten und ein Fazit.
Was versteht die Arbeit unter „berufstypischen Handlungen“?
Die Arbeit analysiert den Begriff „berufstypische Handlung“ detailliert, unter Berücksichtigung von Definitionen aus Literatur und Rechtsprechung. Sie untersucht die Begriffe „Beruf“ und „Typik“ und kommt zu einem Zwischenergebnis, das die Grundlage für die weiteren Analysen bildet.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die verfassungsrechtlichen Grundlagen (Bestimmtheitsgebot, Art. 103 Abs. 2 GG; Berufsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG) und strafrechtsdogmatische Grundlagen (Aufgabe und Grenzen des Strafrechts, Verbrechensaufbau). Der Strafgrund der Beihilfe (§ 27 StGB) wird ausführlich erläutert.
Wie wird die Strafbarkeit der „normalen“ Beihilfe nach § 27 StGB behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen Täterschaft und Teilnahme nach § 27 StGB, untersucht den objektiven und subjektiven Tatbestand und legt damit die Grundlage für die Betrachtung der Besonderheiten berufstypischer Handlungen. Es werden Theorien wie die gemäßigte subjektive Theorie und die Tatherrschaftslehre diskutiert.
Welche Fallgruppen berufstypischer Handlungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Fallgruppen, darunter der Verkauf von Tatwerkzeugen, die Erbringung gewerblicher oder freiberuflicher Dienstleistungen (z.B. Transport, Rechtsberatung, Bankdienstleistungen), und die Tätigkeit als Arbeitnehmer.
Wie wird der aktuelle wissenschaftliche Diskurs dargestellt?
Das Kapitel zum Streitstand in der Literatur präsentiert verschiedene Theorien zur Strafbarkeit berufstypischer Handlungen im Kontext der Beihilfe und diskutiert diese kritisch. Es werden z.B. die extensive Theorie, objektive Theorien, gemischt objektiv-subjektive Theorien und die Theorie des Ausschlusses der Rechtswidrigkeit vorgestellt.
Wie wird die Rechtsprechung des BGH berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu diesem Thema, sowohl historische als auch aktuelle Entscheidungen werden kritisch beleuchtet und ihre Entwicklung aufgezeigt.
Welche Besonderheiten bestehen bei Rechtsanwälten?
Die Arbeit widmet sich den spezifischen Herausforderungen der Beihilfestrafbarkeit bei Rechtsanwälten, untersucht verschiedene Meinungen in Literatur und Rechtsprechung bezüglich der Erteilung von Rechtsauskünften, rechtlichen Rats und rechtlichen Gestaltungshandlungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Beihilfe, § 27 StGB, berufstypische Handlung, Strafbarkeit, Rechtsprechung BGH, Täterschaft, Teilnahme, Rechtsanwalt, Verfassungsrecht, Strafrecht, Literatur, Theorien der Beihilfe, objektive Zurechnung, Sozialadäquanz, professionelle Adäquanz.
- Quote paper
- Markus Reuter (Author), 2019, Beihilfe zur Straftat durch berufstypische Handlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501311