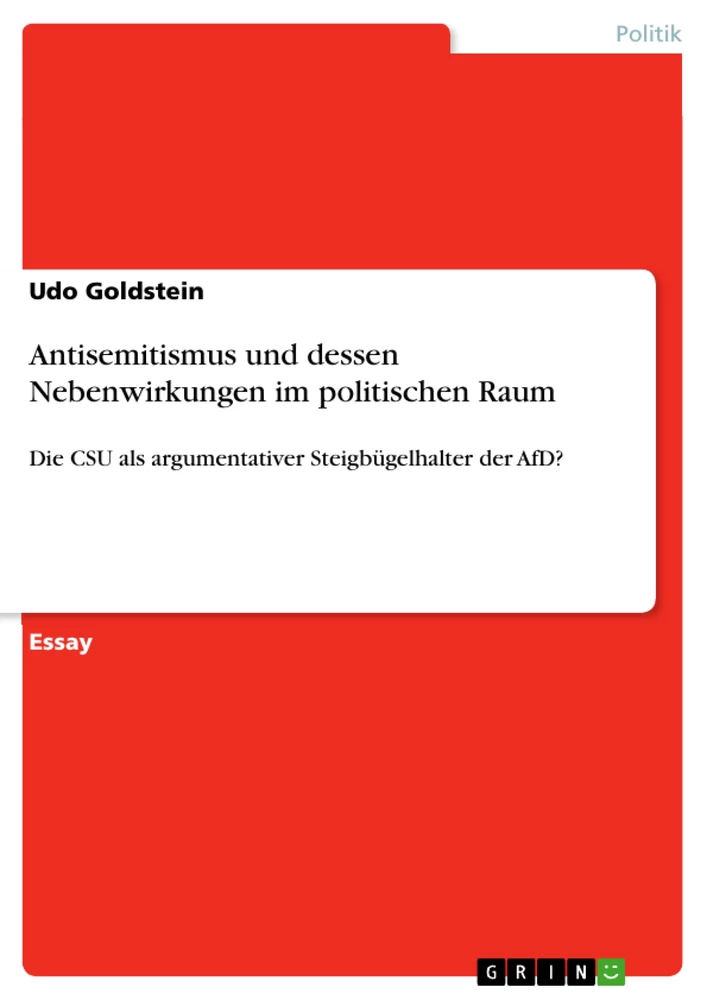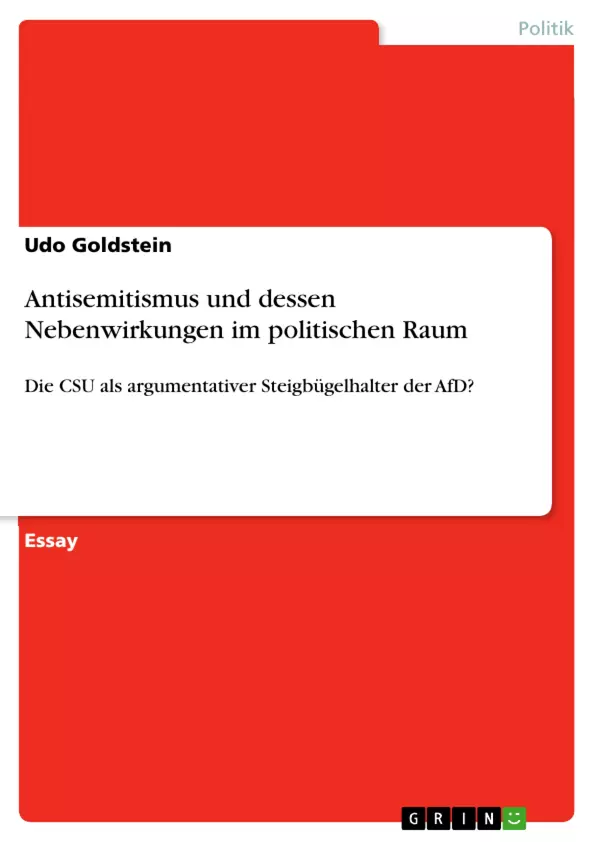Das vorliegende Essay analysiert die Nebenwirkungen von Antisemitismus in der Politik. Der Begriff des Antisemitismus hat über Jahrhunderte bis heute unterschiedlichste Konnotationen und Ausprägungen. Zum Großteil werden dabei Stereotypen verwendet, deren Tradition und stetige Wiederholung historisch weit zurückreichen. Benz unterscheidet den christlichen Antijudaismus, rassistischen Antisemitismus, sekundären Antisemitismus und israelbezogenen (antizionistischen) Antisemitismus, die je nach politischer Links- oder Rechts-Orientierung unterschiedliche Ausprägungen haben können.
Die Verknüpfung mit dem Staat Israel aufgrund der unterschiedlichsten politischen Implikationen im Rahmen des Nahost-Konfliktes seit der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 ist eine bis heute aktuelle weitere Facette dieses Phänomens. Aktuell kann diese noch um das Thema des muslimischen Antisemitismus im Zuge der Flüchtlingskrise speziell in der Europäischen Union erweitert werden, wobei auch dabei die entsprechenden geschichtlichen Dimensionen berücksichtigt werden müssen.Die Antisemitismusdebatte wurde nach 1945 auch immer als Indikator zum Stand des Demokratieverständnisses in Deutschland verstanden.
Vor diesem Hintergrund soll analysiert werden, wie die CSU in Bayern, als Regionalpartei mit bundespolitischem Anspruch, sich im Zusammenhang mit der Debatte über Antisemitismus über Dekaden hinweg positioniert hat. Die Fragestellung kann zweigeteilt gestellt werden. Zum einen, wie sich die Partei in offiziellen Aussagen in Form von Grundsatzprogrammen, Wahlprogrammen und Bundestagsanträgen geäußert hat, und zum anderen, wie die Reaktionen auf Äußerungen zu tagesaktuellen Themen seitens der Mandatsträgern/innen der CSU innerhalb der Partei ausfielen.
Inhalt
Inhalt
Die Facetten des Antisemitismus in Politik und Gesellschaft
Die AfD und der geleugnete Antisemitismus
Die CSU als Rattenfänger des rechten Randes in Bayern und die Widersprüchlichkeit im bundespolitischen Kontext
Fazit.
Literaturverzeichnis
Die Facetten des Antisemitismus in Politik und Gesellschaft
Der Begriff des Antisemitismus hat über Jahrhunderte bis heute unterschiedlichste Konnotationen und Ausprägungen. Zum Großteil werden dabei Stereotypen verwendet, deren Tradition und stetige Wiederholung historisch weit zurückreichen. Benz unterscheidet den christlichen Antijudaismus, rassistischen Antisemitismus, sekundären Antisemitismus und israelbezogenen (antizionistischen) Antisemitismus (vergl. Benz, S.19), die je nach politischer Links- oder Rechts-Orientierung unterschiedliche Ausprägungen haben können. Die Antisemitismusforscherin Helen Fein definiert: „ Antisemitismus ist ein dauerhafter latenter Komplex feindseliger Überzeugungen gegenüber Juden als einem Kollektiv […] 1. Die Verknüpfung mit dem Staat Israel aufgrund der unterschiedlichsten politischen Implikationen im Rahmen des Nahost-Konfliktes seit der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 ist eine bis heute aktuelle weitere Facette dieses Phänomens. Aktuell kann diese noch um das Thema des muslimischen Antisemitismus im Zuge der Flüchtlingskrise speziell in der Europäischen Union erweitert werden, wobei auch dabei die entsprechenden geschichtlichen Dimensionen berücksichtigt werden müssen. Der von Benz beschriebene sekundäre Antisemitismus manifestiert sich in besonderen Interpretationen geschichtlicher Zusammenhänge durch die Gesellschaft. Dazu gehören das Negieren von historisch belegtem Geschehen, etwa die Holocaust-Leugnung, die Leugnung der Beteiligung der eigenen Gesellschaft an solchem Geschehen bzw. eine Schuldzuweisung an „Dritte“ dafür, dass eine Beteiligung überhaupt in Betracht kommen konnte, sowie der Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr aus dem Motiv der Erinnerungsabwehr. Die daraus, was man sehen und auch nicht sehen will, weil es dem eigenen Weltbild widerspricht, konstruierte „Perspektive der Vergesslichkeit“ erlauben es, über die Unzulänglichkeiten der eigenen Gesellschaft hinwegzusehen. Es entstehen Verschwörungstheorien wie die "Protokolle der Weisen von Zion“ Ende des 19. Jahrhunderts, die nachweisen sollten, dass das „eigene Volk“ unter den Umtrieben ausländischer jüdischer Mächte zu leiden habe. Auch wenn wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass es sich um eine Fiktion handelt (vergl. Benz 2007, S.75), halten sich bis heute in rechten Kreisen die Unterstellungen gegen das „Weltjudentum“. Auch zum Anschlag vom 11. September 2001 werden Verschwörungstheorien vertreten, welche die Urheberschaft dem israelischen Geheimdienst unter Beteiligung der USA zuschreiben, u. a. mit dem Argument, dass sich keine Juden unter den damaligen Opfern befunden hätten.
Die AfD und der geleugnete Antisemitismus
Die AfD ist dadurch spezifisch charakterisiert, dass ihre Anhänger und somit das Wählerpotential ein ökonomisches Segment der gesellschaftlichen Mitte repräsentieren, weltanschaulich am rechten Rand stehen und ihren materiellen Wohlstand um jeden Preis verteidigen wollen. Im Blick auf die deutsche Vergangenheit wird die eigene Täterschaft im Nationalsozialismus verleugnet und damit externalisiert, und somit zugleich jegliche Schuld marginalisiert. Diese Haltung wird durch eine aktuelle Aussage des AfD-Vorsitzenden Gauland belegt: „Wir haben eine ruhmreiche Geschichte. [..]. Und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre. Und nur, wenn wir uns zu dieser Geschichte bekennen, haben wir die Kraft, die Zukunft zu gestalten. Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die zwölf Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über tausend(sic!) Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte“ (Fries 2018). Ein ähnlich selektives deutsches Geschichtsbild wurde im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt 2014 als Mittel zur Schaffung eines positiven Identitätsgefühls auf dem Weg des Geschichtsunterrichts postuliert: “ Wir wollen einen deutlichen Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert und die Befreiungskriege gesetzt wissen. Die Grundlagen unseres Staates wurden in den Jahren 1813, 1848 und 1871 gelegt“ (AfD-Sachsen 2014, S.19). Die bewusste Auslassung des Ersten und Zweiten Weltkrieges zeigt, dass historische Vergleiche für die AfD nur soweit relevant sind, wie sich in ihnen das eigene Weltbild manifestiert. In der Präambel zum Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt 2016 heißt es: „Eine einseitige Konzentration auf zwölf Unglücksjahre unserer Geschichte verstellt den Blick auf Jahrhunderte, in denen eine einzigartige Substanz an Kultur und staatlicher Ordnung aufgebaut wurde“ (AfD-Sachsen 2016, S.1). Auch hier wird eine Externalisierung der Geschehnisse vor und während des Zweiten Weltkrieges deutlich. Daraus kann man nüchtern ableiten, dass, wer den Nationalsozialismus aus der Erinnerung entsorgt, NS-Konzepte umsetzen kann, ohne als Nazi oder rechtsextrem zu gelten. Zu diesen Konzepten scheint auch der Antisemitismus zu gehören, der innerhalb der AfD auch häufig in Verbindung mit Antiamerikanismus und der Flüchtlingskrise im weitesten Sinne bzw. speziell mit „den“ Muslimen auftritt. Die Partei ist zwar formal pro-israelisch bzw. gegen Antisemitismus, aber nur dann, wenn er von muslimischer bzw. arabischer Seite artikuliert wird, mit dem gleichzeitigen Hinweis darauf, dass sie die Unterstützung ihrer Haltung durch Israel erwartet – was in der Vergangenheit regelmäßig zu öffentlichen Kontroversen zwischen jüdischen Organisationen und der AfD geführt hat. Wie zwiespältig das Thema des Antisemitismus innerhalb der AfD gehandhabt wird, machen zwei Studien aus der jüngeren Vergangenheit deutlich. Eine Antisemitismus-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung kommt bei einer Erhebung zu rechtsextremen und menschenfeindlichen Einstellungen in Deutschland zum Ergebnis: “Besonders auffällig sind die menschenfeindlichen Meinungen unter Befragten, die mit den Ideen der AfD sympathisieren: Ihre Anhänger und Anhängerinnen stimmen mehrheitlich fremdenfeindlichen (68 %), muslimfeindlichen (64 %) […] Meinungen […] zu“ (FES-Mitte-Studie 2016, S.2). Ein Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus für den Deutschen Bundestag aus dem Jahre 2017 resümiert, „ dass die AfD zu den Parteien zählt, die den Antisemitismus aus strategischen Gründen ablehnen, ihn aber latent in den eigenen Reihen dulden. Demnach ist die AfD in der Gesamtbetrachtung keine antisemitische Partei, sie hat aber mit Abstand das größte Antisemitismus-Problem – zumindest von den behandelten Parlamentsparteien“ (Expertenkreis Antisemitismus 2017, S.154).
Die CSU als Rattenfänger des rechten Randes in Bayern und die Widersprüchlichkeit im bundespolitischen Kontext
Die Antisemitismusdebatte wurde nach 1945 auch immer als Indikator zum Stand des Demokratieverständnisses in Deutschland verstanden. Vor diesem Hintergrund soll analysiert werden, wie die CSU in Bayern, als Regionalpartei mit bundespolitischem Anspruch, sich im Zusammenhang mit der Debatte über Antisemitismus über Dekaden hinweg positioniert hat. Die Fragestellung kann zweigeteilt gestellt werden. Zum einen, wie sich die Partei in offiziellen Aussagen in Form von Grundsatzprogrammen, Wahlprogrammen und Bundestagsanträgen geäußert hat, und zum anderen, wie die Reaktionen auf Äußerungen zu tagesaktuellen Themen seitens der Mandatsträgern/innen der CSU innerhalb der Partei ausfielen. Nach Alfred Mintzel verfolgt die CSU seit den 1950er Jahren eine Strategie, die darauf ausgerichtet ist, rechte Wählergruppen gezielt anzusprechen (vgl. Mintzel 1977, S.289 f.). In den Grundsatzprogrammen der CSU fehlte bis 2007 eine explizite Verurteilung des Antisemitismus (vgl. Kahmann 2014, S.61), was im Grundsatzprogramm aus dem Jahre 2016 nachgeholt wurde. Es heißt dort: „ Zu diesem Grundkonsens gehört die klare Absage an Rassismus und Antisemitismus in jeglicher Form. Jeder muss wissen, dass antisemitische oder ausländerfeindliche Hetze nicht geduldet wird “ (CSU Grundsatzprogramm 2016, Zeilen 524-526). In den Wahlprogrammen für die Landes- und Bundestagswahlen fehlt hingegen dieser Hinweis (vgl. Kahmann 2014, S.62). Die Frage, warum die Partei sich über Dekaden nicht explizit zum Antisemitismus geäußert hat, kann an dieser Stelle nicht beantwortet, sondern nur vermutet werden, dass die „rechte“ Wählerklientel (wie dies in der Flüchtlingskrise bezogen auf Dublin III hochaktuell wurde) nicht unnötig vergrämt werden sollte. Andererseits wurden Anträge zum Antisemitismus im Deutschen Bundestag aus den Jahren 2005 (Deutscher Bundestag 2005), 2008 (Deutscher Bundestag 2008) und 2013 (Deutscher Bundestag 2013) von der CSU-Bundestagsfraktion mitgetragen. Die Ambivalenz zwischen der Landes- und Bundesebene wird an dieser Stelle offenbar und kann rational nicht nachvollzogen werden.
Auf der personalen Ebene der einzelnen Mandatsträger mögen einige Beispiele diese ambivalente Haltung der CSU verdeutlichen. Der Flick-Konzern beschäftigte während des Zweiten Weltkrieges bis zu 100.000 Zwangsarbeiter. Der Forderung, diese zu entschädigen, kam der Konzern über Jahrzehnte nicht nach. Anlässlich des Verkaufs von Teilen des Konzerns an Dynamite Nobel drängte die Jewish Claims Conference darauf, die Ansprüche der Zwangsarbeiter geltend zu machen. Der innenpolitische Sprecher der CSU, Hermann Fellner, sprach in diesem Zusammenhang in einem Zeitungsinterview davon, dass er „für einen Anspruch der Juden bisher weder eine rechtliche noch eine moralische Grundlage“ erkenne. Es entsteht für ihn der Eindruck, „dass die Juden sich schnell zu Wort melden, wenn irgendwo in deutschen Kassen Geld klimpert.“ (Kahmann, S. 66). Er nahm diese Äußerung im Bundestag zwar zurück, die Frage bleibt aber, ob es nur eine formale Rücknahme dieser Äußerung war oder es sich tatsächlich um die inhaltliche Korrektur dieser Ansicht handelte. Eine Distanzierung durch den damaligen Vorsitzenden, Franz-Josef Strauss, blieb ebenso aus wie seitens der Parteizeitung Bayernkurier (vgl. Kahmann 2014, S.68). Die Debatte über Entschädigungen für NS-Zwangsarbeiter(inn)en kam im Jahre 1998 in Deutschland erneut auf, als jüdische Organisationen und Opferverbände mit einer Klage drohten. Die Forderungen richteten sich gegen deutsche Unternehmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, aber keine Bereitschaft signalisierten diese zu entschädigen. Im Jahre 2000 wurde daraufhin gemeinsam zwischen der Bundesregierung und der Wirtschaft eine Stiftungsinitiative „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gegründet mit einem Anteil von jeweils zehn Milliarden DM, die in einer Sitzung des Deutschen Bundestag, am 06. Juli 2000, beschlossen wurde Der CSU-Abgeordnete Hans-Peter Uhl erklärte dazu in einer Bundestagsrede „ Heute erinnern wir an die Opfer des Naziregimes und übernehmen wieder Verantwortung. Gerade heute ist es deshalb aber auch eine Verpflichtung des Deutschen Bundestages, jener unschuldigen Deutschen zu gedenken, denen als Zwangsarbeiter schweres Leid und grausamste Behandlung widerfahren sind (Uhl, 2000). Uhl zitiert nun den "jüdischen Deutschen" und Überlebenden von Theresienstadt Hans-Georg Adler mit Aussagen über das Schicksal von Deutschen in Theresienstadt nach 1945, die nun ihrerseits nur eingesperrt worden seien, weil sie Deutsche waren. Uhl benützt hier eine Beobachtung, die ein jüdischer KZ-Überlebender im Sinne der Menschlichkeit einbringt, zu einer Art Aufrechnung deutschen und jüdischen Leidens, welche nach gängigen Kriterien als antisemitisch bewertet werden muss. Doch die Rede wurde innerhalb der Partei nicht kritisiert, im Gegenteil, sie wurde laut Bundestagsprotokoll von der CDU/CSU-Fraktion mit Beifall honoriert. Uhl gehörte auch zu den Unterzeichnern eines Antrages der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der sich gegen den Bau des Holocaust-Mahnmals in Berlin aussprach (vgl. CSU gegen Holocaust-Denkmal 1999). Als Fazit muss festgehalten werden, dass der Sekundär-Antisemitismus hier deutlich zum Tragen kommt. Die vom Hamburger Institut für Sozialforschung konzipierte, hoch umstrittene Wehrmachtsausstellung "Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944" 1997 in München nahm der damalige CSU-Vorsitzende Peter Gauweiler zum Anlass, eine Wurfsendung an 300.000 Münchener Haushalte verteilen zu lassen, in der er die Ausstellung als „Pamphlet“ und die Verantwortlichen als Linksextreme marginalisierte, die für ihr „Richteramt“ nicht qualifiziert seien (vgl. Gauweiler 1997). Er prangerte die Ausstellung „als linkes Machwerk an, das Millionen Soldaten pauschal verurteile“ (WDR 2007). Die CSU protestierte gegen die Wehrmachtsausstellung gemeinsam mit den rechtsextremen Parteien DVU, NPD und Republikanern, was zeigt, dass eine rechte Latenz zum „Markenkern“ der CSU gehört(e).
Fazit
Um zum Ausgangspunkt der These zurückzukommen, ist zu konstatieren, dass es zwischen der AfD und der CSU nicht unerhebliche rechte Schnittmengen gibt, die durchaus politische Kernbereiche betreffen, insbesondere hinsichtlich des sekundären Antisemitismus einzelner CSU-Abgeordneter. Die Situation bei der CSU ist durch den nicht aufzulösenden Widerspruch gekennzeichnet, dass es zwischen den offiziellen Verlautbarungen der Partei und den persönlichen Verhaltensweisen einzelner Mandatsträger und der jeweiligen Reaktion der Partei darauf keine klare und widerspruchsfreie Beurteilung ermöglicht. Man könnte auch argumentieren, dass dieser Widerspruch bewusst nicht aufgelöst werden soll, um den rechten Rand der Partei nicht unnötig (im Sinn des Kalküls) zu schwächen in der Hoffnung, dass sich die Wählerschaft, insbesondere aktuell jene der AfD, weiterhin bzw. wieder der CSU zuwendet. Bei der AfD ist Antisemitismus einerseits in Form einer „Geschichtsklitterung“ (z.B. „Fliegenschiss-Aussage“ von Gauland) wirksam, welche die NS-Verbrechen und damit auch den Holocaust „nostalgisch“ marginalisiert oder ganz ausblendet, andererseits als das in fast jeder Aussage ihrer Funktionsträger eine zumindest implizite antijüdische Haltung, die auch in einem scheinbar anderen Kontext (Volk, Ausländer, Muslime, Islamophobie oder Islamismus) zur Geltung kommt. Diese indirekte Artikulation des Antisemitismus erscheint als Ausweg, wo ansonsten jegliche klare Aussage, die als sekundärer Antisemitismus aufgefasst werden kann, unter Umständen zu einer Anklage wegen Volksverhetzung bzw. Verleugnung des Holocaust führt. Da sich die Spitzenfunktionäre dessen bewusst sind, was gerade noch gesagt werden darf, nutzen sie sowohl in ihren Reden als auch in ihren Foren der Social Media bewusst die Freiheitsgrade der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 GG bis an deren Grenzen aus. Dabei trägt der internationale Austausch über die Social Media dazu bei, dass sich gleichgesinnte Gruppen schnell und effizient bilden und damit ein intensiver Austausch, mit den entsprechenden Followern und Likes, weltweit garantiert ist, verstärkt durch die Unterstützung extrem ausgerichteter rechter Medien wie den Breitbart News in den USA und ganz Aktuell der Ansatz einer Bewegungsgründung in Europa durch Steve Bannon (vgl. Bannon), dem ehemaligen engen Vertrauten von Donald Trump, bzw. dem ehemaligem Chefredakteur von Breitbart News. Als Fazit kann festgehalten werden, dass nach rechtsstaatlichen Usancen die CSU, abgesehen von unnötigem Populismus einzelner Mandatsträger, auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Die AfD hingegen steht mit offenen wie subtilen Äußerungen jenseits der politischen Zumutbarkeit und gerade noch am Rande der verfassungsmäßigen Legalität. Die nächsten Wahlen werden zeigen, ob das Agitationspotential der AfD ausreicht, um sich auf Dauer in der deutschen Politiklandschaft zu etablieren. Es wird an den Volksparteien liegen, mit faktenbasierten Aussagen die entscheidenden politischen Unterschiede deutlich zu machen. Die Parteien müssen ein Framing gegenüber Rechtspopulismus und offenem und sekundärem Antisemitismus entwickeln, dass die Gesellschaft anspricht und überzeugt.
Literaturverzeichnis
AfD-Sachsen (2014): Wahlprogramm http://www.afdsachsen.de/download/AfD_Programm_Lang.pdf (Zugriff 17.06.2018)
AfD-Sachsen (2016): Wahlprogramm http://ltw16.sachsen-anhalt-waehlt.de/fileadmin/LTW2016/Wahlprogramme/wahlprog ramm_afd.pdf (Zugriff 17.06.2018)
Bannon: US-Rechtspopulist Steve Bannon plant rechte Bewegung in Europa. https://www.dw.com/de/us-rechtspopulist-steve-bannon-plant-rechte-bewegung-in-europa/a-44774431 (Zugriff 07.08.2018)
Benz, Wolfgang (2004): Was ist Antisemitismus? C.H.Beck, München. S.19
Benz, Wolfgang (2007): Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung. C.H.Beck, München, S.75
CSU-Grundsatzprogramm (2016); https://www.csu.de/common/download/CSU_Grundsatzprogramm_Parteitag_MUC_2016_ES.pdf (Zugriff 18.06.2018)
CSU gegen Holocaustdenkmal (1999); http://www.hagalil.com/archiv/99/05/friedman.htm (Zugriff 29.06.2018)
Deutscher Bundestag (2005): Drucksache.15/5242, 12.4.2005, Antrag der Fraktionen; https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/15/052/1505242.pdf (Zugriff 18.06.2018)
Deutscher Bundestag (2008): Drucksache 16/10775, 4.11.2008, Antrag der Fraktionen; https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/107/1610775.pdf (Zugriff 18.06.2018)
Deutscher Bundestag (2013):17/13885, 11.6.2013, Antrag der Fraktionen; https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/138/1713885.pdf (Zugriff 18.06.2018)
Expertenkreis Antisemitismus (2017): Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, in: Deutscher Bundestag, Drucksache 18/11970, 7.4.2017;http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf (Zugriff 17.06.2018)
FES-Mitte-Studie (2016): Friedrich-Ebert-Stiftung „Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände“, Presse-Handout;
https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=10999&token=d27af43a8d36326af8cf0964a25a57f3b95f8ba4 (Zugriff 17.06.2018)
Fries, Stefan (2018): AfD verfälscht Gauland-Zitat; http://stefan-fries.com/2018/06/04/afd-verfaelscht-gauland-zitat/ (Zugriff 17.06.2018)
Fein, Helen (1987): Dimensions of Antisemitism. Attitudes, Collective Accusations and Ac-tions, in: Fein, Helen et al. (ed.): The Persisting Question. Sociological Perspectives and So-cial Contexts of Modern Antisemitism. Current Research on Antisemitism, vol. 1, Berlin / New York, S. 67. Deutsche Übersetzung von Werner Bergmann: Was heisst Antisemitismus? Bundeszentrale für politische Bildung, 2006.
Gauweiler (1997): Wurfsendung an 300000 Haushalte, zit. in: http://www.klick-nach-rechts.de/wehrmacht/csu-gauweiler.htm (Zugriff 18.06.2018)
Grimm, Marc/Kahmann, Bodo (2017): AfD und Judenbild, Eine Partei im Spannungsfeld von Antisemitismus, Schuldabwehr und instrumenteller Israelsolidarität, in: Grigat, Stephan, (Hrsg.), AfD & FPÖ. Nomos-Verlag, Baden-Baden
Kahmann, Bodo (2014): Offizielle Verlautbarungen der CSU zum Antisemitismus, in: Ionescu, Dana/Saltzborn, Samuel (Hrsg.), Antisemitismus in deutschen Parteien. Nomos-Verlag, Baden-Baden
Mintzel, Alf(1977): Geschichte der CSU. Ein Überblick. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Opladen
WDR (2007): Vor 10 Jahren: Wehrmachts-Ausstellung in München eröffnet; https://www1.wdr.de/stichtag2934.html (Zugriff 18.06.2018)
Uhl, Hans Peter (2000): Bundestagsrede, in: Plenarprotokoll der 114. Sitzung des Deutschen Bundestags, 6. Juli 2000, S. 10767 https://dipbt.bundestag.de/doc/btp/14/14114.pdf (Zugriff 18.06.2018)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen des Textes "Die Facetten des Antisemitismus in Politik und Gesellschaft"?
Der Text behandelt die verschiedenen Facetten des Antisemitismus in Politik und Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf die AfD und die CSU in Deutschland. Er untersucht die unterschiedlichen Ausprägungen von Antisemitismus, einschließlich christlichem Antijudaismus, rassistischem Antisemitismus, sekundärem Antisemitismus und israelbezogenem (antizionistischem) Antisemitismus. Der Text analysiert, wie diese Formen des Antisemitismus in den Parteiprogrammen und im Verhalten von Parteimitgliedern zum Ausdruck kommen.
Wie positioniert sich die AfD zum Thema Antisemitismus?
Die AfD wird als eine Partei beschrieben, die formal pro-israelisch und gegen Antisemitismus ist, jedoch nur dann, wenn dieser von muslimischer bzw. arabischer Seite artikuliert wird. Studien deuten darauf hin, dass die AfD zwar strategisch Antisemitismus ablehnt, ihn aber latent in den eigenen Reihen duldet. Der Text zitiert Aussagen von AfD-Funktionären, die eine Verharmlosung der NS-Zeit und eine Externalisierung der deutschen Schuld erkennen lassen.
Welche Rolle spielt die CSU in der Antisemitismusdebatte?
Die CSU wird als eine Partei dargestellt, die seit den 1950er Jahren eine Strategie verfolgt, rechte Wählergruppen anzusprechen. Der Text kritisiert, dass die CSU in ihren Grundsatzprogrammen bis 2007 keine explizite Verurteilung des Antisemitismus enthielt. Zudem wird die Ambivalenz zwischen den offiziellen Verlautbarungen der Partei und den persönlichen Verhaltensweisen einzelner Mandatsträger hervorgehoben. Beispiele hierfür sind Äußerungen von CSU-Politikern im Zusammenhang mit Entschädigungsforderungen für NS-Zwangsarbeiter und die Reaktion der Partei auf die Wehrmachtsausstellung.
Was ist sekundärer Antisemitismus und wie äußert er sich im Text?
Sekundärer Antisemitismus bezieht sich auf besondere Interpretationen geschichtlicher Zusammenhänge, die darauf abzielen, die eigene Schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus zu negieren oder zu relativieren. Im Text äußert sich dies durch die Leugnung des Holocaust, die Leugnung der Beteiligung der eigenen Gesellschaft an den Verbrechen bzw. eine Schuldzuweisung an „Dritte“ sowie der Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr aus dem Motiv der Erinnerungsabwehr. Beispiele hierfür sind die "Fliegenschiss-Aussage" von Gauland und die Kritik an der Wehrmachtsausstellung.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text hinsichtlich der AfD und der CSU?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass es zwischen der AfD und der CSU rechte Schnittmengen gibt, insbesondere hinsichtlich des sekundären Antisemitismus einzelner CSU-Abgeordneter. Bei der CSU wird ein nicht aufzulösender Widerspruch zwischen den offiziellen Verlautbarungen der Partei und den persönlichen Verhaltensweisen einzelner Mandatsträger festgestellt. Die AfD hingegen wird als Partei beschrieben, die mit offenen wie subtilen Äußerungen jenseits der politischen Zumutbarkeit und gerade noch am Rande der verfassungsmäßigen Legalität agiert.
- Citar trabajo
- Udo Goldstein (Autor), 2018, Antisemitismus und dessen Nebenwirkungen im politischen Raum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501323