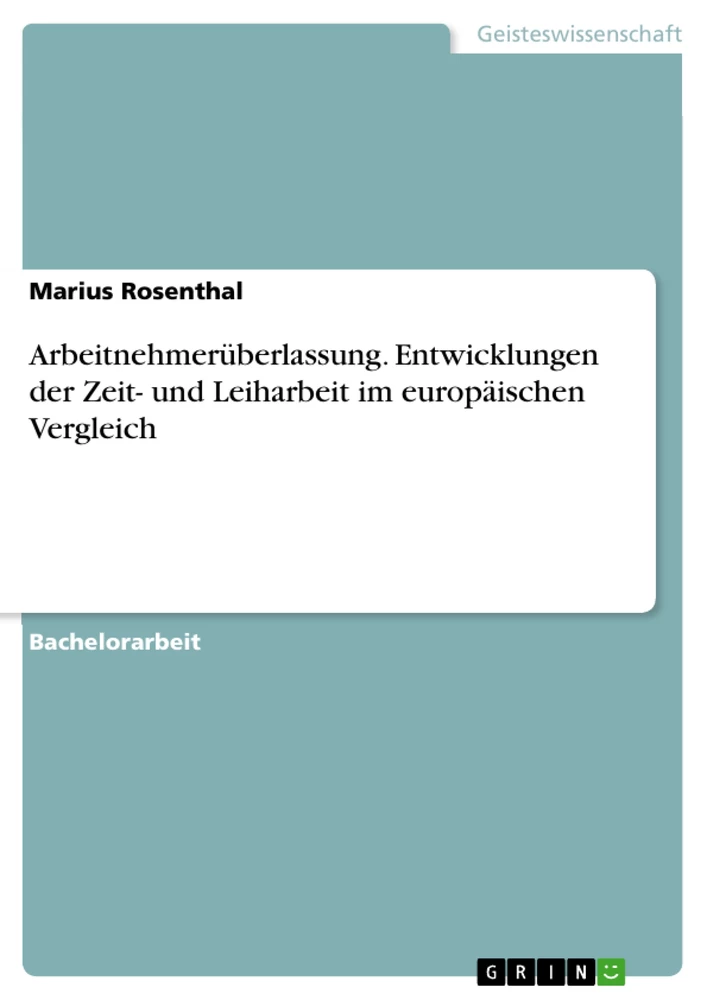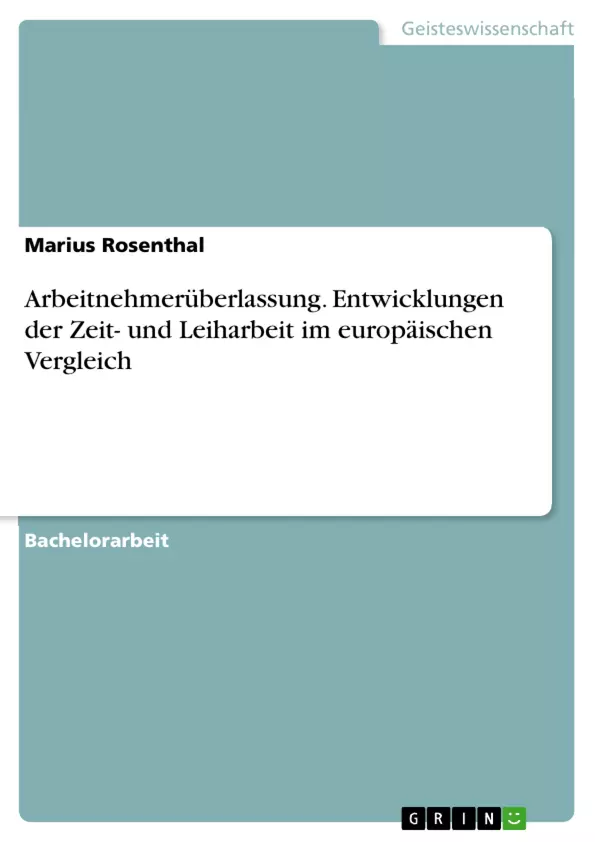Die vorliegende Arbeit untersucht mittels eines small N-Vergleichs von Zeit- und Leiharbeit in Deutschland, Frankreich und der Niederlande, den Zusammenhang zwischen Grad der gesetzlichen Regulation und Branchenwachstum. Hierzu wird die Situation und Ausgestaltung von Zeit- und Leiharbeit in den Vergleichsländern porträtiert und die Entwicklungen von Regulation und Wachstum analysiert. Auf Basis der Daten von CIETT und OECD kann in dieser Arbeit kein direkter Zusammenhang zwischen Deregulierung und dem Wachstum von Zeit- und Leiharbeit festgestellt werden. Mehrere Alternativerklärungen für das anhaltende, internationale Wachstum der Arbeitnehmerüberlassung werden andiskutiert.
Die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland wächst – niemand im öffentlichen und politischen Diskurs, kann sich diesem Faktum verweigern. Es hat niemand Interesse daran, die mit enormer Dynamik wachsende Zahl der über Zeit- und Leiharbeit beschäftigten Personen kleinzureden: 3% der deutschen Gesamtbeschäftigung, also gut 1 Million Personen waren 2017 sozialversicherungspflichtig oder geringfügig in der Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt. Und dennoch, die Interessen divergieren: die Bandbreite der Interpretation dieser Zahlen sucht ihresgleichen.
Die einen - Befürworterinnen und Befürworter, oftmals verantwortlich in Arbeitsmarktpolitik oder nah an Arbeitgebern zu verorten - sehen in diesem Wachstum die Nutzung der Chance Zeitarbeit: zur Beschäftigung von (Langzeit-)Arbeitslosen über die Arbeitnehmerüberlassung oder zur Flexibilisierung betrieblicher Arbeitsmärkte.
Die Gegnerinnen und Gegner hingegen sehen in diesem Wachstum die Gefahr Leiharbeit: die Entwicklung geht einher, mit der generellen Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, für die Beschäftigten in der Arbeitnehmerüberlassung ergeben sich im Vergleich zum Normalarbeitsverhältnis durch deren Prekarität erhebliche Gefahren und Nachteile, im Besonderen resultierend aus niedrigerer Entlohnung und erhöhter Arbeitsplatzunsicherheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Einleitung
- Fragestellung & Methode
- Datengrundlage
- OECD-Indikator für die Regulierung von Zeitarbeit
- Vergleichbarkeit
- Anteile der Beschäftigten am Gesamtarbeitsmarkt
- Anzahl der Beschäftigten
- Portraits der Zeit-/ und Leiharbeit in den Vergleichsländern
- Auswahl der Vergleichsländer
- Deutschland – zwischen Gesetzgebung und Tariflandschaft
- Frankreich - „Equal pay\" but „Hire-and-Fire\"?
- Niederlande – „Flexicurity\"
- Einleitung
- Vergleichende Analyse
- Theoretische Grundlage
- Neoklassisches Arbeitsmarktmodell
- Ökonomische Anreizstrukturen und deren Verschiebung
- Hypothesen & Variablen
- Variablendefinition
- Analyse
- Deutschland
- Frankreich
- Niederlande
- Zwischenfazit
- Theoretische Grundlage
- Konklusion
- Alternative Erklärungsansätze
- Wachstum durch Anreizstrukturen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
- Zeit- und Leiharbeit als Berufseinstieg in den Niederlanden
- Wechselwirkungen mit weiteren Reformen der Agenda 2010 in Deutschland
- Wachstum durch Anreizstrukturen von Unternehmen
- Flexibilisierung durch Personalleasing
- Arbeitnehmerüberlassung als „Wachstumspuffer"
- Zeit- und Leiharbeit als Produkt einer global aufstrebenden Dienstleistungsbranche
- Wachstum durch Anreizstrukturen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
- Fazit & Ausblick
- Alternative Erklärungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Entwicklungen von Zeit- und Leiharbeit in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden im europäischen Vergleich. Dabei liegt der Fokus auf dem Zusammenhang zwischen dem Grad der gesetzlichen Regulierung und dem Branchenwachstum. Die Arbeit analysiert die Situation und Ausgestaltung von Zeit- und Leiharbeit in den Vergleichsländern und untersucht die Auswirkungen von Deregulierungsmaßnahmen auf das Wachstum des Sektors.
- Die Auswirkungen der gesetzlichen Regulierung auf das Wachstum der Zeit- und Leiharbeit
- Der Vergleich der rechtlichen Rahmenbedingungen von Zeit- und Leiharbeit in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden
- Die Analyse der Entwicklungen von Zeit- und Leiharbeit in den Vergleichsländern
- Die Identifizierung von Faktoren, die das Wachstum der Zeit- und Leiharbeit beeinflussen
- Die Diskussion alternativer Erklärungsansätze für das anhaltende Wachstum der Arbeitnehmerüberlassung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeitnehmerüberlassung ein und definiert die Fragestellung sowie die Methode der Untersuchung. Des Weiteren werden die Datenquellen und die verwendeten Indikatoren vorgestellt.
- Kapitel 2: Portraits der Zeit-/ und Leiharbeit in den Vergleichsländern
Dieses Kapitel stellt die Situation von Zeit- und Leiharbeit in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden dar. Die einzelnen Länder werden hinsichtlich ihrer gesetzlichen Regelungen, ihrer Arbeitsmarktstrukturen und der Rolle der Arbeitnehmerüberlassung im jeweiligen Kontext beleuchtet.
- Kapitel 3: Vergleichende Analyse
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Beziehung zwischen Regulierung und Wachstum der Zeitarbeit dargestellt. Das Neoklassische Arbeitsmarktmodell wird als Referenzrahmen verwendet, um die ökonomischen Anreizstrukturen und deren Verschiebung im Zusammenhang mit Zeitarbeit zu betrachten.
- Kapitel 4: Hypothesen & Variablen
Dieses Kapitel formuliert die Hypothesen, die in der Arbeit untersucht werden. Die relevanten Variablen, wie z. B. der Grad der Regulierung, das Wachstum der Zeitarbeit und die Anteile der Beschäftigten im jeweiligen Sektor, werden definiert.
- Kapitel 5: Analyse
In diesem Kapitel werden die Daten der Vergleichsländer anhand der entwickelten Hypothesen und Variablen analysiert. Dabei wird auf die spezifischen Entwicklungen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden eingegangen.
- Kapitel 6: Alternative Erklärungsansätze
Dieses Kapitel beleuchtet alternative Erklärungsansätze für das Wachstum der Arbeitnehmerüberlassung. Es werden die Anreizstrukturen für Arbeitnehmer und Unternehmen sowie die Rolle der Zeitarbeit als Produkt einer global aufstrebenden Dienstleistungsbranche betrachtet.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit, Regulierung, Wachstum, Deregulierung, Arbeitsmarkt, Europa, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Neoklassisches Arbeitsmarktmodell, Anreizstrukturen, Dienstleistungsbranche, Flexibilität, Personalleasing.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Menschen arbeiten in Deutschland in der Zeitarbeit?
Im Jahr 2017 waren etwa 1 Million Personen (ca. 3% der Gesamtbeschäftigung) in der Arbeitnehmerüberlassung tätig.
Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Deregulierung und Branchenwachstum?
Die Arbeit zeigt auf Basis von OECD-Daten, dass Deregulierung allein nicht zwangsläufig zu einem Wachstum der Zeitarbeit führt; andere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle.
Was ist das niederländische Modell der "Flexicurity"?
Flexicurity verbindet hohe Flexibilität für Unternehmen bei der Einstellung und Entlassung mit einer starken sozialen Absicherung und Unterstützung für die Arbeitnehmer.
Was sind die Hauptkritikpunkte an der Leiharbeit?
Kritiker bemängeln die Prekarität, niedrigere Entlohnung im Vergleich zum Stammpersonal und die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses.
Warum nutzen Unternehmen Personalleasing?
Unternehmen nutzen es primär zur Flexibilisierung, als "Wachstumspuffer" bei Auftragsspitzen und zur Risikoentlastung bei der Personalplanung.
- Citation du texte
- Marius Rosenthal (Auteur), 2019, Arbeitnehmerüberlassung. Entwicklungen der Zeit- und Leiharbeit im europäischen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501658