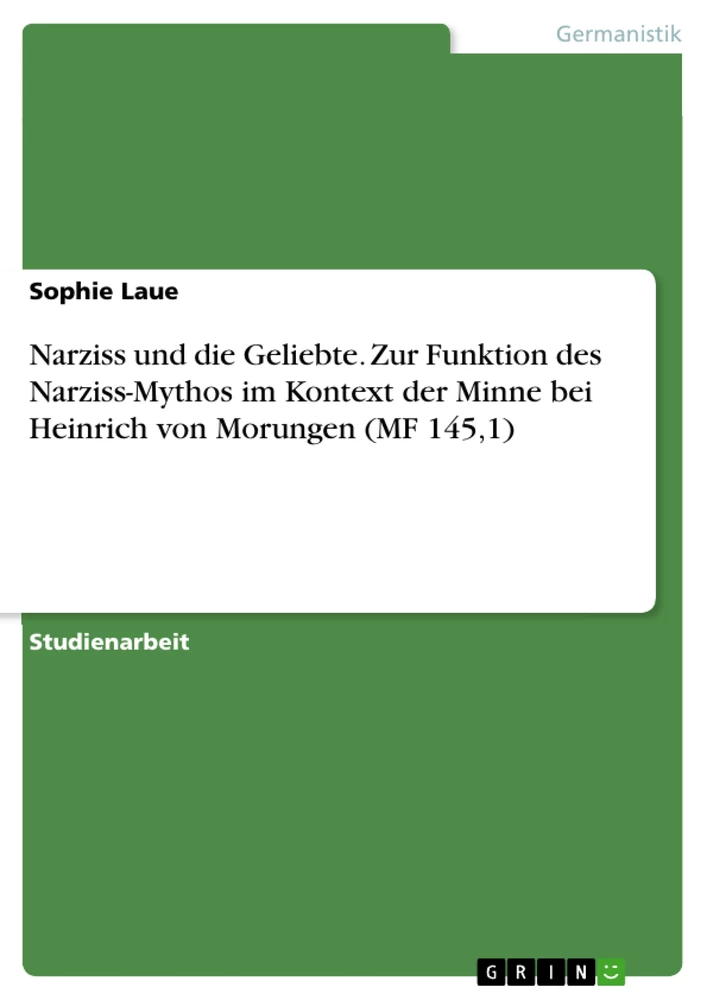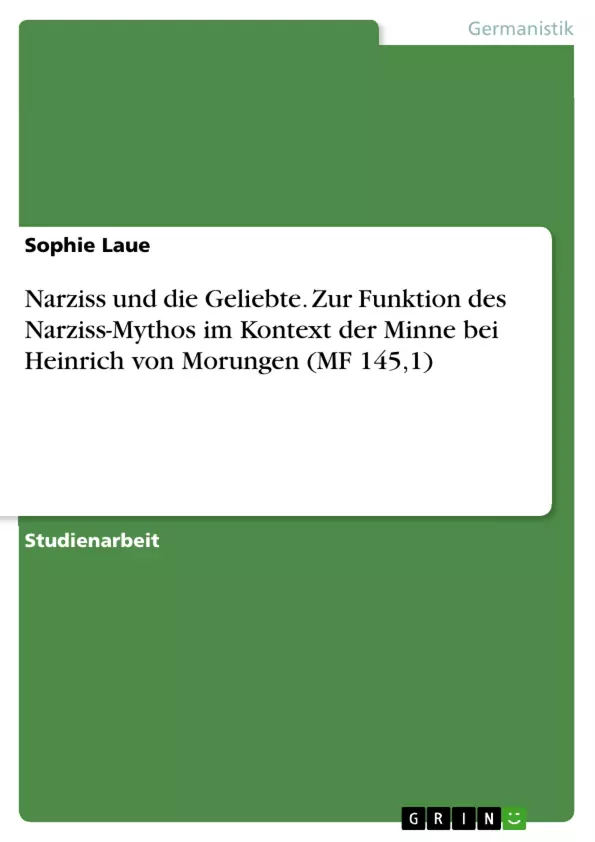Heinrich von Morungen war ein bedeutender Minnesänger aus Ostmitteldeutschland, sein Lied "Mir ist geschehen als einem kindelîne" (MF 145,1) stellt eins der meist diskutierten Minnelieder dar.
Im Rahmen dieser Arbeit soll zum einen nachgewiesen werden, inwiefern Morungens Lied und der Mythos Narziss übereinstimmen. Zum anderen wird die Funktion des Narziss-Mythos im Kontext der Minne bei Heinrich von Morungen untersucht. Die Entstehungszeit des Liedes wird kurz dargestellt, da der Minnesang, für die Beantwortung der Leitfrage von zentraler Bedeutung ist. Außerdem wird die Autorschaft Morungens diskutiert, um die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten aufzuzeigen. In einem weiteren Schritt wird sowohl das Lied als auch der Mythos inhaltlich zusammengefasst und interpretiert werden, um abschließend zu beurteilen, ob diese in Beziehung zueinander gesetzt werden können. Als Grundlage für diese Arbeit dienen die Überlieferungen der Würzburger Liederhandschrift (E) und die Übersetzungen der Würzburger Liederhandschrift (E) von Christoph Huber und Manfred Kern. Einbezogen wird insbesondere auch das Symposion zum Narzisslied von Manfred Kern, Cyril Edwards und Christoph Huber.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Minnesang
- 3. Narziss-Mythos
- 4. Interpretation der zentralen Aspekte
- 4.1 Autorschaft
- 4.2 Analyse
- 4.2.1 Illusion von Weiblichkeit
- 4.2.2 Das Sänger-Ich und die „vrouwe“
- 4.2.3 Der Spiegel als Metapher der Minne
- 4.3 Schlussfolgerungen der Analyse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übereinstimmungen zwischen Heinrich von Morungens Lied „Mir ist geschehen als einem kindelîne“ (MF 145,1) und dem Narziss-Mythos. Der Fokus liegt auf der Funktion des Narziss-Mythos im Kontext der Minne. Die Entstehungszeit des Liedes und die Autorschaft Morungens werden ebenfalls beleuchtet, um verschiedene Interpretationsmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Die Parallelen zwischen dem Lied und dem Narziss-Mythos.
- Die Funktion des Narziss-Mythos in Morungens Minnelied.
- Die Bedeutung des Spiegelmotivs als Metapher für die Minne.
- Die Darstellung des lyrischen Ichs und seiner Beziehung zur Minneherrin.
- Die Rolle von Illusion und Selbsttäuschung in der Minne.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie stellt Heinrich von Morungen und sein Lied „Mir ist geschehen als einem kindelîne“ (MF 145,1) vor, welches im Zentrum der Analyse steht. Es werden die Forschungsfragen formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Die methodischen Grundlagen und die verwendeten Quellen werden erläutert, wobei besonders die Würzburger Liederhandschrift (E) und die Arbeiten von Kern, Edwards und Huber hervorgehoben werden. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende detaillierte Untersuchung des Liedes im Kontext des Narziss-Mythos und des Minnesangs.
2. Minnesang: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Minnesang als literarische Gattung. Es beschreibt die Thematik der erotischen Beziehungen zwischen Mann und Frau, die verschiedenen Ausdrucksformen der Liebeslyrik und die Entwicklung der „Hohen Minne“. Besonders wird das Paradox der unerfüllten Liebe, das Leiden des Minnesängers und die Unmöglichkeit der sexuellen Erfüllung erläutert. Der Kontext der „Hohen Minne“ wird mit ihren ethischen und gesellschaftlichen Implikationen beleuchtet. Das Kapitel stellt den historischen und literarischen Hintergrund für die folgende Interpretation von Morungens Lied bereit und verweist auf die charakteristischen Elemente des Minnesangs, die sich auch in Morungens Werk wiederfinden.
3. Narziss-Mythos: Dieses Kapitel behandelt den Narziss-Mythos in seiner antiken Form, vorwiegend basierend auf Ovids „Metamorphosen“. Es analysiert die zentrale Thematik der Selbstverliebtheit und der daraus resultierenden Tragik. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis von Subjekt und Objekt, dem Konflikt zwischen Schein und Sein und der Rolle des Spiegels als Vermittler dieser Illusion. Der Mythos wird als eine Geschichte der Selbsttäuschung und des Scheiterns interpretiert, wobei die unerfüllte Liebe zum eigenen Spiegelbild zum Tod führt. Dieses Kapitel liefert den notwendigen Hintergrund für den Vergleich mit Morungens Lied und die Interpretation des Spiegelmotivs in diesem Kontext.
4. Interpretation der zentralen Aspekte: Dieses Kapitel interpretiert zentrale Aspekte von Morungens Lied im Lichte des Narziss-Mythos und des Minnesangs. Es analysiert die einzelnen Strophen des Liedes und deren Beziehung zueinander. Die Deutung des Spiegelmotivs als Metapher für die Minne und die Darstellung des lyrischen Ichs in seiner Beziehung zur Minneherrin stehen im Mittelpunkt. Die Analyse befasst sich mit der Illusion von Weiblichkeit, dem Verhältnis zwischen Sänger und „vrouwe“, und der Bedeutung des Spiegels als Symbol für die unerfüllte Liebe. Die Schlussfolgerungen der Analyse beleuchten die komplexen Beziehungen zwischen dem Lied, dem Mythos und der Minnetradition.
Schlüsselwörter
Minnesang, Heinrich von Morungen, Narziss-Mythos, Spiegelmotiv, Hohe Minne, unerfüllte Liebe, Selbsttäuschung, Illusion, Lyrik, mittelalterliche Literatur, Liebeslyrik, Selbstverliebtheit.
Häufig gestellte Fragen zu "Mir ist geschehen als einem kindelîne": Eine Analyse im Kontext von Minnesang und Narziss-Mythos
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Morungens Lied „Mir ist geschehen als einem kindelîne“ (MF 145,1) und untersucht die Parallelen zwischen diesem Lied und dem Narziss-Mythos. Der Fokus liegt auf der Funktion des Mythos im Kontext der Minne und der Interpretation des Spiegelmotivs als zentrale Metapher.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Parallelen zwischen dem Lied und dem Narziss-Mythos, die Rolle des Mythos in Morungens Minnelied, die Bedeutung des Spiegelmotivs als Metapher für die Minne, die Darstellung des lyrischen Ichs und seiner Beziehung zur Minneherrin, sowie die Rolle von Illusion und Selbsttäuschung in der Minne. Zusätzlich werden die Entstehungszeit des Liedes und die Autorschaft Morungens diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Minnesang, 3. Narziss-Mythos, 4. Interpretation der zentralen Aspekte (inkl. Unterkapitel zur Autorschaft und Analyse des Liedes mit Fokus auf Illusion von Weiblichkeit, dem Sänger-Ich und der „vrouwe“, sowie dem Spiegel als Metapher), und 5. Fazit. Jedes Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in den jeweiligen Aspekt.
Wie wird der Minnesang in der Arbeit behandelt?
Kapitel 2 gibt einen Überblick über den Minnesang als literarische Gattung, beschreibt die Thematik der erotischen Beziehungen, verschiedene Ausdrucksformen der Liebeslyrik und die Entwicklung der „Hohen Minne“. Es erläutert das Paradox der unerfüllten Liebe und den Kontext der „Hohen Minne“ mit ihren ethischen und gesellschaftlichen Implikationen.
Welche Rolle spielt der Narziss-Mythos?
Kapitel 3 behandelt den Narziss-Mythos in seiner antiken Form, basierend auf Ovids „Metamorphosen“. Es analysiert die Selbstverliebtheit, das Verhältnis von Subjekt und Objekt, den Konflikt zwischen Schein und Sein und die Rolle des Spiegels als Vermittler der Illusion. Der Mythos wird als Geschichte der Selbsttäuschung und des Scheiterns interpretiert.
Wie wird das Lied von Heinrich von Morungen interpretiert?
Kapitel 4 interpretiert zentrale Aspekte von Morungens Lied im Lichte des Narziss-Mythos und des Minnesangs. Es analysiert die Strophen und deren Beziehung zueinander, die Deutung des Spiegelmotivs und die Darstellung des lyrischen Ichs. Die Analyse befasst sich mit der Illusion von Weiblichkeit, dem Verhältnis zwischen Sänger und „vrouwe“, und der Bedeutung des Spiegels als Symbol für die unerfüllte Liebe.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen dem Lied, dem Mythos und der Minnetradition.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Minnesang, Heinrich von Morungen, Narziss-Mythos, Spiegelmotiv, Hohe Minne, unerfüllte Liebe, Selbsttäuschung, Illusion, Lyrik, mittelalterliche Literatur, Liebeslyrik, Selbstverliebtheit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Würzburger Liederhandschrift (E) und die Arbeiten von Kern, Edwards und Huber. Weitere Quellen werden im Text explizit genannt.
- Arbeit zitieren
- Sophie Laue (Autor:in), 2019, Narziss und die Geliebte. Zur Funktion des Narziss-Mythos im Kontext der Minne bei Heinrich von Morungen (MF 145,1), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501730