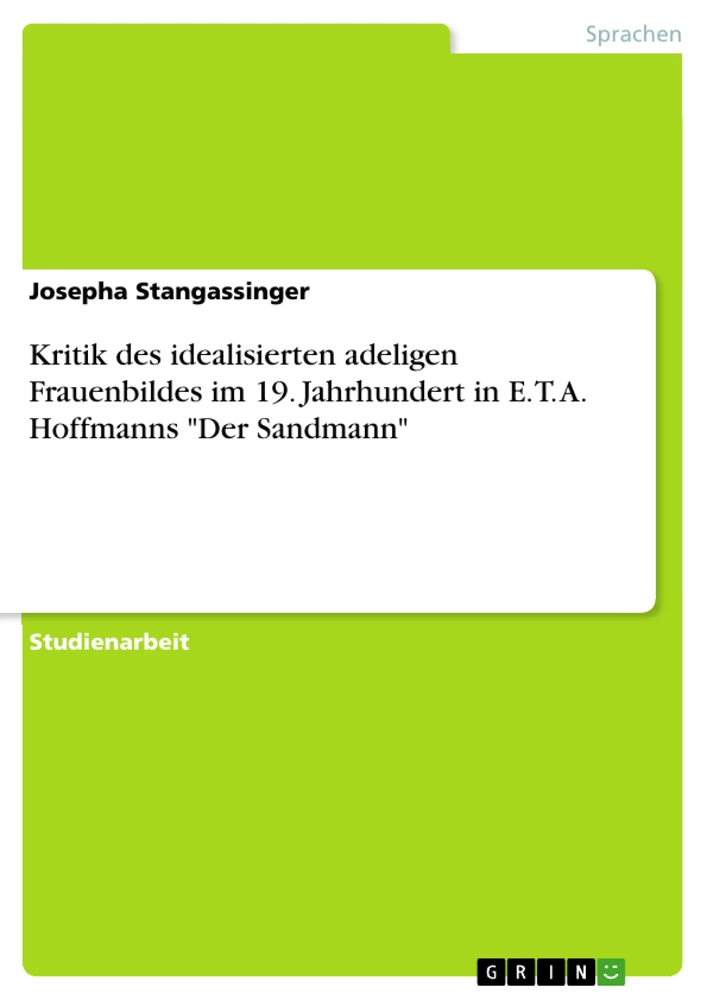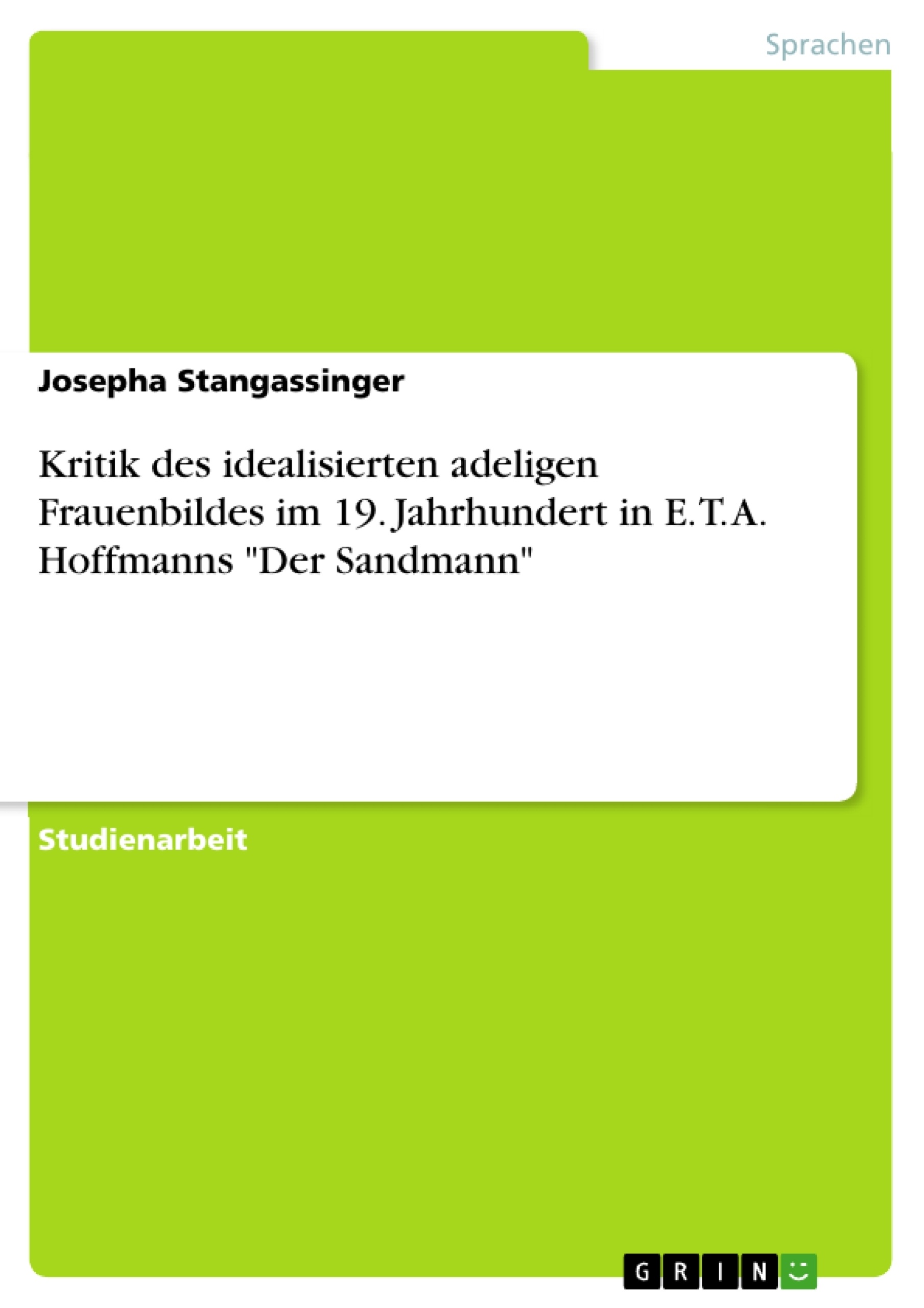Diese Arbeit befasst sich oberflächlich mit dem Niedergang des Adels im 20. Jahrhundert. Im Fokus aber steht das adelige Frauenbild dieser Zeit. Nicht nur der Adel allgemein, sondern auch deren idealisiertes Bild der perfekten Frau wurde in dieser zunehmend kritischen Zeit angeprangert. Die Seminararbeit unternimmt den Versuch, dieses so lautstark kritisierte adelige Frauenbild mit E. T. A. Hoffmann "Der Sandmann" in Verbindung zu bringen und somit die Annahme, Hoffmanns Werk sei durchaus als Kritik am damaligen adeligen Frauenbild zu verstehen, zu bestätigen. Hoffmanns Werk wurde das erste Mal 1816 veröffentlicht und fällt zeitlich somit genau in die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts, welche von Unruhen seitens der Bourgeoisie sowie politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen gekennzeichnet waren. Ziel dieser Arbeit ist es, die zuvor genannte Annahme zu begründen und somit eine weitere Interpretationsmöglichkeit dieses Werkes zu geben.
Im Vorfeld der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik wurden unter Berücksichtigung dieses speziellen Fokus vier Fragestellungen formuliert, welche innerhalb dieser Arbeit beantwortet werden sollen: (1) Wodurch unterscheiden sich das adelige und bürgerliche Frauenbild voneinander? (2) Wie und warum wird das damalige Idealbild der adeligen Frau kritisiert? (3) Wie und durch welche Figur äußert sich die Kritik am adeligen Frauenbild in Hoffmanns "Der Sandmann"? (4) Gibt es Unterschiede beziehungsweise Parallelen zwischen den beiden weiblichen Figuren Olimpia und Clara, welche als Vertreterinnen für das adelige und bürgerliche Frauenbild fungieren?
Die europäische Geschichte wurde über tausend Jahre lang maßgeblich vom Adel beeinflusst und bestimmt und stellte über diesen Zeitraum eine der mächtigsten sozialen Schichten dar. Während der Klerus die Spitze dieser Ständegesellschaft, gefolgt vom Adel bildete, belegten städtische Bürger und Bauern die Plätze der untersten sozialen Schicht. Solange Eliten in Regierung, Gesellschaft und Kirche geeint waren, hatte man in Gesellschaften, in denen die große Mehrheit der Bevölkerung aus traditionsgebundenen und kaum des Lesens und Schreibens mächtigen Menschen bestand, eine erfolgreiche Revolution von unten kaum zu befürchten. Mit dem Beginn der Aufklärung und der Französischen Revolution im Jahre 1789 änderte sich aber diese bis dato vorherrschende Hierarchie und so kam es, dass die Umwälzungen Europa nachhaltig veränderten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Hintergrund
- Darstellung des adeligen und bürgerlichen Frauenbildes
- Die adelige Frau
- Kritik am adeligen Frauenbild
- Die bürgerliche Frau
- E.T.A. Hoffmanns, Der Sandmann'
- Kritik am adeligen Frauenbild in Hoffmanns Werk
- Die Etikette am Hof
- Das Sich-bewegen-Können
- Die geistreiche Konversation
- Das Zur-Schau-Stellen des Äußeren
- Das Unterdrücken von Gefühlen und Emotionen
- Die höfische Frauenmode
- Die Untätigkeit adeliger Damen
- Die Unnatürlichkeit adeliger Frauen
- Vergleich zwischen der bürgerlichen und adeligen Frauenfigur in Hoffmanns, Der Sandmann'
- Kritik am adeligen Frauenbild in Hoffmanns Werk
- Fazit und Schlussworte
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem adeligen Frauenbild im 19. Jahrhundert und untersucht, wie dieses Idealbild in E.T.A. Hoffmanns Werk "Der Sandmann" kritisiert wird. Ziel ist es, die Annahme zu belegen, dass Hoffmanns Werk als eine Kritik am damaligen adeligen Frauenbild verstanden werden kann.
- Der Niedergang des Adels im 19. Jahrhundert
- Das Idealbild der adeligen Frau im 19. Jahrhundert
- Die Kritik am adeligen Frauenbild in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann"
- Der Vergleich zwischen dem adeligen und bürgerlichen Frauenbild in "Der Sandmann"
- Die Rolle von Frauen in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den historischen Hintergrund des Adels vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Kapitel 3 untersucht das adelige und bürgerliche Frauenbild der damaligen Zeit, insbesondere das Idealbild der adeligen Frau und die Kritik daran. Kapitel 4 analysiert die Kritik am adeligen Frauenbild in E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" und vergleicht die beiden weiblichen Figuren Olimpia und Clara, die als Vertreterinnen für das adelige und bürgerliche Frauenbild fungieren.
Schlüsselwörter
Adel, Frauenbild, Kritik, E.T.A. Hoffmann, "Der Sandmann", bürgerliche Frau, adelige Frau, Hofkultur, 19. Jahrhundert, Gesellschaftskritik, Idealbild
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit über E. T. A. Hoffmanns "Der Sandmann"?
Die Arbeit analysiert die Kritik am idealisierten adeligen Frauenbild des 19. Jahrhunderts, die Hoffmann in seinem Werk "Der Sandmann" durch verschiedene Frauenfiguren zum Ausdruck bringt.
Welche Frauenfiguren werden in der Analyse gegenübergestellt?
Im Fokus steht der Vergleich zwischen der bürgerlichen Clara und der künstlichen Olimpia, wobei letztere als Parodie auf das starre adelige Idealbild fungiert.
Welche Rolle spielt der historische Hintergrund des 19. Jahrhunderts?
Die Arbeit beleuchtet den Niedergang des Adels und den Aufstieg der Bourgeoisie sowie die damit einhergehenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen um das Jahr 1816.
Wie wird das adelige Frauenbild in Hoffmanns Werk kritisiert?
Die Kritik äußert sich durch die Darstellung von Hofetikette, dem Zwang zur geistreichen Konversation, der Unterdrückung von Emotionen und der Unnatürlichkeit adeliger Damen.
Was sind die zentralen Fragestellungen der Seminararbeit?
Die Arbeit untersucht Unterschiede zwischen adeligen und bürgerlichen Frauenbildern, die Gründe für die Kritik am Idealbild und wie sich diese Kritik konkret in den Figuren des Werkes äußert.
- Arbeit zitieren
- Josepha Stangassinger (Autor:in), 2017, Kritik des idealisierten adeligen Frauenbildes im 19. Jahrhundert in E. T. A. Hoffmanns "Der Sandmann", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502094