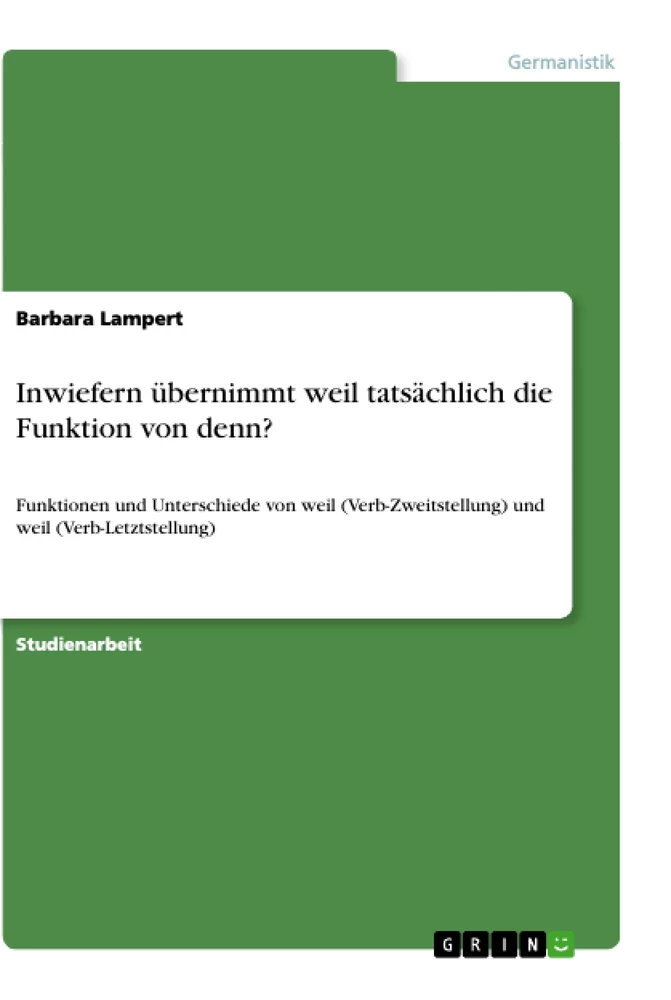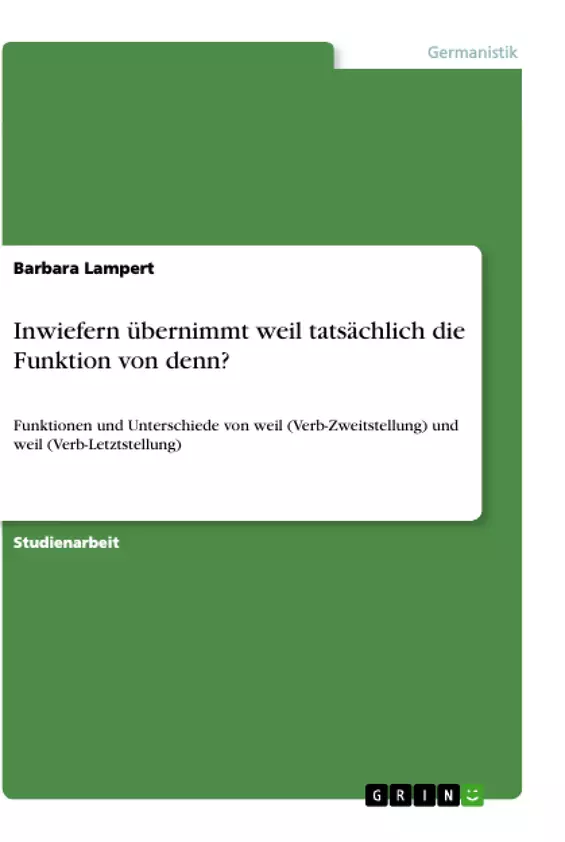In der gesprochenen Sprache wird zunehmend eine unübliche Konstruktion der Verbstellung in subordinierenden Kausalsätzen sichtbar. Weil ist eine Subjunktion, die untergeordnete Kausalsätze einleitet und in der Regel eine Verb-Letztstellung (fortan: VL) fordert. Wie kommt es nun dazu, dass sich in der gesprochenen Sprache immer häufiger eine Verb-Zweitstellung (fortan: V2) aufweisen lässt? „Er ist nach Hause gegangen, weil ich sehe sein Auto nicht mehr.“ (Keller 1993: 224) oder „Gib mir mal bitte das Buch, weil du stehst grad am Regal“ (Wegener 1999: 19). Beispiele dieser Art lassen sich auffallend häufig finden. Doch was bedeutet diese Zunahme von weil-VL zu weil-V2? Schwindet etwa die Nebensatzsyntax in kausalen Relationen? Der Sprachwissenschaftler Christoph Küper (1991: 134 aus Wegener 1999: 5) spricht hier von einer „dramatischen Umbruchstimmung“, die seiner Meinung nach offenbar schwerwiegende Folgen mit sich trage. Heide Wegener hingegen postuliert für eine andere These. Sie veranschaulicht in ihrer 2000 erschienenen Arbeit „Da, denn und weil – der Kampf der Konjunktionen. Zur Grammatikalisierung im kausalen Bereich“, drei Hypothesen, die momentan in den Sprachwissenschaften aufgeführt werden, um eine Erklärung für die zunehmende weil-V2 zu liefern.
1) Es handelt sich um einen lexikalischen Wandel: Einer semantischen Veränderung der Konjunktion weil.
2) Es handelt sich um einen syntaktischen Wandel: Einer Zunahme der Hauptsatzsyntax in Kausalsätzen.
3) Es handelt sich um einen lexikalischen Wandel: Einer geänderten Gebrauchsbedingung
von weil, das die Funktion von denn übernimmt.
Wegener (2000: 1) widerlegt sowohl These 1) als auch 2) und postuliert für die letzte These, dass weil zunehmend denn verdrängt und somit die Funktion dessen übernimmt.
In dieser Arbeit soll die Auslegung Wegeners kurz kritisch beleuchtet werden und untersucht werden, ob der Ursprung der zunehmenden weil-V2-Konstruktion tatsächlich in der Verdrängungen von denn besteht. Ebenso sollen Argumente für die 1) These geliefert werden, dass weil zwar ebenso einen lexikalischen Wandel erfährt, dieser sich aber auch im Bereich der Semantik widerspiegelt und weil-V2 tatsächlich neue Funktionen ausbildet, die sich gegenüber denen von weil-VL unterscheiden. Dafür werden Funktionsunterschiede von weil-VL und weil-V2 verdeutlicht. Daraufhin soll folgender Vorschlag deutlich gemacht werden: (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wegeners These: Die Funktionsübernahme von denn durch weil
- Diachrone Betrachtung von weil und denn
- Unterschiede zwischen weil-VL und weil-V2
- Syntax
- Informationsstruktur
- Prosodi
- Sprechakt
- Funktionen von weil-VL und weil-V2
- Faktische Leseart
- Epistemische Leseart
- Sprechaktbezogene Leseart
- Austauschbarkeit von weil-VL und weil-V2
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zunehmende Verwendung der Verb-Zweit-Stellung (V2) in weil-Sätzen im Deutschen, ein Phänomen, das im Widerspruch zur traditionellen Verb-Letzt-Stellung (VL) in Nebensätzen steht. Die Arbeit beleuchtet kritisch die These von Wegener, welche die weil-V2-Konstruktion als Funktionsübernahme von der Konjunktion „denn“ interpretiert. Die Hauptziele sind die Analyse der Unterschiede zwischen weil-VL und weil-V2 und die Erörterung alternativer Erklärungen für die beobachtete Entwicklung.
- Analyse der Unterschiede zwischen weil-VL und weil-V2-Konstruktionen.
- Kritische Auseinandersetzung mit Wegeners These zur Funktionsübernahme von „denn“ durch „weil“.
- Untersuchung diachroner Entwicklungen der Konjunktionen „weil“ und „denn“.
- Erörterung der Rolle von Semantik und Syntax im Sprachwandel.
- Exploration alternativer Erklärungen für die zunehmende Verwendung von weil-V2.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der zunehmenden weil-V2-Konstruktionen in der gesprochenen Sprache ein und stellt die zentralen Forschungsfragen vor. Sie präsentiert drei konkurrierende Hypothesen aus der Sprachwissenschaft zur Erklärung dieses Phänomens: lexikalischen Wandel von „weil“, syntaktischen Wandel hin zu Hauptsatzsyntax in Kausalsätzen und die Funktionsübernahme von „denn“ durch „weil“. Die Arbeit kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit Wegeners These an, die die letztgenannte Hypothese favorisiert, und skizziert den eigenen Forschungsansatz.
Wegeners These: Die Funktionsübernahme von denn durch weil: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert Wegeners These, wonach die Konjunktion „weil“ die Funktion von „denn“ übernimmt, wodurch die Zunahme von weil-V2 erklärt wird. Wegener argumentiert, dass „weil“ und „denn“ funktionsidentisch sind und dass die weil-V2-Konstruktion keine neuen Funktionen ausbildet. Das Kapitel beleuchtet die Argumentationslinie Wegeners und bereitet den Boden für die kritische Auseinandersetzung im weiteren Verlauf der Arbeit.
Diachrone Betrachtung von weil und denn: Dieses Kapitel untersucht die historischen Entwicklungen der Konjunktionen „weil“ und „denn“. Es wird gezeigt, dass „weil“ ursprünglich eine temporale Bedeutung hatte, die sich erst später zu einer kausalen Bedeutung entwickelte. Im Gegensatz dazu hatte „denn“ von Beginn an eine kausale Funktion. Die Analyse der diachronen Entwicklungen soll helfen, die aktuelle Verbreitung der weil-V2-Konstruktion zu verstehen und die Gültigkeit der Hypothesen zu überprüfen. Es wird auch die Rolle der sprachlichen Ökonomie im Sprachwandel betrachtet.
Unterschiede zwischen weil-VL und weil-V2: Hier werden die Unterschiede zwischen den weil-VL und weil-V2-Konstruktionen im Detail untersucht. Die Analyse umfasst syntaktische, informationsstrukturelle, prosodische und sprechakttheoretische Aspekte. Ziel ist es, aufzuzeigen, ob die weil-V2-Konstruktion tatsächlich neue Funktionen erfüllt, die von der weil-VL-Konstruktion nicht abgedeckt werden. Dies ist entscheidend für die Beurteilung von Wegeners These.
Schlüsselwörter
weil-V2, weil-VL, denn, Kausalsatz, Verbzweitstellung, Verbletztstellung, Sprachwandel, Grammatikalisierung, Semantik, Syntax, Diachronie, Funktionsübernahme, Wegener, Ökonomie, Sprechakt, Informationsstruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der weil-V2-Konstruktion im Deutschen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die zunehmende Verwendung der Verb-Zweit-Stellung (V2) in weil-Sätzen im Deutschen und analysiert kritisch die These von Wegener, welche die weil-V2-Konstruktion als Funktionsübernahme von der Konjunktion „denn“ interpretiert. Im Mittelpunkt steht der Vergleich von weil-VL (Verb-Letzt-Stellung) und weil-V2-Konstruktionen und die Erörterung alternativer Erklärungen für den beobachteten Sprachwandel.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Unterschiede zwischen weil-VL und weil-V2-Konstruktionen, setzt sich kritisch mit Wegeners These auseinander, untersucht die diachrone Entwicklung von „weil“ und „denn“, erörtert die Rolle von Semantik und Syntax im Sprachwandel und exploriert alternative Erklärungen für die zunehmende Verwendung von weil-V2.
Was ist Wegeners These?
Wegener postuliert, dass die Konjunktion „weil“ die Funktion von „denn“ übernimmt, was die Zunahme von weil-V2 erklärt. Er argumentiert, dass „weil“ und „denn“ funktionsidentisch sind und die weil-V2-Konstruktion keine neuen Funktionen ausbildet.
Wie wird Wegeners These in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit präsentiert und analysiert Wegeners These, bietet aber auch eine kritische Auseinandersetzung und untersucht alternative Erklärungen. Die diachrone Betrachtung der Konjunktionen „weil“ und „denn“ spielt dabei eine wichtige Rolle.
Welche Aspekte der weil-VL und weil-V2-Konstruktionen werden verglichen?
Der Vergleich umfasst syntaktische, informationsstrukturelle, prosodische und sprechakttheoretische Aspekte. Ziel ist es herauszufinden, ob weil-V2 tatsächlich neue Funktionen hat, die von weil-VL nicht abgedeckt werden.
Welche Rolle spielt die diachrone Betrachtung von "weil" und "denn"?
Die historische Entwicklung von „weil“ und „denn“ wird untersucht, um die aktuelle Verbreitung der weil-V2-Konstruktion besser zu verstehen und die Gültigkeit der verschiedenen Hypothesen zu überprüfen. Es wird auch die Rolle der sprachlichen Ökonomie im Sprachwandel betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: weil-V2, weil-VL, denn, Kausalsatz, Verbzweitstellung, Verbletztstellung, Sprachwandel, Grammatikalisierung, Semantik, Syntax, Diachronie, Funktionsübernahme, Wegener, Ökonomie, Sprechakt, Informationsstruktur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Wegeners These, ein Kapitel zur diachronen Betrachtung von "weil" und "denn", ein Kapitel zum Vergleich von weil-VL und weil-V2 und ein Fazit.
Welche alternativen Erklärungen für die weil-V2-Konstruktion werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert alternative Hypothesen, die den lexikalischen Wandel von „weil“, den syntaktischen Wandel hin zu Hauptsatzsyntax in Kausalsätzen und die Funktionsübernahme von „denn“ durch „weil“ betreffen. Diese werden kritisch geprüft und bewertet.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Sprachwissenschaftler, Germanisten und alle, die sich für Sprachwandel und die Syntax des Deutschen interessieren.
- Arbeit zitieren
- Barbara Lampert (Autor:in), 2013, Inwiefern übernimmt weil tatsächlich die Funktion von denn?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502101