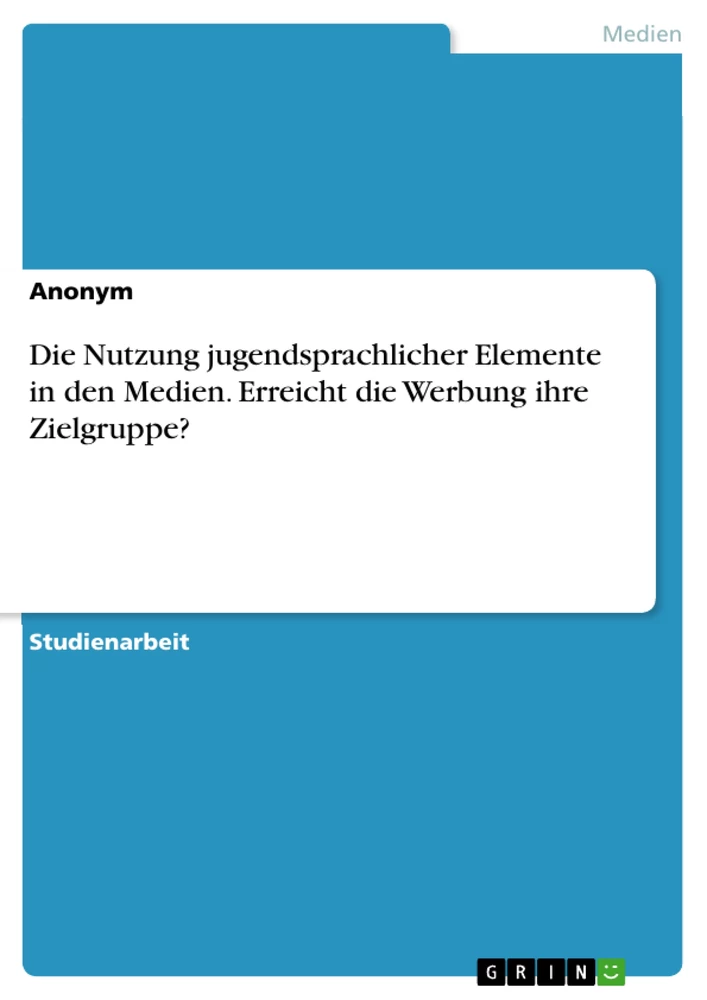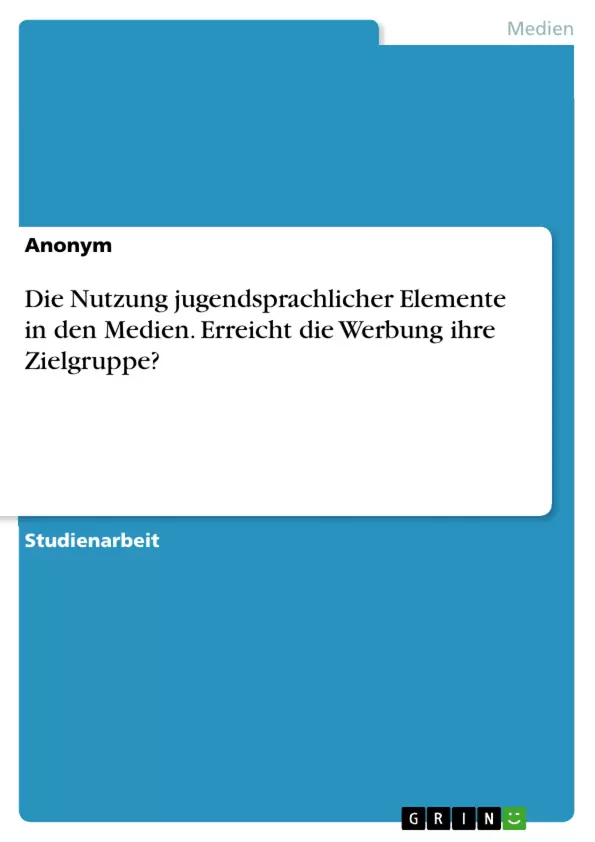Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die Sprache der Jugend, also die Jugendsprache, zu geben und darüber, wie sie in der Werbung genutzt wird. Hierfür wird anhand von drei Beispielkampagnen aufgezeigt, wie gut oder schlecht es gelingen kann, Jugendsprache zu nutzen, um die Zielgruppe, die diese Sprache spricht, zu erreichen. Zunächst wird ein Forschungsüberblick gegeben, in dem positive wie auch negative Beobachtungen und Betrachtungsweisen dargestellt und Einblicke in die Nutzung jugendsprachlicher Elemente in der Werbung angefügt werden. Anschließend gibt die Arbeit einen historischen Rückblick, der die Studentensprache behandelt. Hier werden kurz geschichtliche Kontexte betrachtet. Die Erläuterung, wie genau Jugendsprache in der Werbung genutzt wird, leitet zur Analyse der drei ausgewählten Werbekampagnen über. Hier werden die Art, diese Sprache zu verwenden, untersucht und pro Kampagne jeweils zusammengefasst.
Befasst man sich mit der Jugendsprache, liegt es nahe, sich nur mit den sprachlichen Veränderungen im Hier und Jetzt zu beschäftigen. Wichtig beim Thema rund um die Sprache der Jugend ist, dass diese sprachliche Erscheinung kein Phänomen der Neuzeit ist (das heißt des 20. beziehungsweise 21. Jahrhunderts). In diversen Ausprägungen lassen sich solche Formen gesprochener und geschriebener Sprache bereits in der früheren Sprachgeschichte erkennen. Auch damals wurden Analysen durchgeführt, die die genutzte Sprache untersuchten. In Deutschland wurden diese Untersuchungen vor allem an der Schüler- und Studentensprache vollzogen.
Ein Aspekt, den die Jugendsprachforschung damals wie auch heute immer behandelt hat und wahrscheinlich auch immer behandeln wird, ist der sogenannte "Sprachverfall", der durch die von der Jugend modifizierten Sprache angeblich stattfindet. In Bezug darauf schreibt Heinz Küpper in seinem Beitrag über die Sprache der Jugend, dass diese ein Jargon einer bestimmten Sondergruppe sei, der den größeren und wertvolleren Teil der Jugend erniedrigt und beleidigt. Diese negative Ansicht der Jugendsprache wird noch etwas mehr verdeutlicht, schaut man sich Küppers "Wörterbuch der deutschen Umgangssprache" genauer an. Das Wort Jargon, welches er für die Beschreibung der Jugendsprache genutzt hat, definiert er in seinem Wörterbuch als "halbwüchsigensprachlich". Jahrelang wurde die Forschung nach dieser negativen Ansicht betrieben, was im Endeffekt zu einer weiterhin negativen Grundeinstellung gegenüber der Jugendsprache führte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 2.1 Sprachforschung und Entwicklung der Jugendsprache
- 2.1.1 Schlussbetrachtung
- 2.1.2 Exkurs: Studentensprache
- 2.2 Aktueller Forschungsstand
- 2.3 Jugendsprache in den Medien
- 2.4 Die Jugendsprache in der Werbung
- 2.1 Sprachforschung und Entwicklung der Jugendsprache
- III. Schlussteil
- IV. Literaturverzeichnis
- V. Internetquellen
- VI. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Jugendsprache und ihrer Verwendung in der Werbung. Ziel ist es, einen Überblick über die Sprache der Jugend zu geben und anhand von Beispielkampagnen zu analysieren, wie effektiv Jugendsprache zur Ansprache der Zielgruppe eingesetzt werden kann.
- Entwicklung und Forschung der Jugendsprache
- Aktueller Forschungsstand und Methoden der Jugendsprachforschung
- Verwendung der Jugendsprache in den Medien
- Analyse von Werbekampagnen, die Jugendsprache nutzen
- Bewertung der Effektivität des Einsatzes von Jugendsprache in der Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Zielsetzung. Im Hauptteil wird zunächst die Sprachforschung und Entwicklung der Jugendsprache beleuchtet. Es werden verschiedene Linguisten und Forscher vorgestellt, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sowie positive und negative Beobachtungen und Betrachtungsweisen dargestellt. Des Weiteren wird ein kurzer Einblick in die Werbung und die dort genutzte Jugendsprache gegeben.
Anschließend erfolgt ein historischer Rückblick auf die Studentensprache, bevor sich der nächste Abschnitt mit dem aktuellen Forschungsstand beschäftigt. Methoden zur Untersuchung des Forschungsfeldes werden genannt und kritisch betrachtet. Im weiteren Verlauf wird die Jugendsprache in den Medien behandelt, wobei Forschungsbeiträge zu Sprache Jugendlicher in Zeitschriften, Anzeigen und Werbung erläutert werden.
Der praktische Teil der Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von drei Werbekampagnen, die auf ihre Art und Weise der Verwendung von Jugendsprache analysiert werden. Abschließend werden zu jeder Kampagne Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachforschung, Medien, Werbung, Werbekampagnen, Studentensprache, Sprachverfall, Jargon, Sprachstile, Sprachregister, Zielgruppe, Effektivität.
Häufig gestellte Fragen
Ist Jugendsprache ein Phänomen der Neuzeit?
Nein, sprachliche Veränderungen durch die Jugend gab es schon früher, beispielsweise in Form der Schüler- und Studentensprache vergangener Jahrhunderte.
Führt Jugendsprache zu einem "Sprachverfall"?
Die Forschung diskutiert diesen Begriff oft kritisch. Während einige einen Verfall sehen, betrachten Linguisten Jugendsprache eher als kreative Modifikation und spezifischen Jargon einer Sondergruppe.
Wie nutzt die Werbung jugendsprachliche Elemente?
Werbung verwendet Slang, spezifische Begriffe und Stilelemente der Jugend, um Authentizität zu suggerieren und die Zielgruppe auf Augenhöhe anzusprechen.
Warum scheitern manche Werbekampagnen mit Jugendsprache?
Kampagnen scheitern oft, wenn die Sprache aufgesetzt oder veraltet wirkt ("Cringe"), was von der Zielgruppe als peinlich und unauthentisch wahrgenommen wird.
Was wurde in der historischen Studentensprache untersucht?
Untersuchungen konzentrierten sich auf die geschichtlichen Kontexte und die Abgrenzung der studentischen Sprache von der bürgerlichen Umgangssprache.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Die Nutzung jugendsprachlicher Elemente in den Medien. Erreicht die Werbung ihre Zielgruppe?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502234