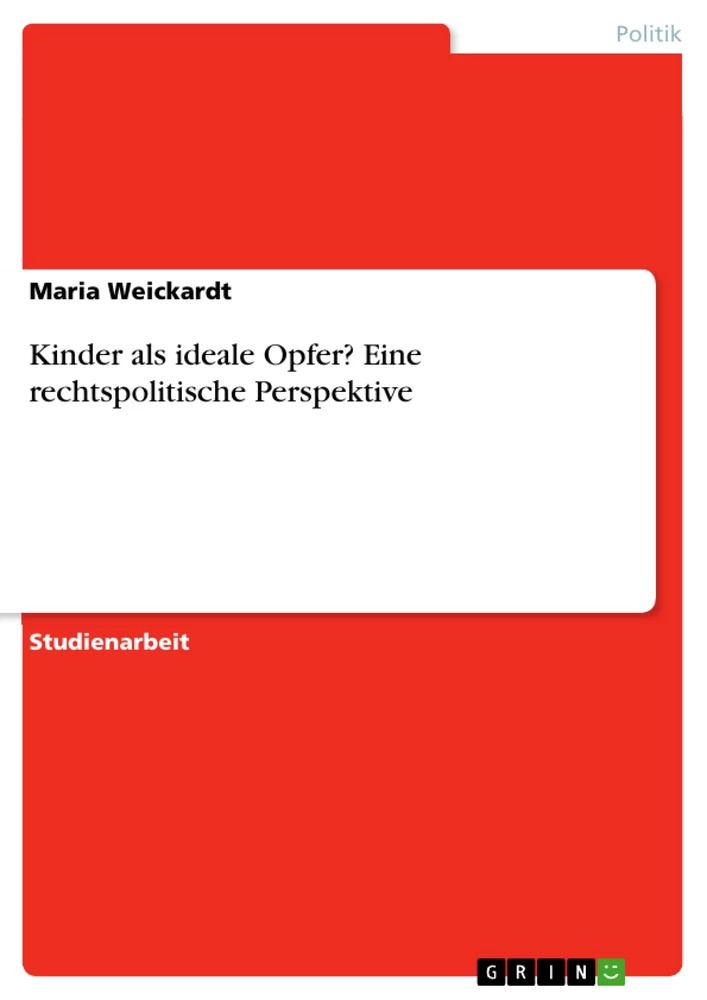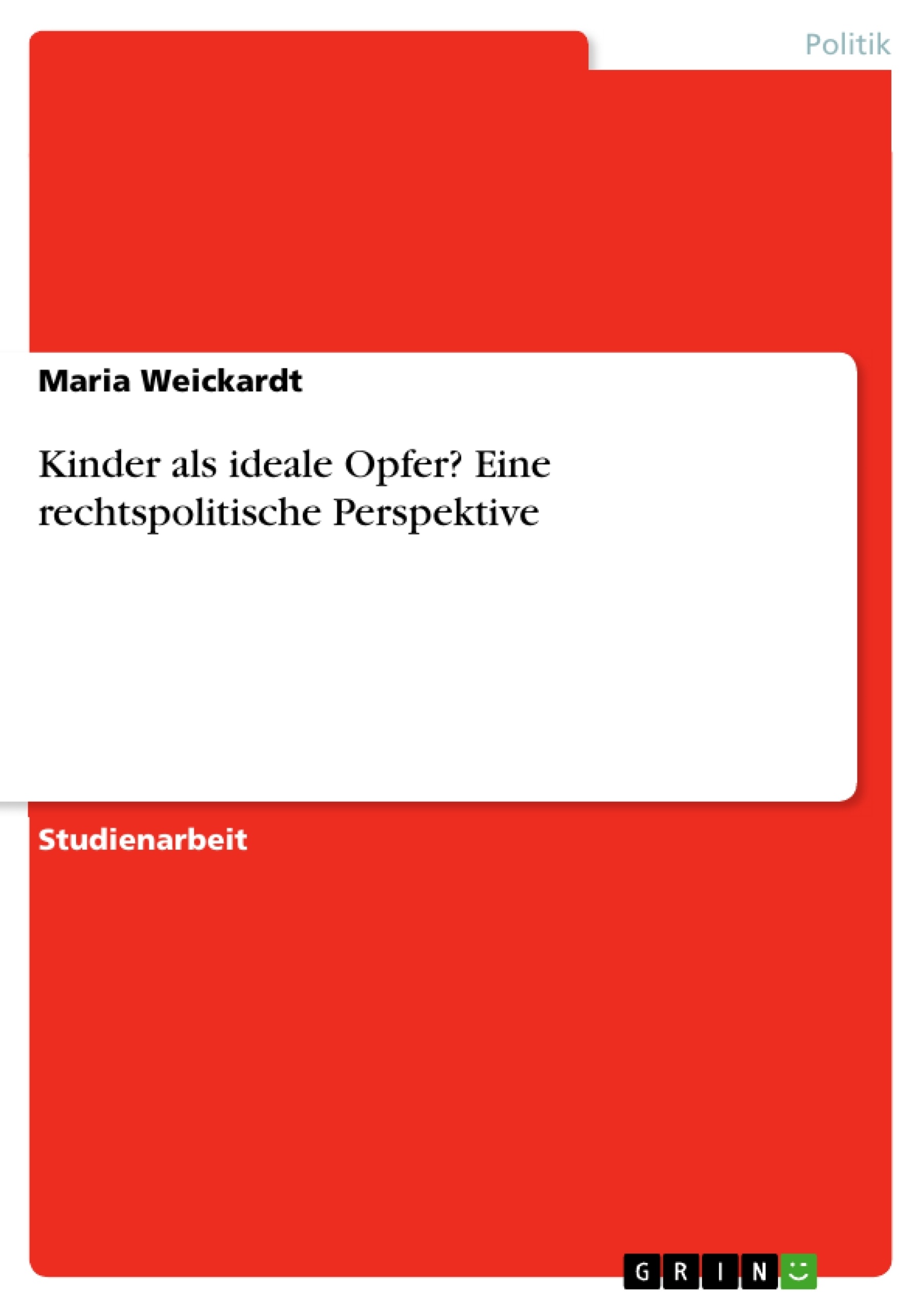“I’m a victim because I have two children [born of rape] and I’m finding difficult to take care of them … but I’m a survivor because I’m able to withstand all the challenges.” (Denov 2012)
Wie die Aussage dieser Kindersoldatin aus Sierra Leone verdeutlicht, ist die Selbstperzeption von Kindern komplex und kann zugleich differente soziologische Konzepte, jene des Opfers, der Resilienz und des Agents, widerspiegeln. Im öffentlichen Diskurs wird Kindsein allerdings noch immer primär mit Schutzbedürftigkeit und elterlicher Abhängigkeit assoziiert. Diese paternalistische Sichtweise resultiert nicht nur in einer gesteigerten diskursiven Viktimisierung von Kindern, sondern zugleich auch in einer zunehmenden Sensibilisierung für viktimisierende Handlungen gegenüber Kindern.
Gerade die Verabschiedung der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (CRC) im November 1989, die bislang von 196 Staaten ratifiziert wurde, brachte diesbezüglich einige Reformen. Der Gruppe der Kinder, die über Jahrhunderte hinweg rechtlich und gesellschaftlich objektifiziert wurden, wurde erstmalig eine universelle Position als „subjects entitled to rights“ (Stark 2017: XIV) im internationalen Rechtsdiskurs eingeräumt. Ihr Schutz vor viktimisierenden Handlungen wurde entsprechend zu einem zentralen politischen Ziel deklariert, dessen Prämissen unter anderem die Verfolgung von weltweiten Kinderrechtsverletzungen und das kindliche Empowerment sein sollten. Die Viktimisierung von Kindern hält allerdings bis heute vielfach an.
Laut der Studie Poly-Victimization in a National Sample of Children and Youth von Finkelhor et al. (2010), die sich explizit auf die USA bezieht, wurden rund 60 Prozent der zwei- bis siebzehnjährigen Befragten mindestens einmal während ihres Lebens zu Opfern. Circa 30 Prozent waren sogar einer Multiviktimisierung – vier bis fünf viktimisierenden Handlungen – und zehn Prozent einer Polyviktimisierung – mehr als elf viktimisierenden Handlungen – ausgesetzt. Ähnliche Ergebnisse zeigt auch der Violence Study Report der UNICEF.
In Anbetracht dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, wie Kinder überhaupt zu Opfern werden. Worauf basieren kindliche Viktimisierungsprozesse im internationalen Rechtsdiskurs, insbesondere bei der CRC? Werden Kinder schlichtweg als ideale Opfer geboren oder werden sie durch Gesetzestexte passiv zu Opfern erklärt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktueller Forschungsstand und weiterer Problemaufriss
- Aufbau der Arbeit und Forschungsfragen
- Rechtliche und philosophische Konzepte zur Kindheit
- Die patria potestas in der Antike
- Das immanente Kind nach John Locke
- Das unschuldige Kind nach Jean-Jacques Rousseau
- Die neue Kindheit
- Viktimisierungsdiskurse
- Der Opferbegriff nach Svenja Goltermann
- Historische Entwicklungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Die Figur des Opfers nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die UN-Kinderrechtskonvention und der Status des Kindes
- Partizipations- versus Schutzrechte: ausgewählte Beispiele
- Fakultativprotokolle
- Beispiele für kindliche Viktimisierung im internationalen Recht
- Kinderhandel
- Kindersoldat*innen
- Kinderarbeit
- Fazit - Opfer oder Agent?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Viktimisierung von Kindern aus rechtspolitischer Perspektive. Sie zeichnet die historische Entwicklung des Kindheitsverständnisses nach und beleuchtet die Rolle der UN-Kinderrechtskonvention in diesem Kontext. Die Arbeit untersucht, wie kindliche Viktimisierung in verschiedenen internationalen Rechtsfeldern, insbesondere im Kontext von Kinderhandel, Kindersoldaten und Kinderarbeit, manifest wird.
- Evolution des Kindheitskonzepts
- Entwicklung des Opferbegriffs
- UN-Kinderrechtskonvention und ihr Einfluss auf das Kindheitsverständnis
- Beispiele für kindliche Viktimisierung in verschiedenen Rechtsbereichen
- Die Rolle des Kindes als Opfer und als Agent im internationalen Rechtsdiskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Forschungsstand zur kindlichen Viktimisierung beleuchtet und den Aufbau der Arbeit sowie die zentralen Forschungsfragen erläutert. Kapitel zwei zeichnet die historische Entwicklung des Kindheitskonzepts nach, beginnend mit der patria potestas in der Antike bis hin zur „neuen Kindheit“ im ausgehenden 20. Jahrhundert. Kapitel drei analysiert den Opferbegriff anhand des Buches „Opfer“ von Svenja Goltermann und setzt ihn in einen historischen Kontext. Außerdem werden die zentralen Inhalte der UN-Kinderrechtskonvention und der Status des Kindes im internationalen Recht erläutert. Kapitel vier analysiert anhand historischer Dokumente und Literatur drei konkrete Beispiele für kindliche Viktimisierung im internationalen Recht: Kinderhandel, Kindersoldaten und Kinderarbeit. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die zentralen Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gibt.
Schlüsselwörter
Kindheit, Viktimisierung, UN-Kinderrechtskonvention, internationales Recht, Kinderhandel, Kindersoldaten, Kinderarbeit, Opferbegriff, historisch-analytische Perspektive, Postmoderne, Machthierarchie, Empowerment.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die UN-Kinderrechtskonvention (CRC) für den Status von Kindern?
Die 1989 verabschiedete Konvention räumte Kindern erstmals eine universelle Position als Träger von Rechten ein, anstatt sie nur als Objekte elterlicher Sorge zu betrachten.
Was wird unter dem Begriff "ideale Opfer" verstanden?
Die Arbeit hinterfragt, ob Kinder aufgrund ihrer biologischen Schutzbedürftigkeit Opfer sind oder ob sie durch gesellschaftliche Diskurse und Gesetzestexte passiv dazu erklärt werden.
Welche historischen Kindheitskonzepte werden untersucht?
Die Analyse reicht von der antiken *patria potestas* über John Lockes immanentes Kind bis hin zu Jean-Jacques Rousseaus Konzept des unschuldigen Kindes.
Was ist der Unterschied zwischen Kindern als "Opfer" und als "Agent"?
Während "Opfer" Passivität und Hilflosigkeit impliziert, beschreibt "Agent" die Fähigkeit des Kindes, trotz Herausforderungen aktiv zu handeln und Resilienz zu zeigen.
In welchen Bereichen findet kindliche Viktimisierung heute statt?
Die Arbeit nennt konkrete Beispiele wie Kinderhandel, den Einsatz von Kindersoldaten und ausbeuterische Kinderarbeit im internationalen Kontext.
- Arbeit zitieren
- Maria Weickardt (Autor:in), 2019, Kinder als ideale Opfer? Eine rechtspolitische Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502340