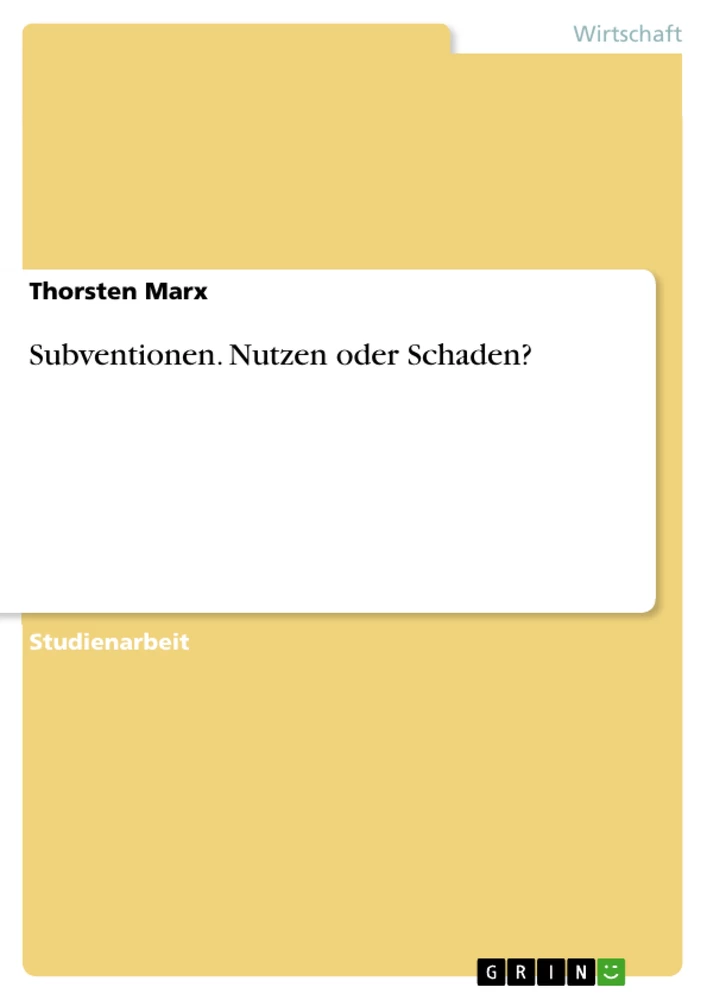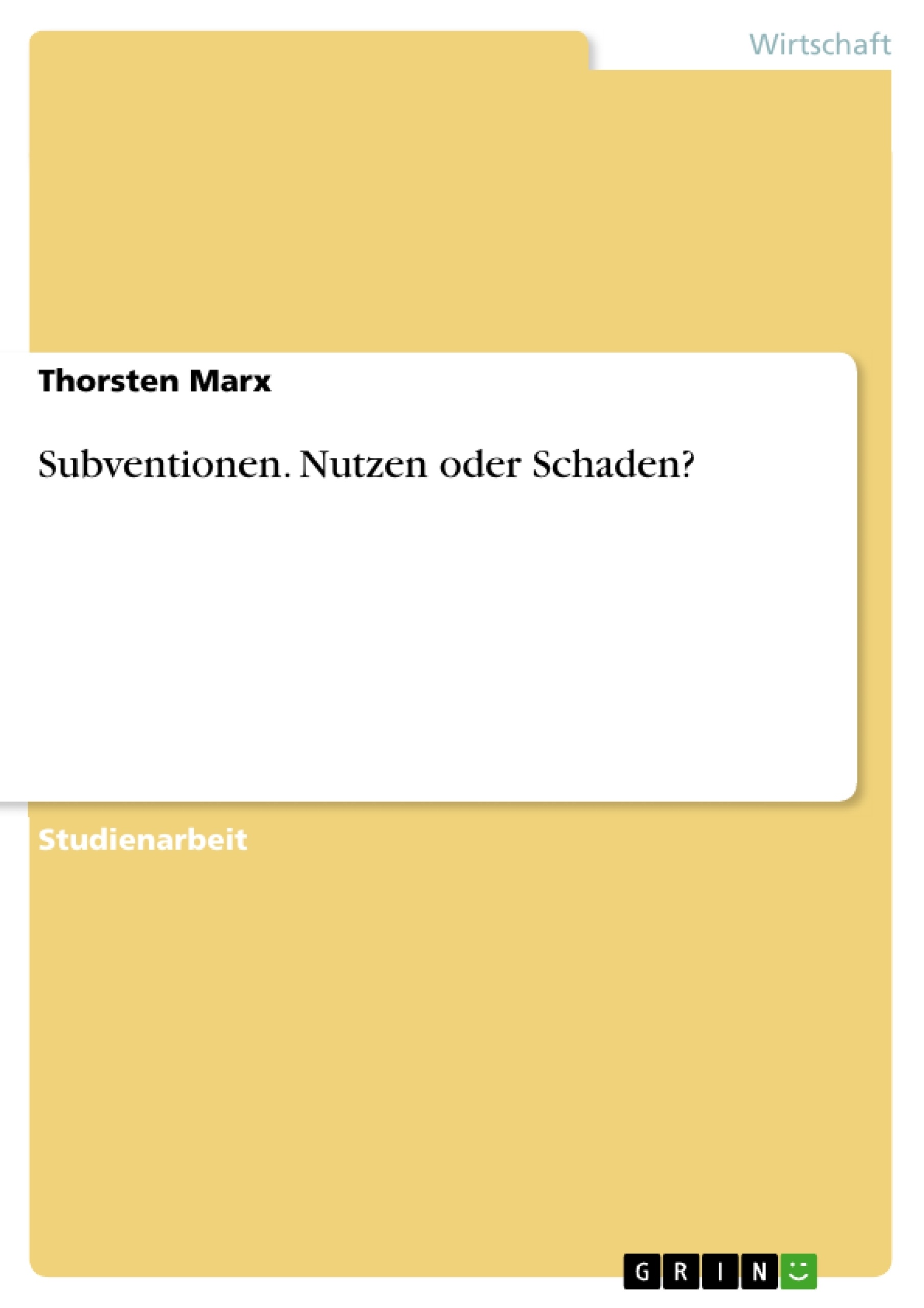Subventionen führen oft zu Auswirkungen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind und richten in Folge dessen oft große Schäden an. Sie sind aber auch nötig, um die Schwächen der Marktwirtschaft zu bekämpfen. In dieser Arbeit wird zunächst die Wirkung von Subventionen theoretisch erklärt und aus der Sichtweise der Neoklassik und des Keynesianismus betrachtet. Anschließend werden Subventionen in Abhängigkeit ihrer Beweggründe und Zielvorgaben in Erhaltung-, Anpassungs- und Lenkungssubventionen unterschieden. An Hand der Agrarsubventionen der EU werden verschiedene praktische Auswirkungen aufgezeigt und abschließend die Vor– und Nachteile gegenübergestellt, mit dem Ergebnis, dass der Nutzen Subventionen notwendig macht, auch wenn die Schäden nicht komplett verhindert werden können.
Die Rolle des Staates in der Wirtschaft ist eine Frage, die seit dem Aufkommen der Wirtschaftswissenschaften leidenschaftlich debattiert wird. Manche halten es mit Adam Smith und sehen jeden staatlichen Eingriff in die Marktwirtschaft als Bedrohung für das Gleichgewicht an, das sich aus den Kräften von Angebot und Nachfrage ergibt. Andere, wie John Maynard Keynes, weisen auf die Fehler des Marktes hin und sehen staatliche Eingriffe als notwendig an, um die Wohlfahrt der Menschen zu sichern und auszubauen.
Die Bundesrepublik Deutschland, mit ihrem Modell der sozialen Marktwirtschaft, greift in verschiedensten Weisen in den Markt ein, wobei die Subventionsvergabe eine beliebte Möglichkeit darstellt. Im Jahr 2018 hat die Bundesregierung Deutschland Subventionen im Wert von 25,2 Milliarden Euro vergeben. Doch auch wenn das Thema Subventionen in der deutschen Medienlandschaft immer wieder präsent ist, sind die weitreichenden volkwirtschaftlichen Auswirkungen wohl nur einem kleinen Teil der Bevölkerung bekannt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition
3. Wirkung von Subventionen
3.1. Das Marktgleichgewicht
3.2. Wirkung auf das Marktgleichgewicht und den Wettbewerb
3.3. Wirkung auf dem Weltmarkt
4. Subventionen in der makroökonomischen Theorie
4.1. Neoklassik
4.2. Keynesianismus
5. Beweggründe für die Subventionsvergabe
5.1. Lenkungssubventionen
5.2. Anpassungssubventionen
5.3. Erhaltungssubventionen
6. Agrarsubventionen der EU
6.1. Ökonomische Auswirkungen
6.2. Soziale Auswirkungen
6.3. Ökologische Auswirkungen
7. Diskussion
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Sind Subventionen grundsätzlich nützlich oder schädlich?
Subventionen sind ein zweischneidiges Schwert: Sie können Marktschwächen bekämpfen und sozialen Ausgleich schaffen, führen aber oft zu unvorhergesehenen volkswirtschaftlichen Schäden und Wettbewerbsverzerrungen.
Welche Arten von Subventionen werden unterschieden?
Es wird zwischen Erhaltungs-, Anpassungs- und Lenkungssubventionen differenziert, abhängig von ihren jeweiligen Beweggründen und Zielvorgaben.
Wie bewertet der Keynesianismus staatliche Subventionen?
Vertreter des Keynesianismus sehen staatliche Eingriffe und Subventionen als notwendig an, um Marktfehler zu korrigieren und die allgemeine Wohlfahrt zu sichern.
Welche Rolle spielen EU-Agrarsubventionen in der Analyse?
Anhand der EU-Agrarsubventionen werden praktische ökonomische, soziale und ökologische Auswirkungen aufgezeigt, um die theoretischen Modelle zu prüfen.
Was ist die neoklassische Sicht auf Subventionen?
Die Neoklassik betrachtet staatliche Eingriffe wie Subventionen eher kritisch, da sie das natürliche Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage bedrohen können.
- Quote paper
- Thorsten Marx (Author), 2019, Subventionen. Nutzen oder Schaden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502612