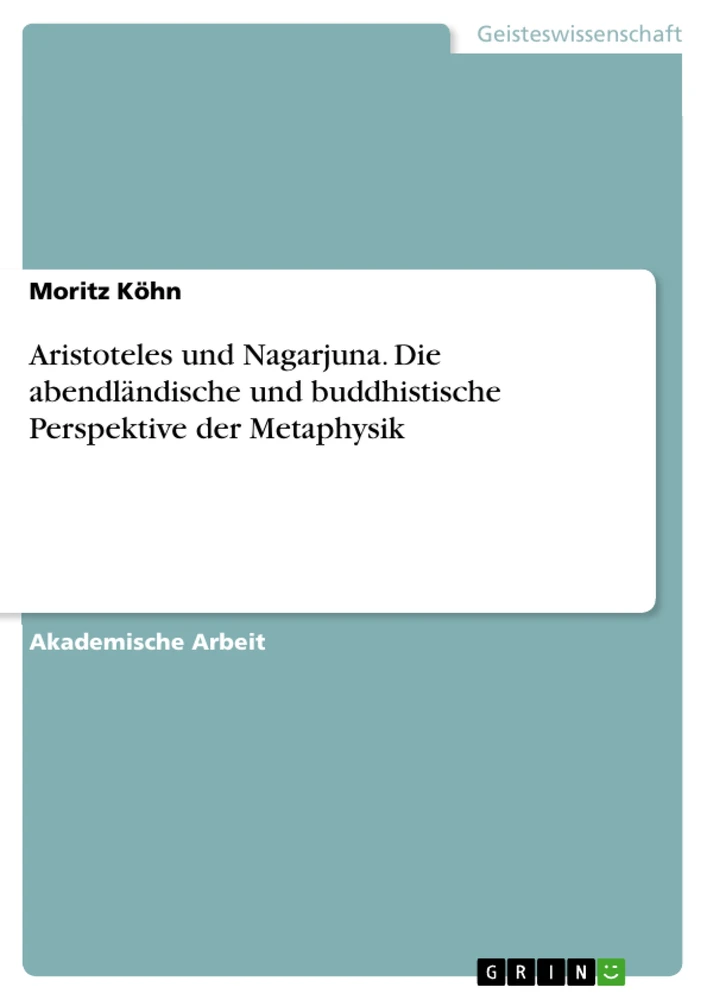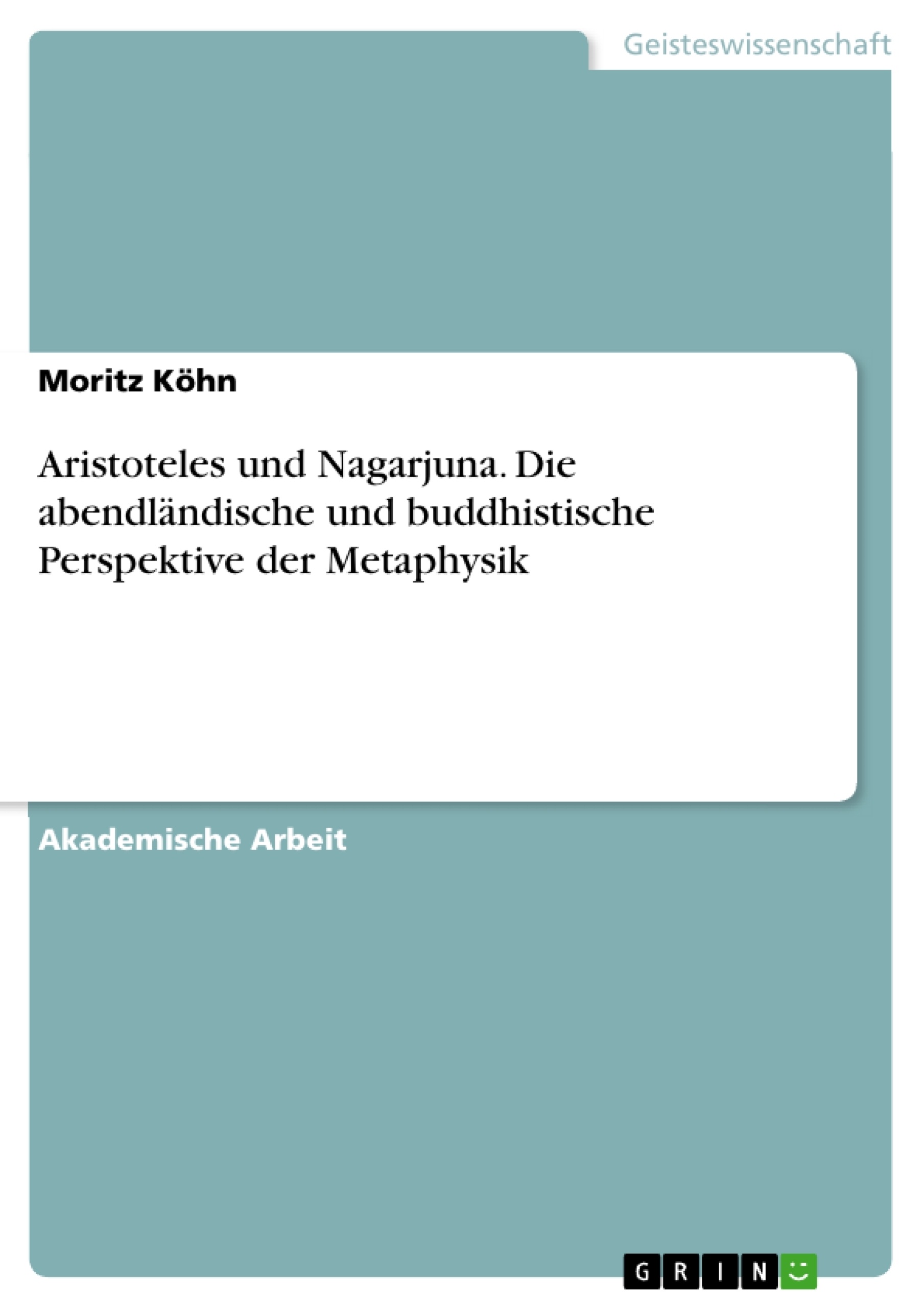Aristoteles "Analyse des Seienden als Seiendes" wird in dieser Arbeit der "Untersuchung des Seienden" durch Nagarjuna gegenübergestellt. Dabei steht folgende erkenntnisleitende Fragestellung im Mittelpunkt: Wie haben die beiden Philosophen den Begriff der Ursache definiert und welches Verständnis über die Wahrheit und das Seiende entwickelt?
Ein solcher Vergleich der beiden Philosophen ist mir in der Sekundärliteratur bislang unbekannt. Daher unternehme ich mittels ausgewählter Sekundärliteratur den Versuch, Aristoteles und Nagarjuna Sichtweisen hinsichtlich dieser Frage eigenständig zu interpretieren. Das geschieht vor dem Hintergrund, dass Aristoteles (384 – 322 v. Chr) als Begründer bis heute geltender Prämissen der westlichen Wissenschaft gilt; teilweise wird er gar als Philosoph der Naturwissenschaften bezeichnet.
Nagarjuna (lebte im 2. Jahrhundert n.Chr.) wiederum ist einer der angesehensten buddhistischen Gelehrten und hat wohl als erster indischer Gelehrter Buddhas Philosophie des "Leersein aller Phänomene von Eigenexistenz", die als "Mittlerer Weg" bezeichnet wird, umfassend systematisiert. Hieraus entstand die sogenannte "Konsequenzschule des Mahayana" (skr.: Prasangika-Madyamika), der beispielsweise der Dalai-Lama angehört. Nagarjuna hat wie schon Buddha Shakyamuni zuvor gegen die Denkschulen der Extreme argumentierte: des Eternalismus (dt.: Ewigkeitslehre) einerseits und des Nihilismus (dt.: Lehre der völligen Verneinung aller Normen und Werte) andererseits.
Aristoteles ist Begründer einer bis heute im Westen dominierenden Logik - wird von ihm Analytik genannt - die auf seinen Sätzen des Widerspruchs und des ausgeschlossenen Dritten basiert. In der antiken indischen Philosophie wurde hingegen neben anderen eine Form der Logik etabliert, die das Werkzeug des Tetralemmas nutzt, das in der abendländischen Philosophie weitgehend unbekannt ist.
Diese zwei sehr verschiedenen Denkwerkszeuge der beiden hier behandelten Philosophen, die durchaus als repräsentativ für "westliches und buddhistisches Denken" angesehen werden können, implizieren die unterschiedlichen Sichtweisen der durch sie repräsentierten "Denkschulen über Wahrheit und Wirklichkeit". Sie nähern sich auf unterschiedlichen Wegen Erklärungsversuchen über die Wirklichkeit, die in der hier vorliegenden Arbeit als die "Gesamtheit aller Erscheinungen" verstanden wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Aristoteles
- 2.1 Der Weg zur Wahrheit
- 2.2 Die vier Ursachen und die damit verbundenen Ansichten
- 2.3 Das Handwerkszeug der Wahrheit
- 2.4 Die göttliche Ursache und Wahrheit
- 2.5 Die Notwendigkeit eines ersten Bewegers
- 3. Nagarjuna
- 3.1 Intention
- 3.2 Das Tetralemma
- 3.3 Die zwei Wahrheiten
- 3.4 Verständnis von Ursachen
- 4. Fazit
- 4.1 Der direkte Vergleich der beiden Philosophen
- 4.2 Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die metaphysischen Ansichten von Aristoteles und Nagarjuna, wobei der Fokus auf deren Definition von Ursache und Verständnis von Wahrheit und Sein liegt. Der Vergleich zielt darauf ab, die unterschiedlichen Denkweisen des westlichen und buddhistischen Philosophierens aufzuzeigen und eigenständige Interpretationen der jeweiligen Sichtweisen zu liefern. Die Arbeit untersucht, wie diese unterschiedlichen Ansätze zu Erklärungsversuchen der Wirklichkeit führen.
- Vergleich der Definition von Ursache bei Aristoteles und Nagarjuna
- Untersuchung des Wahrheitsverständnisses beider Philosophen
- Analyse der unterschiedlichen logischen Werkzeuge (Aristoteles' Logik vs. Nagarjunas Tetralemma)
- Gegenüberstellung der Konzepte von Sein und Wirklichkeit
- Die Rolle der ersten Ursache im Denken beider Philosophen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Diese Einführung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie definieren Aristoteles und Nagarjuna den Begriff der Ursache, und welches Verständnis von Wahrheit und Sein entwickeln sie? Sie begründet die Relevanz des Vergleichs und skizziert die Vorgehensweise, wobei hervorgehoben wird, dass Aristoteles als Begründer westlicher Wissenschaft und Nagarjuna als bedeutender buddhistischer Gelehrter mit unterschiedlichen logischen Werkzeugen und Denkansätzen repräsentativ für westliches und buddhistisches Denken stehen. Die Arbeit betont den Unterschied zwischen Aristoteles' Logik und Nagarjunas Tetralemma und wie diese unterschiedlichen Denkwerkzeuge zu verschiedenen Erklärungsversuchen der Wirklichkeit führen.
2. Aristoteles: Dieses Kapitel untersucht Aristoteles' Philosophie, beginnend mit seinem Verständnis des Weges zur Wahrheit. Es analysiert seine vier Ursachen – die materielle, die formale, die bewegte und die finale Ursache – und wie diese seinen Wahrheitsbegriff prägen. Der Fokus liegt auf Aristoteles' Streben nach einer ersten Ursache und seiner Ablehnung einer relativen Weltsicht, die durch die Anwendung seiner Logik und die Notwendigkeit eines ersten Bewegers untermauert wird. Die Kapitel erläutert, wie Aristoteles durch Beobachtung, Logik und deren Reflexion zu einer (nur) vorstellbaren göttlichen Vernunft gelangt.
3. Nagarjuna: Dieses Kapitel widmet sich Nagarjunas Philosophie, insbesondere seinem Konzept des "Leerseins aller Phänomene von Eigenexistenz". Es erläutert Nagarjunas Verständnis von Ursachen, das sich deutlich von dem Aristoteles' unterscheidet und ein neues Wahrheitsverständnis erfordert. Das Kapitel analysiert das Tetralemma als ein zentrales Denkwerkzeug in Nagarjunas Philosophie und untersucht, wie es sich von der aristotelischen Logik unterscheidet und zu einem anderen Verständnis von Wahrheit und Wirklichkeit führt. Die Ausführungen fokussieren auf das erste Kapitel in Nagarjunas wegweisender Schrift "Grundlegende Verse zum Mittleren Weg".
Schlüsselwörter
Aristoteles, Nagarjuna, Metaphysik, Ursache, Wahrheit, Sein, Logik, Tetralemma, westliches Denken, buddhistisches Denken, erste Ursache, Mittlerer Weg, Leersein, Wahrheitsverständnis, Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Vergleich der metaphysischen Ansichten von Aristoteles und Nagarjuna
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die metaphysischen Ansichten von Aristoteles und Nagarjuna, insbesondere ihre Definitionen von Ursache und ihr Verständnis von Wahrheit und Sein. Sie untersucht die Unterschiede im westlichen und buddhistischen Philosophieren und liefert eigenständige Interpretationen der jeweiligen Sichtweisen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der logischen Werkzeuge (Aristotelische Logik vs. Nagarjunas Tetralemma) und wie diese zu unterschiedlichen Erklärungsversuchen der Wirklichkeit führen.
Welche Philosophen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Philosophien von Aristoteles, einem Begründer der westlichen Wissenschaft, und Nagarjuna, einem bedeutenden buddhistischen Gelehrten. Der Vergleich dient dazu, die Unterschiede zwischen westlichem und buddhistischem Denken aufzuzeigen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Vergleich der Definition von Ursache bei Aristoteles und Nagarjuna; die Untersuchung des Wahrheitsverständnisses beider Philosophen; die Analyse der unterschiedlichen logischen Werkzeuge (Aristoteles' Logik vs. Nagarjunas Tetralemma); die Gegenüberstellung der Konzepte von Sein und Wirklichkeit; und die Rolle der ersten Ursache im Denken beider Philosophen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einführung, Kapitel zu Aristoteles und Nagarjuna, und ein Fazit. Das Kapitel zu Aristoteles untersucht seinen Weg zur Wahrheit, seine vier Ursachen, seine Suche nach einer ersten Ursache und seine Ablehnung einer relativen Weltsicht. Das Kapitel zu Nagarjuna konzentriert sich auf sein Konzept des "Leerseins", das Tetralemma als Denkwerkzeug und sein Verständnis von Ursachen und Wahrheit. Das Fazit vergleicht beide Philosophen direkt und bietet ein persönliches Fazit.
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen Aristoteles und Nagarjuna?
Ein zentraler Unterschied liegt in den logischen Werkzeugen: Aristoteles verwendet die klassische Logik, während Nagarjuna das Tetralemma verwendet. Dies führt zu unterschiedlichen Wahrheitsverständnissen und Erklärungsansätzen für die Wirklichkeit. Aristoteles sucht nach einer ersten Ursache und einer festen, erkennbaren Realität, während Nagarjunas Denken von der Leere und der Abhängigkeit aller Phänomene geprägt ist.
Welche Rolle spielt das Tetralemma in Nagarjunas Philosophie?
Das Tetralemma ist ein zentrales Denkwerkzeug in Nagarjunas Philosophie. Es unterscheidet sich grundlegend von der aristotelischen Logik und führt zu einem anderen Verständnis von Wahrheit und Wirklichkeit. Es erlaubt die Analyse von Aussagen durch die Berücksichtigung aller vier Möglichkeiten: Behauptung, Verneinung, beides und keines von beidem.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit beinhaltet einen direkten Vergleich der beiden Philosophen und ein persönliches Fazit des Autors. Es fasst die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihren metaphysischen Ansichten zusammen und reflektiert die Bedeutung des Vergleichs für das Verständnis von westlichem und buddhistischem Denken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Aristoteles, Nagarjuna, Metaphysik, Ursache, Wahrheit, Sein, Logik, Tetralemma, westliches Denken, buddhistisches Denken, erste Ursache, Mittlerer Weg, Leersein, Wahrheitsverständnis, Wirklichkeit.
- Citation du texte
- Moritz Köhn (Auteur), 2018, Aristoteles und Nagarjuna. Die abendländische und buddhistische Perspektive der Metaphysik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502889