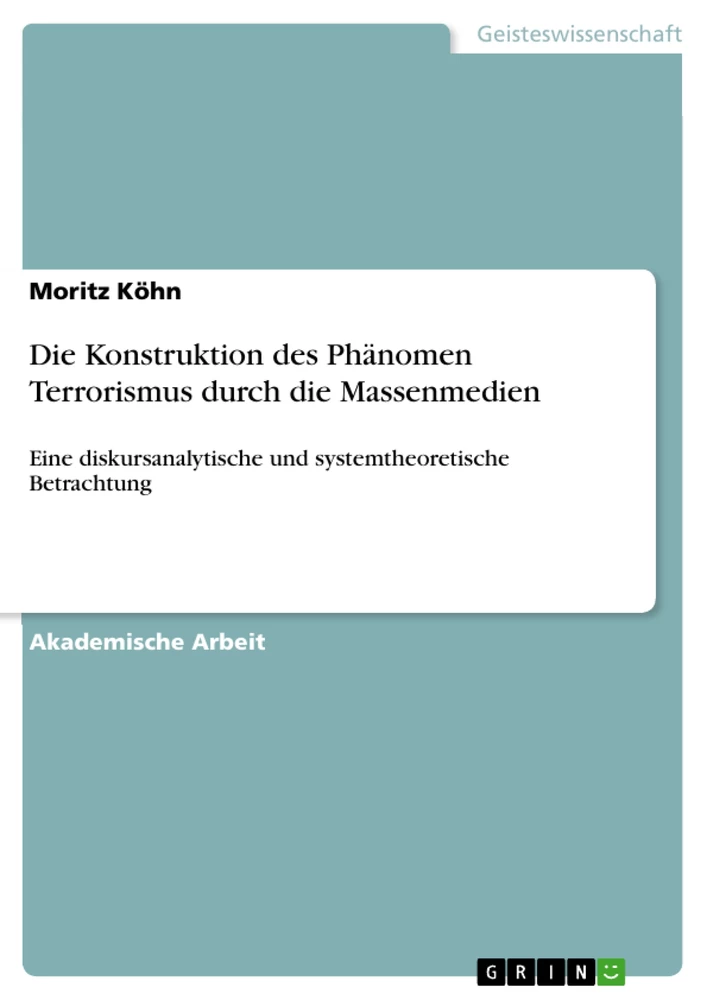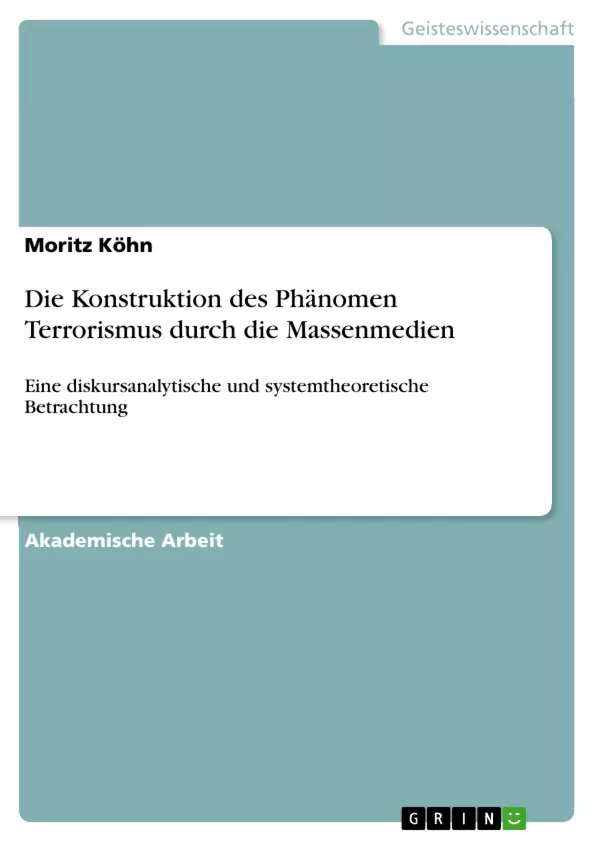Der Terrorismus, insbesondere der islamistische Terrorismus, ist eines der prägendsten Phänomene unserer modernen Welt. Fast täglich ist in den Medien die Rede von neuen Anschlägen, Kriegen und Interventionen, die zum Teil direkt, zum Teil indirekt mit Terror zu tun haben. Die Anschläge auf das World Trade Center im September 2001 stehen symbolisch für den Beginn dieser damals neuen Bedrohung. Seit diesem Zeitpunkt haben weitere Anschläge und Angriffe die Welt, und wie sie von den Menschen wahrgenommen wird verändert. Diese Wahrnehmung lässt sich insbesondere über Medien konstituieren und bietet damit die Möglichkeit zu erfahren, wie man mit Terrorismus umgeht.
Im Folgenden wird sich mit der Konstruktion des Terrorismus in den Massenmedien beschäftigt. Zu diesem Zweck beschränkt sich die Analyse auf zwei Ausgaben von unterschiedlichen Wochenzeitungen direkt nach den Pariser Anschlägen am 13. November 2015. Von Interesse ist vor allem die, mit der Verwendung des Begriffs „Terrorismus“, implizierte Wir/Sie Unterscheidung und mit welchen Werkzeugen sie in den Medien konstruiert wird und wie sie sich darin unterscheiden.
Anfangs wird der Begriff Terrorismus und die damit einhergehenden Schwierigkeiten erläutert. Terrorismus an sich ist nicht ansprechbar, hat keinen Adressaten, kann nicht als ein Objekt ausgemacht werden. Somit ist es nur möglich seine Wirksamkeit anhand von etwas Konkretem zu untersuchen. Also um sich der Beschaffenheit von Konstruktionen des Terrorismus zu nähern, scheint es sinnvoll dies anhand von dem Medium Zeitung zu tun. Zu diesem Zweck werden vorerst die Massenmedien im Allgemeinen mithilfe der Systemtheorie untersucht, um ihre Strukturen, mit denen sie ihre Realität erzeugen genauer zu betrachten. Dabei ist zu erkennen, dass verschiedene Schemabildungen zu beobachten sind, die direkte Auswirkungen auf die Konstruktion von Objekten, also auch Problemen, haben. Zu vermuten ist, dass schon die Bezeichnung Terrorismus und die dazugehörige Beschreibung eine Kategorisierung und Abgrenzung, durch eine Wir/Sie Kontrastierung, dem Phänomen immanent ist.
Zum Schluss können darüber Vermutungen angestellt werden inwiefern die Art und Weise wie der Terrorismus konstruiert wird Auswirkungen auf Kommunikationen der Rezipienten hat und somit auch auf andere Funktionssysteme, wie das der Politik.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Hauptteil
- 1. Versuch einer Terrorismusdefinition
- 2. Warum die Anschläge des 13. November in Paris
- 3. Massenmedien
- 3.1. Terrorismus und Massenmedien
- 3.2. Was wird hier als Konstruktion verstanden?
- 3.3. Konstruktion des Terrorismus als allgemeine Problemkonstruktion
- 3.4. Massenmedien als System
- 3.5. Die Erzeugung einer Konstruktion eines Objektes/Problems
- 3.6. Massenmedien als soziales Gedächtnis
- 4. Anmerkung zu der Wahl des Mediums
- 5. Diskursanalyse und ihre Operationalisierung
- 5.1. Diskursanalyse nach Michel Foucault
- 5.2. Operationalisierung der Diskursanalyse durch die Diskurslinguistik
- 6. Analyse
- 6.1. Analyse der Welt am Sonntag (Ausgabe 46/2015)
- 6.2. Analyse der Zeit (Ausgabe 47/2015)
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Konstruktion des Terrorismus in den Massenmedien. Im Fokus steht die Analyse zweier Ausgaben unterschiedlicher Wochenzeitungen, die direkt nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 veröffentlicht wurden. Die Arbeit untersucht, wie der Begriff „Terrorismus“ verwendet wird, welche Wir/Sie-Unterscheidung impliziert ist und welche Werkzeuge in den Medien zur Konstruktion dieser Unterscheidung eingesetzt werden. Darüber hinaus wird beleuchtet, wie sich diese Konstruktionen auf Kommunikation und andere Funktionssysteme, beispielsweise die Politik, auswirken können.
- Die Konstruktion des Terrorismus in den Massenmedien
- Die Analyse der Wir/Sie-Unterscheidung im Kontext des Terrorismus
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Realität
- Die Auswirkungen der Konstruktion von Terrorismus auf Kommunikation und andere Funktionssysteme
- Die Anwendung systemtheoretischer und diskursanalytischer Methoden zur Untersuchung des Themas
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung
Die Einleitung skizziert den Terrorismus als ein prägendes Phänomen der modernen Welt. Die Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Konstituierung der Wahrnehmung von Terrorismus und prägen damit den Umgang mit dem Thema. Die Analyse konzentriert sich auf die Konstruktion des Terrorismus in den Massenmedien und untersucht zwei Ausgaben von Wochenzeitungen, die direkt nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 erschienen.
II. Hauptteil
1. Versuch einer Terrorismusdefinition
Dieses Kapitel erläutert die Herausforderungen bei der Definition von Terrorismus. Der Begriff wird multiperspektivisch betrachtet und die Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition werden aufgezeigt.
2. Warum die Anschläge des 13. November in Paris?
Dieses Kapitel untersucht die soziale Wirkung der Pariser Anschläge und die Bedeutung der Anschläge für die Konstruktion des Terrorismus in den Medien. Die Analyse konzentriert sich auf den Schrecken, der durch die Anschläge erzeugt wurde, und die Frage der Wiederholungsgefahr.
3. Massenmedien
Das Kapitel beschreibt die Rolle der Massenmedien als System in der Konstruktion von Realität und Objekten. Es werden unterschiedliche Schemabildungen in der Medienlandschaft beleuchtet, die direkte Auswirkungen auf die Konstruktion von Problemen wie dem Terrorismus haben.
4. Anmerkung zu der Wahl des Mediums
Dieses Kapitel erläutert die Wahl des Mediums „Zeitung“ für die Analyse der Konstruktion des Terrorismus. Die Zeitung wird als ein Medium betrachtet, das die Möglichkeit bietet, sich der Beschaffenheit von Konstruktionen des Terrorismus zu nähern.
5. Diskursanalyse und ihre Operationalisierung
Dieses Kapitel stellt die Diskursanalyse als Methode vor und erläutert ihre Anwendung im Kontext der Analyse von Terrorismus. Es werden die Ansätze von Michel Foucault und der Diskurslinguistik erläutert.
6. Analyse
Dieses Kapitel präsentiert die Analyse von zwei Ausgaben von Wochenzeitungen, die direkt nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 erschienen. Die Analyse konzentriert sich auf die Verwendung des Begriffs „Terrorismus“ und die in den Texten implizite Wir/Sie-Unterscheidung.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Medien, Konstruktion, Diskursanalyse, Systemtheorie, Wir/Sie-Unterscheidung, Pariser Anschläge, Islamischer Staat, soziale Wirkung, Schrecken, Wiederholungsgefahr, Kommunikation, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Welches Ereignis dient als Basis für die Medienanalyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die Berichterstattung direkt nach den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015.
Was bedeutet die "Wir/Sie-Unterscheidung" im Terrorismus-Diskurs?
Es beschreibt die mediale Konstruktion einer Grenze zwischen der eigenen Gesellschaft ("Wir") und den Terroristen ("Sie"), um Identität zu stiften und das Phänomen abzugrenzen.
Welche wissenschaftlichen Theorien werden in der Arbeit angewandt?
Die Arbeit nutzt die Systemtheorie zur Untersuchung der Massenmedien sowie die Diskursanalyse nach Michel Foucault und die Diskurslinguistik.
Warum wird das Medium Zeitung für die Analyse gewählt?
Zeitungen wie "Die Zeit" oder "Welt am Sonntag" bieten eine konkrete Grundlage, um die Beschaffenheit von Konstruktionen und Schemabildungen des Terrorismus zu untersuchen.
Wie beeinflusst die mediale Konstruktion von Terrorismus die Politik?
Die Art und Weise, wie Medien Terrorismus als Problem konstruieren, wirkt sich auf die Kommunikation der Rezipienten und damit auch auf politische Entscheidungen und Funktionssysteme aus.
- Quote paper
- Moritz Köhn (Author), 2016, Die Konstruktion des Phänomen Terrorismus durch die Massenmedien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502890