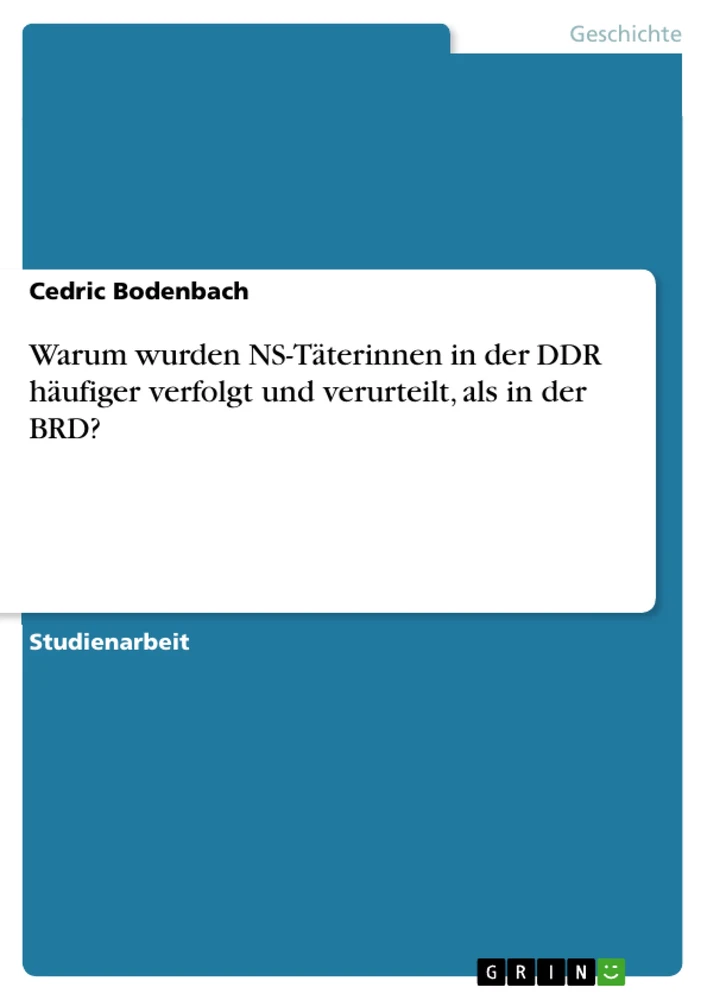Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Fragen "Was ist der Grund für diese deutliche juristische Disparität zwischen den beiden deutschen Staaten?" und "Hatten ostdeutsche Frauen womöglich einen größeren Anteil an nationalsozialistischen Verbrechen als Westdeutsche?" auseinander.
Nach langer Zeit, in welcher Frauen, die während der NS-Zeit zu Täterinnen wurden, nicht beziehungsweise nur wenig Beachtung in der Geschichtswissenschaft fanden, rückt dieses Thema seit den 1990er Jahren immer weiter in den Vordergrund vieler wissenschaftlicher Arbeiten. Bei näherer Recherche zu diesem Bereich der Geschlechtergeschichte fiel mir eine Statistik auf, aus welcher klar wurde, dass in Gerichtsprozessen der DDR ein deutlich höherer Prozentsatz an Frauen angeklagt und auch verurteilt wurde, als in der BRD.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Gründe der juristischen Disparitäten zwischen DDR und BRD
- 1.1. Das Frauenkonzentrationslager als Ausbildungs- und Arbeitsplatz
- 1.2. Die Rolle des veralteten gesellschaftlichen Geschlechterbildes bei Urteilen
- 1.3. Propaganda und Außenwirkung der DDR
- 2. Fallbeispiele
- 2.1. Beispiel BRD: Johanna Altvater (später Zelle)
- 2.2. Beispiel DDR: Erna Petri
- 3. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutlich höhere Verurteilungsrate von Frauen, die während des Nationalsozialismus Straftaten begangen hatten, in der DDR im Vergleich zur BRD. Die Zielsetzung besteht darin, die Gründe für diese juristische Disparität zu ergründen und zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Zeit von den späten 1940er bis in die frühen 1980er Jahre.
- Die Rolle des Konzentrationslagers Ravensbrück als Ausbildungsstätte für weibliches SS-Personal
- Der Einfluss des veralteten gesellschaftlichen Geschlechterbildes auf die juristische Bewertung weiblicher NS-Täterinnen
- Die gezielte Propaganda und die Außenwirkung der DDR im Kontext der Strafverfolgung
- Unterschiede in der Beweisführung und der Bewertung von Zeugenaussagen in Ost und West
- Fallbeispiele aus der BRD und der DDR zur Veranschaulichung der juristischen Unterschiede
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der unterschiedlichen Verfolgung und Verurteilung von weiblichen NS-Täterinnen in der DDR und BRD ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Gründen dieser Disparität und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf drei zentralen Gründen basiert: Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, das veraltete Geschlechterbild und die Propaganda in der DDR. Zusätzlich werden zwei Fallbeispiele angekündigt, die die Argumentation unterstützen sollen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Zeit von den späten 1940ern bis Anfang der 1980er Jahre, eine Periode, in der die Unterschiede in der Strafverfolgung besonders deutlich werden.
1. Gründe der juristischen Disparitäten zwischen DDR und BRD: Dieses Kapitel analysiert die drei Hauptgründe für die unterschiedliche juristische Behandlung weiblicher NS-Täterinnen in Ost- und Westdeutschland. Es beleuchtet die Bedeutung des KZ Ravensbrück als Ausbildungsstätte für Aufseherinnen und die Rolle der dortigen Tätigkeiten bei der späteren Strafverfolgung. Des Weiteren wird der Einfluss des traditionellen Geschlechterbildes und der damit verbundenen Wahrnehmung von Frauen als nicht-gewaltfähig untersucht, sowie die Bedeutung der gezielten Propaganda der DDR zur Aufdeckung und Verurteilung von NS-Verbrechern. Das Kapitel betont die unterschiedliche Beweislage und -bewertung in beiden deutschen Staaten.
2. Fallbeispiele: Das Kapitel präsentiert zwei Fallbeispiele, eines aus der BRD (Johanna Altvater) und eines aus der DDR (Erna Petri), um die in Kapitel 1 dargestellten Argumente zu illustrieren und die Unterschiede in der juristischen Praxis beider deutscher Staaten zu veranschaulichen. Die detaillierte Darstellung der Fälle soll die Auswirkungen der unterschiedlichen juristischen und politischen Kontexte auf die Strafverfolgung von weiblichen NS-Täterinnen verdeutlichen.
Schlüsselwörter
NS-Täterinnen, DDR, BRD, Ravensbrück, Frauenkonzentrationslager, Geschlechterbild, Propaganda, Strafverfolgung, Justiz, Juristische Disparitäten, Zeugenaussagen, Beweisführung, Fallbeispiele, Nachkriegsjustiz.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Juristische Disparitäten bei der Verfolgung weiblicher NS-Täterinnen in der DDR und BRD
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die deutlich höhere Verurteilungsrate von Frauen, die während des Nationalsozialismus Straftaten begangen hatten, in der DDR im Vergleich zur BRD. Sie analysiert die Gründe für diese juristische Disparität in der Zeit von den späten 1940er bis in die frühen 1980er Jahre.
Welche Hauptgründe werden für die juristischen Unterschiede genannt?
Die Arbeit identifiziert drei Hauptgründe: 1. Die Rolle des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück als Ausbildungsstätte für weibliches SS-Personal und die Bedeutung dieser Tätigkeit bei der späteren Strafverfolgung; 2. Der Einfluss des veralteten gesellschaftlichen Geschlechterbildes auf die juristische Bewertung weiblicher NS-Täterinnen; 3. Die gezielte Propaganda und Außenwirkung der DDR im Kontext der Strafverfolgung, sowie Unterschiede in der Beweisführung und Bewertung von Zeugenaussagen in Ost und West.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Gründen der juristischen Disparitäten zwischen DDR und BRD, ein Kapitel mit Fallbeispielen aus beiden deutschen Staaten und eine Schlussbemerkung. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Kapitel 1 analysiert die drei Hauptgründe der Disparitäten. Kapitel 2 veranschaulicht diese mit Fallbeispielen (Johanna Altvater - BRD; Erna Petri - DDR). Die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Fallbeispiele werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert die Fälle von Johanna Altvater (BRD) und Erna Petri (DDR), um die Unterschiede in der juristischen Praxis beider deutscher Staaten zu veranschaulichen und die Auswirkungen der unterschiedlichen juristischen und politischen Kontexte auf die Strafverfolgung weiblicher NS-Täterinnen zu verdeutlichen.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Der Fokus der Arbeit liegt auf der Zeit von den späten 1940er bis in die frühen 1980er Jahre, da in diesem Zeitraum die Unterschiede in der Strafverfolgung von weiblichen NS-Täterinnen besonders deutlich wurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: NS-Täterinnen, DDR, BRD, Ravensbrück, Frauenkonzentrationslager, Geschlechterbild, Propaganda, Strafverfolgung, Justiz, Juristische Disparitäten, Zeugenaussagen, Beweisführung, Fallbeispiele, Nachkriegsjustiz.
Welchen methodischen Ansatz verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit basiert auf der Analyse der drei zentralen Gründe: Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, das veraltete Geschlechterbild und die Propaganda in der DDR. Die Argumentation wird durch die Präsentation von zwei Fallbeispielen gestützt.
- Arbeit zitieren
- Cedric Bodenbach (Autor:in), 2019, Warum wurden NS-Täterinnen in der DDR häufiger verfolgt und verurteilt, als in der BRD?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503093