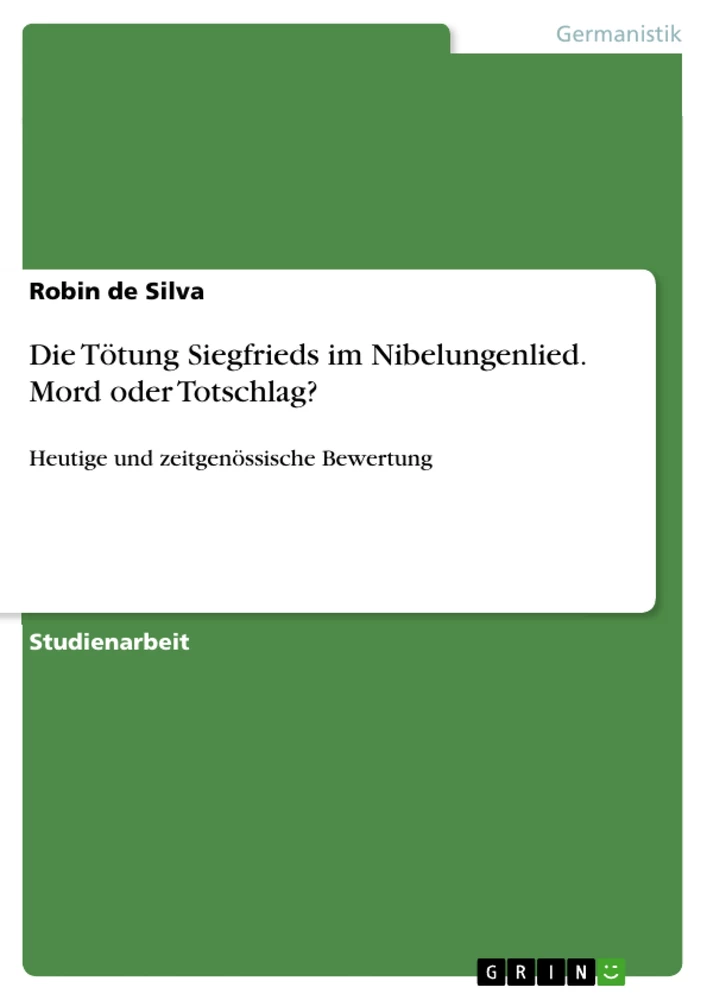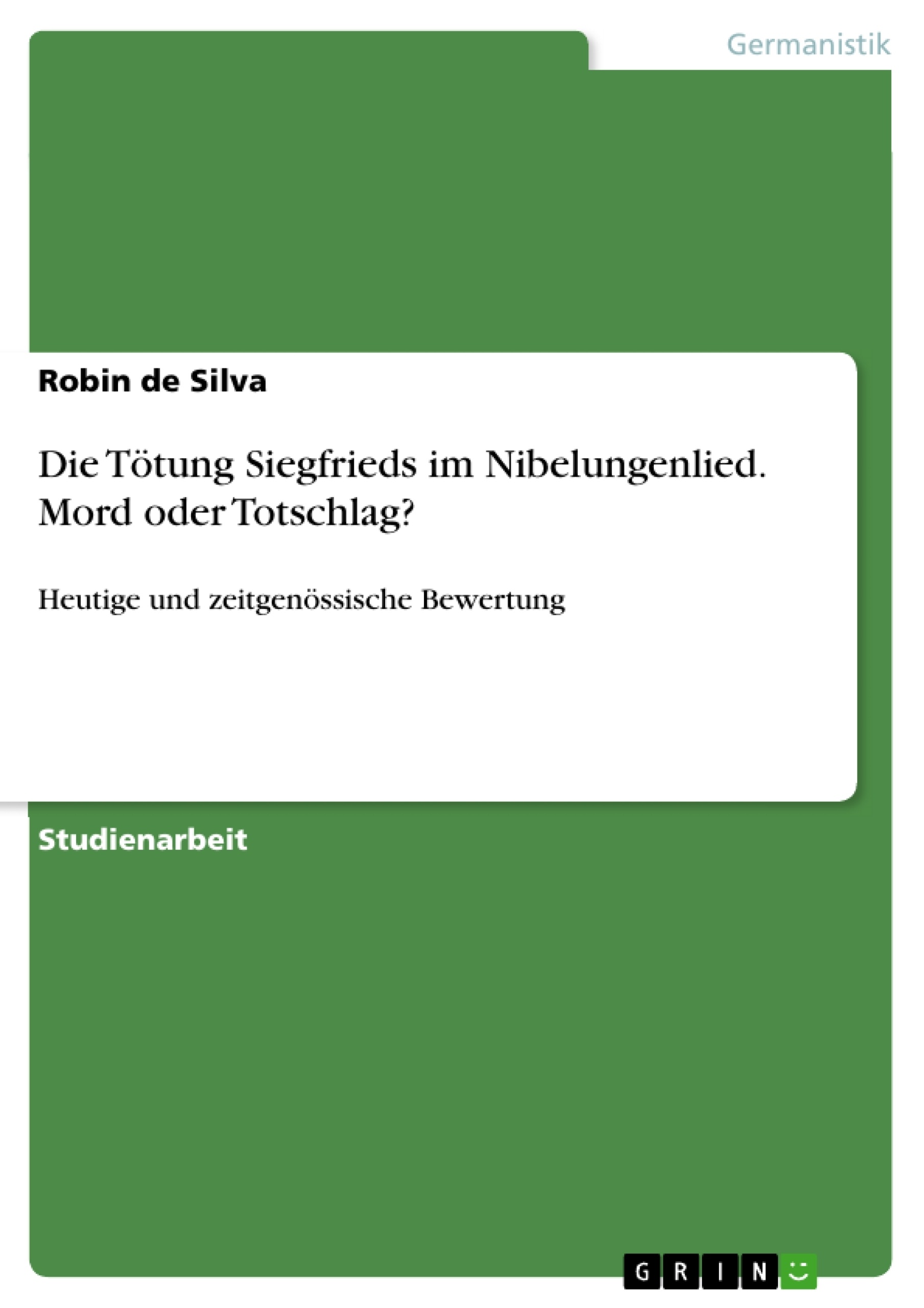Die Hausarbeit mit dem Titel "Mord oder Totschlag? Heutige und zeitgenössische Bewertung der Tötung Siegfrieds im Nibelungenlied" beschäftigt sich mit dem Tötungsdelikt Siegfrieds aus heutiger und zeitgenössischer Perspektive. Zur Bewertung des Falles werden das Strafgesetzbuch, der Sachsenspiegel und das Fehderecht zugrunde gelegt.
Anhand der heutigen Mordmerkmale des Strafgesetzbuches wird offensichtlich, wie schwierig eine heutige Bewertung des Falles sein würde, weil viele Fragen offenbleiben. Dagegen ist das Urteil aus zeitgenössischer Perspektive eindeutig. Diese kreative aber höchst wissenschaftliche Hausarbeit betrachtet das Nibelungenlied aus einer neuen Perspektive und gewährt interessante Einblicke in ein Gedankenspiel, welches uns Erkenntnisse für das heutige Recht liefert und überdenken lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Täterschaft
- Heutige Betrachtung des Tötungsdelikts an Siegfried
- Tathergang
- Merkmale des Totschlags
- Objektiver Tatbestand (§212 Abs. 1)
- Subjektiver Tatbestand (§212 Abs. 1)
- Besonders schwerer Fall (§212 Abs. 2)
- Merkmale des Mords
- Mordmerkmale der 1. Gruppe
- Mordlust
- Befriedigung des Geschlechtstriebs
- Habgier
- Sonstige niedrige Beweggründe
- Mordmerkmale der 2. Gruppe
- Heimtückisch
- Grausam
- Mit gemeingefährlichen Mitteln
- Mordmerkmale der 3. Gruppe
- Ermöglichungsabsicht
- Verdeckungsabsicht
- Mordmerkmale der 1. Gruppe
- Sachurteil aus heutiger Perspektive
- Zeitgenössische Betrachtung des Sachverhalts
- Sachsenspiegel / Landrecht
- Fehderecht
- Sühne
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Tötung Siegfrieds im Nibelungenlied aus heutiger und zeitgenössischer Perspektive. Das Ziel ist es, zu analysieren, ob das Tötungsdelikt nach heutigem Recht als Mord qualifiziert werden würde und wie die Tat im Kontext des mittelalterlichen Rechtsverständnisses beurteilt werden kann. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob es sich um Mord, Totschlag oder eine gerechtfertigte Tötung handelte.
- Rechtliche Bewertung der Tötung Siegfrieds nach heutigem Strafrecht
- Analyse der Mordmerkmale aus heutiger Sicht
- Zeitgenössische Rechtsgrundlagen und ihre Anwendung auf den Sachverhalt
- Untersuchung der Täterschaft und der Rolle der beteiligten Personen
- Schlussfolgerungen zum zeitgenössischen Rechtsverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung der Rechtsgeschichte im Kontext der literarischen Analyse. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Komplexität der Täterschaft im Nibelungenlied und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Schuld der beteiligten Personen.
Im dritten Kapitel wird die Tötung Siegfrieds anhand von Mordmerkmalen des heutigen Strafgesetzbuchs analysiert. Zuerst wird der Tathergang ausführlich beschrieben, bevor die Mordmerkmale nach objektiven und subjektiven Kriterien geprüft werden. Abschließend erfolgt eine hypothetische Beurteilung des Sachverhalts aus heutiger Sicht.
Das vierte Kapitel betrachtet die Tötung Siegfrieds aus der Sicht des zeitgenössischen Rechts. Es werden die Rechtsgrundlagen des Sachsenspiegels, des Fehderechts und der Sühne vorgestellt und in Bezug auf den Sachverhalt analysiert.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Mord, Totschlag, Tötungsdelikt, Strafrecht, Rechtsgeschichte, Sachsenspiegel, Fehderecht, Sühne, Täterschaft, Schuld, Zeitgenössische Rechtsnormen.
Häufig gestellte Fragen
Würde die Tötung Siegfrieds heute als Mord oder Totschlag gelten?
Nach heutigem Strafrecht (§ 211 StGB) könnten Merkmale wie Heimtücke (Angriff während des Trinkens an der Quelle) für Mord sprechen, wobei die genaue Beurteilung aufgrund fehlender Details zum Vorsatz schwierig bleibt.
Wie wurde die Tat im Mittelalter bewertet?
Aus zeitgenössischer Sicht war das Urteil oft eindeutiger. Grundlagen wie der Sachsenspiegel und das Fehderecht spielten eine Rolle bei der Einordnung, ob es sich um eine rechtmäßige Rache oder einen feigen Meuchelmord handelte.
Was ist das Fehderecht im Kontext des Nibelungenliedes?
Das Fehderecht erlaubte es im Mittelalter, erlittenes Unrecht durch Gewalt zu rächen, sofern bestimmte Regeln und Fristen eingehalten wurden. Die Tat an Siegfried wird oft als Teil einer solchen gewaltsamen Konfliktlösung diskutiert.
Welche Rolle spielt Hagen von Tronje rechtlich?
Hagen agiert als Tatausführender. Die Arbeit untersucht seine Täterschaft und ob er im Auftrag seines Königs handelte, was die rechtliche Bewertung der Schuld beeinflusst.
Was versteht man unter „Sühne“ in der Rechtsgeschichte?
Sühne bezeichnete im mittelalterlichen Recht den Versuch, einen Konflikt durch Ausgleichszahlungen oder rituelle Handlungen beizulegen, um die Blutrache zu beenden.
- Quote paper
- Robin de Silva (Author), 2019, Die Tötung Siegfrieds im Nibelungenlied. Mord oder Totschlag?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503106