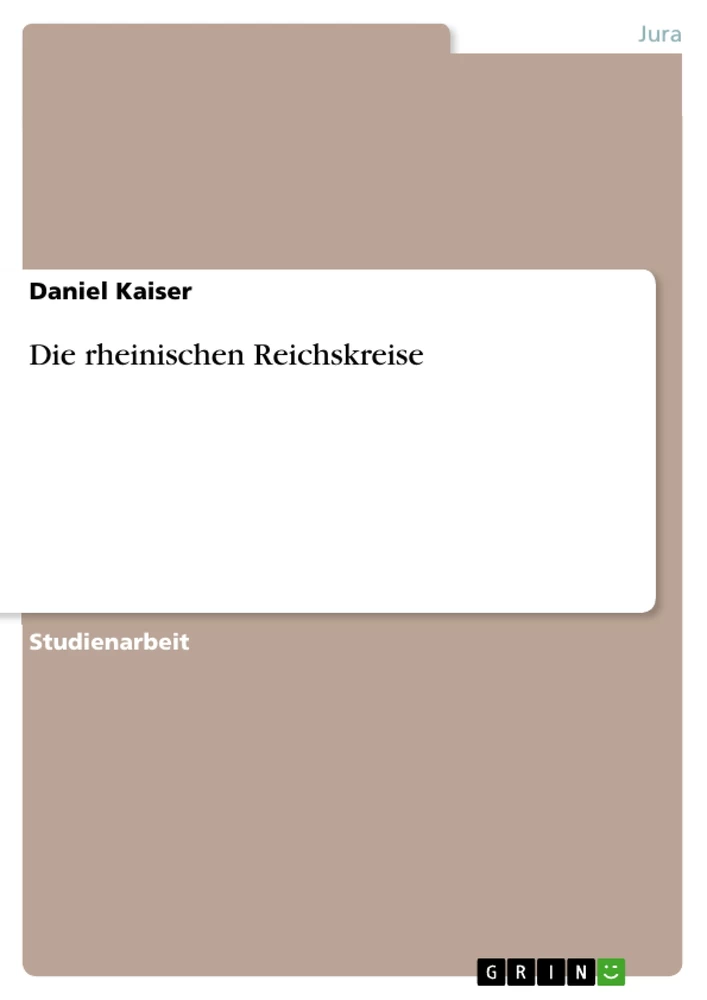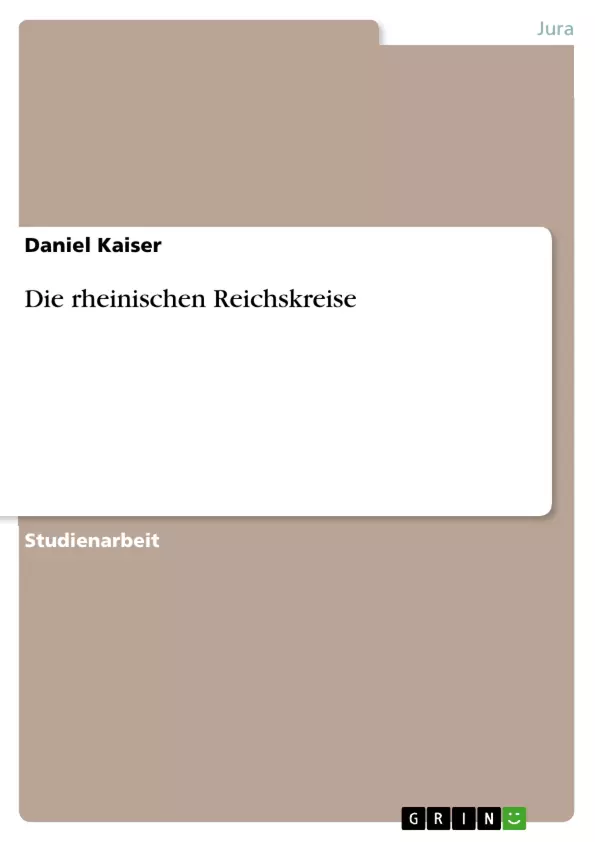Die Reichskreise sind bleibendes Ergebnis der Reichsreformbestrebungen des 15. und 16. Jahrhunderts. Der innere Frieden im Reich wurde immer wieder durch Fehden zwischen den Ständen gefährdet. Lösungsmöglichkeiten boten regionale oder überregionale Einungen und Bünde zwischen den Reichsständen, die Sicherungsaufgaben wahrnehmen sollten, die das Reich nicht mehr erfüllen konnte. Diese Bündnisse, wie z.B. der Schwäbische Bund (1488), die Einung der Ritter und Knechte St. Georgenschild oder die Städtebünde des 14. Jahrhunderts, litten aber unter den konkurrierenden Führungsansprüchen der mächtigsten Mitglieder, zudem waren sie nicht reichsweit organisiert. Zwar hatte der König im späten Mittelalter noch die „Friedensgewalt“, d.h. das Recht, einen Landfrieden aufzurichten, es bestand aber keine funktionsfähige Reichsorganisation, um das Fehdewesen zu bekämpfen und keine Exekutionsgewalt, die Landfriedensbruch und Selbsthilfe verhindern und Urteile des Reichsgerichts vollstrecken konnte. Die kaiserliche Zentralgewalt war zersetzt, das Interregnum (1254-1273) hatte die Reichsgewalt zugunsten einer fast uneingeschränkten Landeshoheit der Ter-ritorialherren in den Hintergrund treten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. TEIL: DIE REICHSKREISVERFASSUNG
- A. Entstehung und Entwicklung der Reichskreise
- I. Reichsreform und Landfriedenswahrung
- II. Der Reichstag zu Worms 1495
- III. Die Reichsregimente
- 1.) Das erste Reichsregiment
- 2.) Die Errichtung der zehn Reichskreise 1512
- 3.) Das zweite Reichsregiment
- IV. Wachsende Kompetenzen der Kreise
- 1.) Reichsexekutionsordnung von 1555
- 2.) Die Reichskreise als „Ersatzexekutive“
- 3.) Die Einbeziehung der Kreise in die Türkenhilfe
- 4.) Instrumentalisierung der Kreisorganisation durch Schweden
- 5.) Die Redintegration der Reichskreise im Westfälischen Frieden
- V. Entwicklung der Kreise im 18. Jahrhundert
- B. Verfassung der Kreise
- I. Die Kreisversammlungen
- 1.) Das Verfahren der Stimmabgabe
- 2.) Verbindlichkeit der Beschlüsse
- II. Der Kreisoberst bzw. -hauptmann
- III. Das Ausschreibamt und das Kreisdirektorium
- IV. Staatsqualität der Kreise?
- C. Die Aufgaben der Kreise
- I. Die Kreise als Exekutionsorgane
- II. Erhebung der Reichssteuern
- III. Bedeutung der Kreise für die Verwaltung und Gesetzgebung des Reiches und der Territorien
- 1.) Die Kreise als Mittelebene
- 2.) Wechselbeziehungen auf dem Gebiet des Polizeirechts
- 3.) Der Mainzer Kurfürst als Gesetzgeber
- IV. Die Bedeutung der Reichskreise für die Gerichtsbarkeit
- 1.) Präsentation der Assessoren
- 2.) Exekution der Urteile
- V. Militärwesen
- 1.) Die Reichskriegsverfassung
- 2.) Schutz der Zivilbevölkerung vor Durchmärschen
- VI. Münzwesen
- VII. Straßenbau
- VIII. Handelspolitik
- IX. Das Verhältnis der Reichskreise zu anderen Institutionen
- D. Die Reichskreistage
- I. Der Frankfurter Reichskreistag von 1554
- II. Stellung der Kurfürsten
- E. Der Zusammenbruch des Reiches und das Ende der Reichskreise
- 2. TEIL: DIE RHEINISCHEN REICHSKREISE
- A. Der Oberrheinische Reichskreis
- I. Geographische Gliederung
- II. Die Kreisverfassung
- 1.) Die kreisausschreibenden Fürsten
- 2.) Der Kreishauptmann
- 3.) Der Kreistag
- III. Finanzverfassung
- IV. weitere Kreisinstitutionen
- V. Kreisaktivitäten
- 1.) Münzwesen
- 2.) Wahl der Beisitzer des Reichskammergerichts
- 3.) Ausweitung der Aufgabenstellung des Kreises
- VI. Der Oberrheinische Kreis als „Sperriegel“ im Westen
- VII. Der Straßburger Kapitelstreit und das „Landrettungswerk“
- VIII. Das Ende des Kreises
- B. Der Kurrheinische Reichskreis
- I. Entstehung und geographische Ausdehnung
- II. Verfassung des Kreises
- 1.) Ausschreibamt und Direktorium
- 2.) Kreisobristenamt und Umsetzung der Reichskriegsverfassung 1681
- 3.) Der Kreistag
- III. Kreisverwaltung
- IV. Die Reichskammer-Präsentation der Kurfürsten
- V. Münzpolitik
- VI. Bewertung der Kreisaktivität
- C. Zusammenarbeit des Kur- und Oberrheinischen Kreises
- I. Kurmainz als Bindeglied zwischen Kur- und Oberrheinischem Reichskreis
- II. Unterschiedliche Struktur der beiden Kreise
- III. Personalunionen
- IV. Einzelne Kooperationsprojekte
- V. Das Polizeiwesen als Beispiel überterritorialer Aufgabenerfüllung
- D. Der niederrheinisch-westfälische Reichskreis
- I. Territoriale Gliederung
- II. Die Kreisinstitutionen
- 1.) Der kreisausschreibende Fürst
- 2.) Der Kreisobrist
- 3.) Weitere Amtsträger des Kreises
- 4.) Der Kreistag
- E. Die Kreisassoziationen
- I. Ständeeinungen
- II. Rechtsnatur der Assoziationen
- III. Der Rheinbund von 1658
- IV. Weitere Assoziationen zur Friedenssicherung
- V. Die Führungsrolle des Reichserzkanzler
- VI. Frankfurter Assoziation, 1697
- VII. Nördlinger Assoziation
- VIII. Weitere Zusammenschlüsse und das Ende der Assoziationspolitik
- F. Aktuelle Forschungsarbeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Reichsreform des 16. Jahrhunderts und der Einführung der Reichskreise, insbesondere mit den kur- und oberrheinischen Reichskreisen und ihrer Bedeutung für die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
- Die Entwicklung der Reichsreform und die Entstehung der Reichskreise
- Die Verfassung und die Aufgaben der Reichskreise
- Die Rolle der Reichskreise in der Reichsverwaltung und Gesetzgebung
- Die Bedeutung der Reichskreise für das Militärwesen und die Friedenswahrung
- Die Zusammenarbeit der Kur- und Oberrheinischen Reichskreise und die Auswirkungen auf die Reichsgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
1. TEIL: DIE REICHSKREISVERFASSUNG
Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Reichskreise im Heiligen Römischen Reich. Er beleuchtet die Reichsreform des 16. Jahrhunderts, die zur Einführung der Reichskreise führte, und untersucht deren Aufgaben, Verfassung und Kompetenzen im Laufe der Zeit. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage gewidmet, ob die Reichskreise als „Ersatzexekutive“ des Reiches fungierten und welche Bedeutung sie für die Reichsverwaltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit hatten.
2. TEIL: DIE RHEINISCHEN REICHSKREISE
Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf die kur- und oberrheinischen Reichskreise. Er untersucht ihre geographische Gliederung, Verfassung, Finanzierung und die wichtigsten Aufgaben, die sie im Rahmen des Reiches wahrnahmen. Dabei werden auch die Beziehungen zwischen den beiden Kreisen und ihre Bedeutung für die Reichsgeschichte beleuchtet. Außerdem werden die Kreisassoziationen und deren Bedeutung für die Friedenssicherung und die Reichspolitik behandelt. Die Arbeit endet mit einem Blick auf die aktuelle Forschung zu diesem Themenbereich.
Schlüsselwörter
Reichsreform, Reichskreise, kurrheinischer Reichskreis, oberrheinischer Reichskreis, Reichsverwaltung, Reichsgesetzgebung, Reichsgerichtsbarkeit, Reichsfinanzwesen, Kreisassoziationen, Friedenssicherung, Reichsgeschichte.
- Arbeit zitieren
- Daniel Kaiser (Autor:in), 2003, Die rheinischen Reichskreise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50328