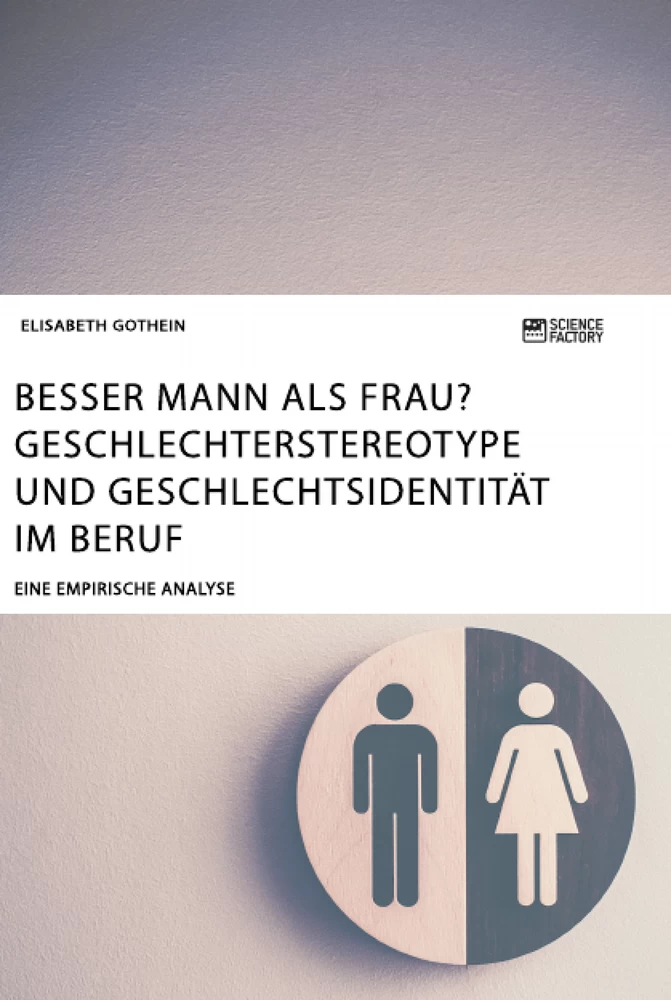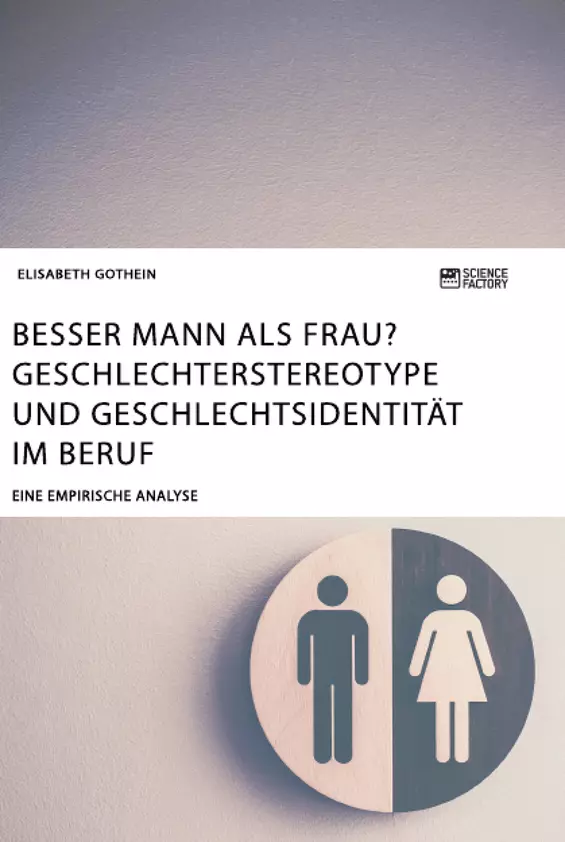In der Gesellschaft wird seit Jahren diskutiert, wie sich eine Gleichstellung von Frauen und Männern im Berufsleben erreichen lässt. Dennoch werden Erwerbsarbeit und beruflicher Erfolg weiterhin mit Männlichkeit assoziiert und Flexibilität und Sorgearbeit mit Weiblichkeit.
Frauen und Männern droht der Verlust ihrer Geschlechtsidentität, sobald sie ihrem Geschlechterstereotyp widersprechende Verhaltensweisen, Eigenschaften oder berufliche Interessen zeigen. Auf Basis einer empirischen Untersuchung analysiert Elisabeth Gothein die Reaktionen auf Berufe und Tätigkeiten, die gemeinhin mit Weiblichkeit oder Männlichkeit assoziiert werden.
Um eine Gleichstellung der Geschlechter im Beruf zu erreichen, empfiehlt Gothein männliche und weibliche Sterotype bewusst vom Geschlecht zu entkoppeln. Beruflicher Erfolg als Status, Arbeitszeitflexibilität oder eine gesunde Work-Life-Balance sollten von Frauen und Männern gleichermaßen angestrebt werden können, ohne dass dies einen Verlust der Geschlechtsidentität zur Folge hat. Mit ihren Forschungsergebnissen bietet Gothein einen Ansatzpunkt für weitere Forschung in einem wichtigen und stark diskutierten Bereich der heutigen Gesellschaft.
Aus dem Inhalt:
- Geschlechterdifferenzen;
- Geschlechterforschung;
- Identität;
- Social Identity Theory;
- Self-Verification;
- Self-Enhancement;
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Theoretischer Hintergrund
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Identität und Geschlechtsidentität
- 1.3 Fokus Mann: Bedrohung der Geschlechtsidentität
- 1.3.1 Bedrohung der Geschlechtsidentität
- 1.3.2 Unsicherheit der Geschlechtsidentität
- 1.3.3 Wiederherstellung der Geschlechtsidentität
- 1.3.4 Wiederherstellung im beruflichen Kontext
- 1.3.5 Erklärungen zur stärkeren Bedrohung der Männer als der Frauen
- 1.4 Fokus Frau im beruflichen Kontext: Gewinn von sozialem Status
- 1.4.1 Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung
- 1.4.2 Männlichkeit als Indikator von sozialem Status im Beruf
- 1.5 Hypothesen
- 1.5.1 H1: Zufriedenheit mit der Prototypikalitätsrückmeldung
- 1.5.2 H2: Zukünftiger beruflicher Erfolg
- 1.5.3 H3: Arbeitflexibilitätspräferenz
- 1.5.4 H4: Wahrnehmung des beruflichen Erfolgs
- 1.5.5 H5: Wahrnehmung der Arbeitsflexibilitätspräferenz
- 2 Methode
- 2.1 Untersuchungsdesign
- 2.2 Stichprobe
- 2.3 Vorgehen und Material
- 2.3.1 Messungen
- 3 Ergebnisse
- 3.1 Datenaufbereitung und Analysemethoden
- 3.2 Deskriptive Statistiken
- 3.3 Inferenzstatistische Analysen
- 3.3.1 Manipulationscheck und Check der beruflichen abhängigen Variablen
- 3.3.2 Varianzanalysen und Kontrastanalysen
- 3.3.3 Moderatoranalysen
- 3.4 Weiterführende Analysen
- 3.4.1 Moderatoranalysen
- 3.4.2 Gruppenunterschiede
- 4 Diskussion
- 4.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- 4.2 Limitationen und Perspektive für zukünftige Forschung
- 4.3 Fazit
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Bedrohung der Geschlechtsidentität im beruflichen Kontext und untersucht die Reaktionen von Männern und Frauen auf eine solche Bedrohung. Im Fokus stehen dabei die affektiven Reaktionen der Probanden sowie deren Einstellungen zu beruflichen Konstrukten, die mit Weiblichkeit oder Männlichkeit assoziiert werden.
- Bedrohung der Geschlechtsidentität im beruflichen Kontext
- Reaktionen von Männern und Frauen auf Bedrohungen der Geschlechtsidentität
- Assoziation von beruflichen Konstrukten mit Geschlechterstereotypen
- Einfluss der Geschlechtsidentität auf die Wahrnehmung von beruflichen Konstrukten
- Rolle der sozialen Statushierarchie bei der Reaktion auf Bedrohungen der Geschlechtsidentität
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Studie und stellt die relevanten Theorien zu Identität und Geschlechtsidentität vor. Es werden Geschlechterstereotype, Gender Role Conflict und die Social Identity Theory sowie die Symbolic Self-Completion Theorie und die Self-Verification und Self-Enhancement Theorie erläutert. Im Fokus des zweiten Kapitels steht die Methodik der Studie, die als Online-Studie mit einem 2 (Geschlecht: männlich vs. weiblich) x 2 (Bedrohung: ja vs. nein)-between-subjects Design durchgeführt wurde. Das dritte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, wobei die deskriptiven und inferenzstatistischen Analysen sowie die Moderatoranalysen zusammengefasst werden. Das vierte Kapitel widmet sich der Diskussion der Ergebnisse und beleuchtet die Implikationen der Studie für den Berufsalltag sowie die Limitationen und Perspektiven für zukünftige Forschung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Geschlechtsidentität, Geschlechterstereotype, Bedrohung der Geschlechtsidentität, beruflicher Erfolg, Arbeitsflexibilität, Work-Life-Balance, Social Identity Theory, Self-Verification und Self-Enhancement Theorie, Individual Mobility, Gender Role Conflict, Precarious Manhood Theory, Maskulinität, Femininität.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Geschlechterstereotype mit beruflichem Erfolg zusammen?
Beruflicher Erfolg wird oft mit Männlichkeit assoziiert, während Flexibilität und Sorgearbeit häufig als weiblich wahrgenommen werden, was die Gleichstellung erschwert.
Was versteht man unter der Bedrohung der Geschlechtsidentität?
Diese tritt auf, wenn Personen Verhaltensweisen zeigen oder Berufe wählen, die nicht den gesellschaftlichen Erwartungen an ihr Geschlecht entsprechen.
Warum reagieren Männer oft stärker auf Identitätsbedrohungen?
Die Forschung (z.B. Precarious Manhood Theory) legt nahe, dass Männlichkeit oft als ein fragiler Status gesehen wird, der aktiv bewiesen und verteidigt werden muss.
Was ist die Social Identity Theory?
Diese Theorie besagt, dass ein Teil des Selbstkonzepts eines Individuums aus der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen (wie dem Geschlecht) resultiert.
Wie kann Gleichstellung im Beruf gefördert werden?
Die Arbeit empfiehlt, Stereotype bewusst vom Geschlecht zu entkoppeln, damit Erfolg und Work-Life-Balance für alle Geschlechter gleichermaßen erstrebenswert sind.
- Quote paper
- Elisabeth Gothein (Author), 2020, Besser Mann als Frau? Geschlechterstereotype und Geschlechtsidentität im Beruf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503304