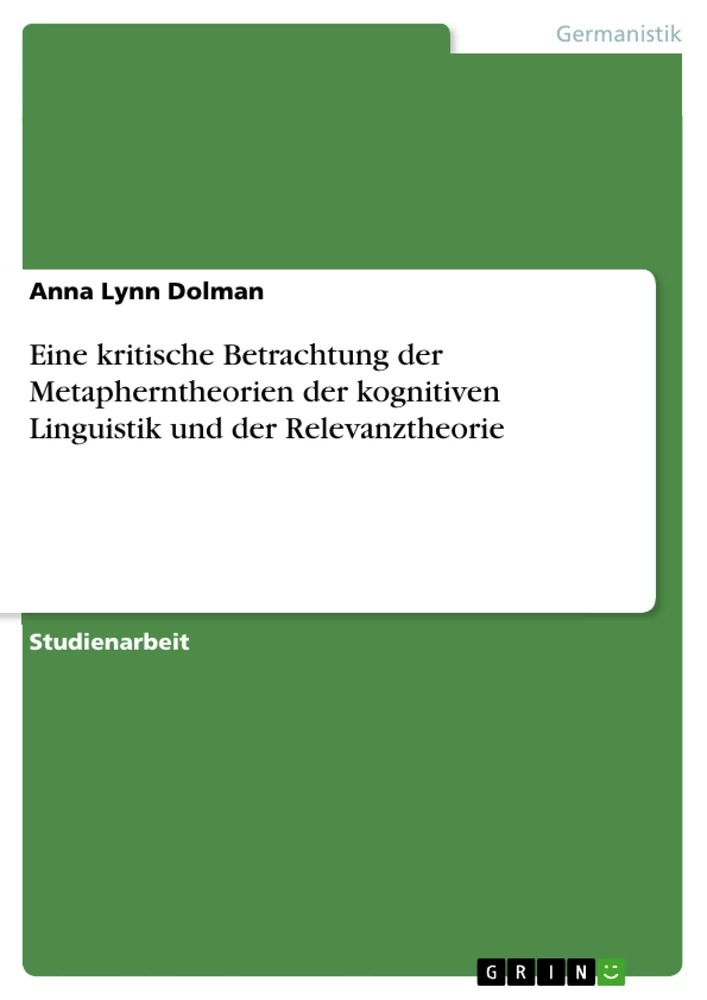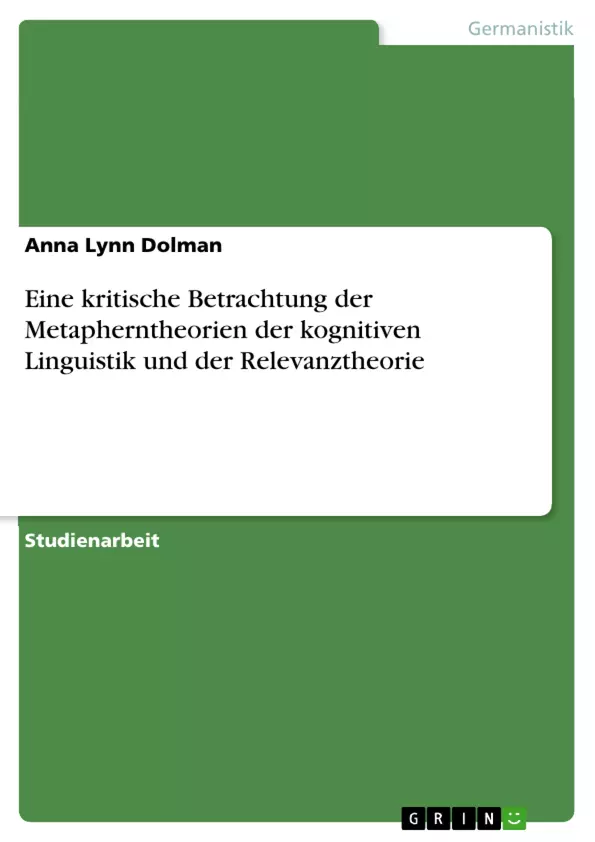Die Metapher ist gemeinhin bekannt als klassischer Topos der antiken Rhetorik, als impliziter Vergleich ohne Komparationspartikeln oder umgangssprachlich als sprachliches Bild. Auch die Linguistik knüpft an die grundsätzliche Vorstellung der Metapher als sprachliches Bild an und definiert sie dementsprechend als auf Bedeutungsähnlichkeiten beruhende Bedeutungsübertragung oder -verschiebung, bei der eine bestimmte Struktur oder ein zugrundeliegendes Konzept von einem Bereich auf einen anderen projiziert wird, was auch die Bedeutungserweiterung eines Lexems mit sich bringen kann (Meibauer, 2007). Die Einigung auf eine trennscharfe Definition scheint jedoch nahezu unmöglich, weshalb Weinrich dafür plädiert, „alle Arten des sprachlichen Bildes von der Alltagsmetapher bis zum poetischen Symbol“ (Weinrich, 1967) zuzulassen. Gerade aufgrund dieser offenbaren Uneindeutigkeit ist das Forschungsinteresse an der Metapher als linguistisches Phänomen bis heute ungebrochen, da dem Erkenntnisprozess die fundamentale Frage zugrunde liegt, in welchem Verhältnis verbale Manifestationen von Metaphern zu ihren kognitiven Ursprüngen stehen (Forceville, 2002); wie also menschliche Kognition vonstatten geht, scheinen doch menschliches Denken und Handeln grundsätzlich metaphorisch strukturiert zu sein (Lakoff & Johnson, 1980; Junge, 2010). In der Linguistik sind infolgedessen zahlreiche Ansätze und Erklärungsmodelle entstanden, die jedoch teilweise unvereinbar scheinen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Metapherntheorie der kognitiven Linguistik
- 2.1 Lakoff und Johnson: Metaphors We Live By (1980)
- 2.2 Kritik an der kognitiven Linguistik und ihrer Metapherntheorie
- 3. Metaphern in der Relevanztheorie
- 3.1 Die Relevanztheorie nach Sperber und Wilson (1995, 2002)
- 3.2 Kritik an der Relevanztheorie
- 4. Breitere Ansätze
- 4.1 Die hybride Metapherntheorie nach Markus Tendahl (2015)
- 4.2 Interkultureller Diskurs
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Metapherntheorien der kognitiven Linguistik und der Relevanztheorie kritisch und untersucht ihre Stärken und Schwächen. Sie verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis der Metapher als sprachliches und kognitives Phänomen zu entwickeln.
- Die Rolle von Metaphern in der menschlichen Kognition und Sprache
- Kritikpunkte an den Metapherntheorien der kognitiven Linguistik und der Relevanztheorie
- Die hybride Metapherntheorie als potenzieller Lösungsansatz
- Die Bedeutung interkultureller Faktoren für die Analyse von Metaphern
- Die Frage nach der Reichweite genuin linguistischer Theorien bei der Erfassung von Metaphern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Metapher ein und skizziert die unterschiedlichen Perspektiven auf die Metapher als sprachliches Phänomen. Sie stellt die beiden zentralen Theorien der kognitiven Linguistik und der Relevanztheorie vor und erläutert die grundlegenden Forschungsfragen.
2. Metapherntheorie der kognitiven Linguistik
2.1 Lakoff und Johnson: Metaphors We Live By (1980)
Dieser Abschnitt beschreibt die Metapherntheorie von Lakoff und Johnson, die Metaphern als kognitives Mapping und als Grundlage für unser Denken und Handeln begreift. Er erläutert das Konzept des mental mapping, die zentralen Thesen und die Rolle von metaphorischen Konzepten in unserer Alltagssprache.
2.2 Kritik an der kognitiven Linguistik und ihrer Metapherntheorie
Dieser Abschnitt analysiert die Kritikpunkte, die an der kognitiven Metapherntheorie geäußert werden. Er beleuchtet die Diskussion um die Autonomie von Sprache, die Frage nach der Bewusstheit von Metaphern und die Rolle von kulturellen Faktoren.
3. Metaphern in der Relevanztheorie
3.1 Die Relevanztheorie nach Sperber und Wilson (1995, 2002)
Dieser Abschnitt stellt die Relevanztheorie von Sperber und Wilson vor, die Metaphern als Mittel zur Optimierung von Kommunikationsprozessen betrachtet. Er erklärt die zentralen Prinzipien der Relevanztheorie und die Rolle von Metaphern in der pragmatischen Interpretation.
3.2 Kritik an der Relevanztheorie
Dieser Abschnitt beleuchtet die Kritik an der Relevanztheorie und diskutiert die Frage, ob die Relevanztheorie Metaphern adäquat erklären kann. Er analysiert die Limitationen des Ansatzes und diskutiert alternative Ansätze zur Erklärung von Metaphern.
4. Breitere Ansätze
4.1 Die hybride Metapherntheorie nach Markus Tendahl (2015)
Dieser Abschnitt stellt die hybride Metapherntheorie von Markus Tendahl vor, die Elemente der kognitiven Linguistik und der Relevanztheorie miteinander verbindet. Er erklärt, wie die beiden Theorien einander ergänzen und zu einem umfassenderen Verständnis von Metaphern führen können.
4.2 Interkultureller Diskurs
Dieser Abschnitt untersucht die Rolle von kulturellen Faktoren bei der Interpretation von Metaphern und diskutiert die Frage, ob genuin linguistische Theorien Metaphern ausreichend erfassen können. Er beleuchtet den interkulturellen Diskurs und die Bedeutung sprachvergleichender und soziopragmatischer Perspektiven.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Metaphern, kognitiver Linguistik, Relevanztheorie, Sprachphilosophie, Konzeptualisierung, Pragmatik, interkulturelle Kommunikation, sprachliche Bildlichkeit, mentale Prozesse, kognitives Mapping, metaphorische Konzepte, hybride Metapherntheorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert die kognitive Linguistik eine Metapher?
Nach Lakoff und Johnson ist eine Metapher nicht nur ein sprachliches Bild, sondern ein kognitiver Mechanismus ("mental mapping"), der unser Denken und Handeln strukturiert.
Was ist der Kern der Relevanztheorie bei Metaphern?
Sperber und Wilson sehen Metaphern als Mittel zur Optimierung der Kommunikation, bei denen der Hörer die Interpretation wählt, die bei geringstem kognitivem Aufwand die größte Relevanz besitzt.
Welche Kritik gibt es an Lakoff und Johnsons Theorie?
Kritiker bemängeln die Vernachlässigung der sprachlichen Autonomie sowie die Frage, inwieweit Metaphern im Alltag tatsächlich bewusst wahrgenommen werden.
Was ist eine "hybride Metapherntheorie"?
Der Ansatz von Markus Tendahl verbindet Elemente der kognitiven Linguistik mit der Relevanztheorie, um sowohl die kognitive Struktur als auch den kommunikativen Prozess zu erklären.
Spielen kulturelle Faktoren eine Rolle bei Metaphern?
Ja, die Arbeit diskutiert, dass rein linguistische Theorien oft nicht ausreichen, um die interkulturellen Unterschiede und soziopragmatischen Nuancen von Metaphern zu erfassen.
- Quote paper
- Anna Lynn Dolman (Author), 2019, Eine kritische Betrachtung der Metapherntheorien der kognitiven Linguistik und der Relevanztheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503352