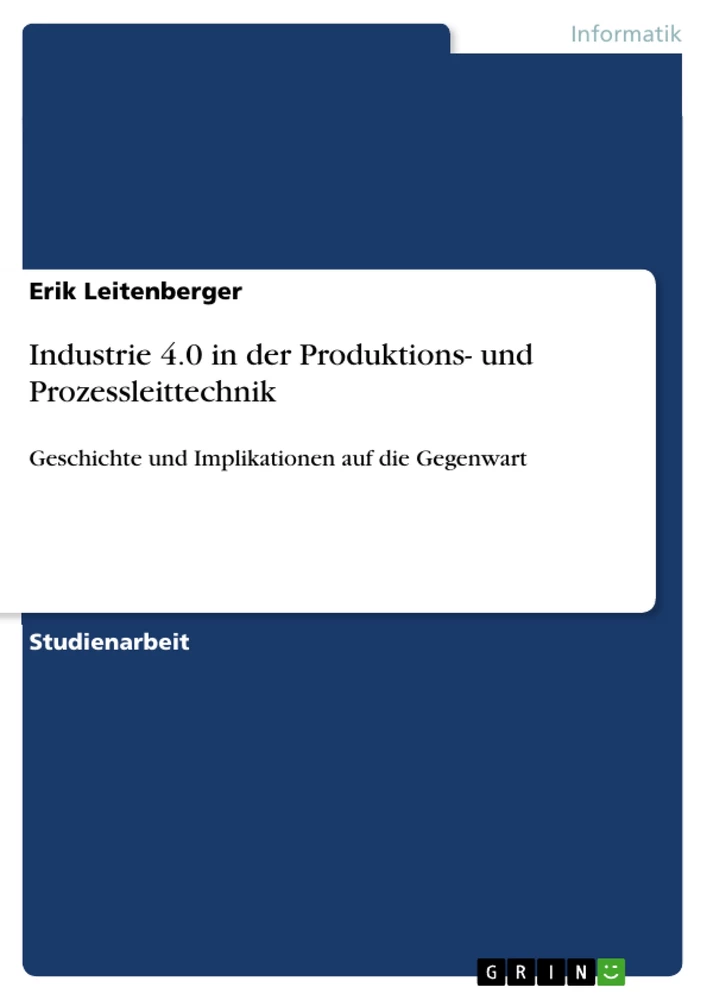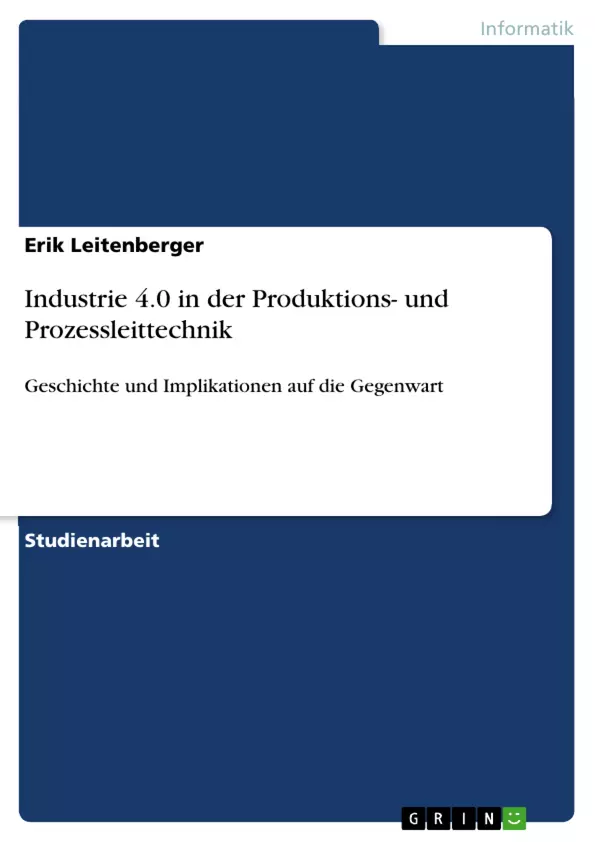Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Industrie 4.0 mit verstärktem Fokus auf die Produktions- und Prozessleittechnik. Zunächst wird der Weg hin zu Industrie 4.0 beschrieben und wesentliche Begrifflichkeiten geklärt. Anschließend werden zentrale technologische Elemente von Industrie 4.0 vorgestellt und anhand von einem Fallbeispiel in Zusammenhang gebracht. Abschließend werden die Chancen und Risiken für Industrie, Mensch und Umwelt erläutert.
In den vergangenen Jahrzehnten kam es zu bedeutenden technologischen Veränderungen. Diese Entwicklungen prägen den Alltag des Menschen in vollen Zügen und sind nicht mehr wegzudenken. Zudem bestimmen sie auch die Industrie und die Produktionstechnik. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Begriff "Digitalisierung" verwendet. Werden jedoch die verschiedenen industriellen Revolutionen betrachtet, kann festgestellt werden, dass es sich hierbei um ein Missverständnis handelt. Nach der Mechanisierung und Elektrifizierung war die dritte industrielle Revolution als Zeitalter der Digitalisierung bekannt. Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) löste die analoge und binäre Logik ab und leitete die Digitalisierung ein. Die vierte industrielle Revolution, die auch unter Industrie 4.0 steht für das Zeitalter der Vernetzung.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zur Thematik
- Der Weg zu Industrie 4.0
- Definition des Begriffs
- Industrielle Revolution
- Zentrale Elemente der Industrie 4.0 Vision
- Automatisierungspyramide
- Vertikale Integration
- Horizontale Integration
- Durchgängiges digitales Engineering
- Elemente der Industrie 4.0
- Cyber-Physische Systeme
- Big Data
- Cloud Computing
- Reale und Virtuelle Welt
- Radio Frequency Identification
- Internet der Dinge
- Smart Factory: Fabrik der Zukunft
- Zentralen Aspekte der Smart Factory
- Anwendungsbeispiel: Konfiguration des Traumautos
- Chancen und Risiken von Industrie 4.0
- Chancen
- Risiken
- Die Rolle der Mitarbeiter in Industrie 4.0
- Potenziale in Deutschland
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die aktuelle industrielle Revolution, Industrie 4.0, mit Schwerpunkt auf Produktions- und Prozessleittechnik. Sie beleuchtet den historischen Weg zur vierten industriellen Revolution, untersucht zentrale technologische Elemente und zeigt anhand eines Beispiels deren Anwendung in einer intelligenten Fabrik. Abschließend werden Chancen und Risiken von Industrie 4.0 für Unternehmen, Mitarbeiter und Umwelt erörtert.
- Die Entwicklung des Begriffs Industrie 4.0 und seine Bedeutung
- Die wichtigsten technologischen Elemente und ihre Interaktion
- Die Umsetzung von Industrie 4.0-Konzepten in der Praxis
- Die Chancen und Risiken, die mit der Einführung von Industrie 4.0 verbunden sind
- Die Rolle des Menschen in der intelligenten Fabrik der Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Seminararbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik Industrie 4.0, wobei die Bedeutung technologischer Fortschritte für die Entwicklung dieser industriellen Revolution hervorgehoben wird. Das zweite Kapitel beleuchtet den Weg zu Industrie 4.0, angefangen bei der ersten industriellen Revolution bis hin zur heutigen Zeit. Hier werden zentrale Elemente der Industrie 4.0 Vision definiert und erläutert, wie sie die Produktionsprozesse verändern. Kapitel drei befasst sich mit den wichtigsten technologischen Elementen, die Industrie 4.0 ermöglichen, darunter Cyber-Physische Systeme, Big Data, Cloud Computing, Internet der Dinge und Radio Frequency Identification. Das vierte Kapitel behandelt die Smart Factory als Kernkonzept der Industrie 4.0 und präsentiert ein Anwendungsbeispiel für die Konfiguration eines Fahrzeugs in einer intelligenten Fabrik. Abschließend werden im fünften Kapitel Chancen und Risiken von Industrie 4.0 für Unternehmen, Mitarbeiter und Umwelt untersucht.
Schlüsselwörter
Industrie 4.0, Digitalisierung, Smart Factory, Vernetzung, Cyber-Physische Systeme, Big Data, Cloud Computing, Internet der Dinge, Automatisierung, Produktion, Prozessleittechnik, Chancen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Industrie 4.0 von der dritten industriellen Revolution?
Während die dritte industrielle Revolution das Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung (SPS) war, steht Industrie 4.0 für das Zeitalter der umfassenden Vernetzung und der intelligenten Fabrik.
Was sind Cyber-Physische Systeme (CPS)?
CPS sind Verbundsysteme aus Informatik-Software und mechanischen Komponenten, die über Netzwerke kommunizieren und die reale Welt mit der virtuellen Welt verbinden.
Welche Rolle spielen Big Data und Cloud Computing in Industrie 4.0?
Diese Technologien ermöglichen die Speicherung und Analyse riesiger Datenmengen in Echtzeit, was für die Steuerung und Optimierung vernetzter Produktionsprozesse unerlässlich ist.
Was ist eine "Smart Factory"?
Eine Smart Factory ist eine intelligente Fabrik, in der sich Produktionssysteme weitgehend selbst organisieren und Produkte durch den Fertigungsprozess steuern (z. B. via RFID).
Welche Risiken birgt Industrie 4.0 für die Mitarbeiter?
Zu den Risiken gehören der mögliche Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung sowie steigende Anforderungen an die Qualifikation und Flexibilität der Beschäftigten.
- Quote paper
- Erik Leitenberger (Author), 2018, Industrie 4.0 in der Produktions- und Prozessleittechnik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503376