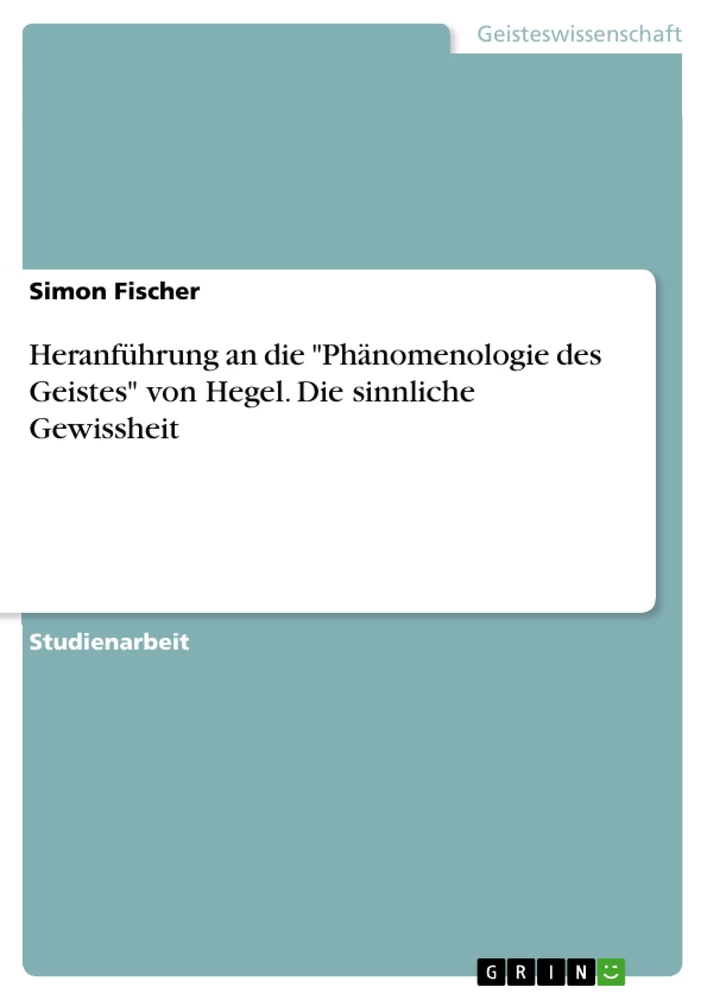Man kann die "Phänomenologie des Geistes" kurz beschreiben als Betrachtung der Gestalten des Bewusstseins. Das Ziel dieser Untersuchungen kann man vorwegnehmen, wenn man den Titel des letzten größeren Kapitels liest. Es handelt sich um das absolute Wissen. Diese Arbeit soll sich mit dem ersten Kapitel nach der Einleitung auseinandersetzen: Der sinnlichen Gewissheit. Denn in der "Phänomenologie des Geistes" ist das Grundproblem die Entsprechung von Begriff und Gegenstand. Und wenn im Laufe des Buches dieses Problem immer weiter besprochen wird, braucht es einen Ausgangspunkt für diese Untersuchungen. Und bei Hegel bildet diesen Ausgangspunkt für alle späteren Ausführungen eben die sinnliche Gewissheit.
Bereits die Überschrift des Kapitels stellt den Leser vor ein Problem. Wenn das Adjektiv sinnlich in der heutigen Zeit mit Leidenschaft assoziiert wird, hat das nichts mit der Bedeutung zu tun, die es in der "Phänomenologie des Geistes" erfährt. Kant gebrauchte dieses Wort, um die Gesamtheit der Sinne zusammenzufassen. Er hat damit unterschieden, was der Mensch mit seinen Sinnen aufnimmt und was der Verstand daran leistet. Aber auch damit kommt man in der Philosophie von Hegel nicht weiter. Man darf sich in diesem Kapitel nicht zu der Annahme verleiten lassen, dass darin eine Untersuchung der Sinneserkenntnisse gemacht wird.
Hegel zu lesen ist nicht einfach. Seine Philosophie zu verstehen ist noch weniger leicht. Besonders die "Phänomenologie des Geistes" macht es dem Anfänger schwer, den Gedankengängen zu folgen und ohne Begleitliteratur erscheint dies fast als unmöglich. Aber trotzdem ist die darin ausgebreitete Philosophie hochinteressant und diese Qualität des Buches ist der Gegenpol zu den Schwierigkeiten, die es bereitet, dem Stoff zu folgen. Ebenso war Hegel der Ansicht, dass es der eigentliche Fehler wäre, wegen der Furcht vor dem Irrtum keinen Versuch zu wagen, eine Theorie über etwas aufzustellen. Den Irrtum sah er als wesentliches Mittel an, um im Erkennen weiterzukommen. Hat man seinen Irrtum als solchen erkannt, kann man ihm auf den Grund gehen und ihn korrigieren. Wagt man keinen Versuch wegen der Angst vor dem Irrtum, hat dies laut Hegel nur die Folge, dass man auf seiner Erkenntnisstufe nicht weiter fortschreiten kann.
Inhaltsverzeichnis
A) Einleitung
B) Ausführungen
1) Warum Hegel mit der sinnlichen Gewissheit beginnt
2) Ärmster Reichtum
a) Erster Irrtum
b) Zweiter Irrtum
3) Erste Prüfung: Die Frage nach dem Jetzt und Hier
4) Zweite Prüfung: Vom Objekt zurück zum Subjekt
5) Die letzte Prüfung
a) These- Antithese- Synthese
b) Die letzte Erfahrung der sinnlichen Gewissheit
C) Schlussfolgerung
D) Literaturverzeichnis
-
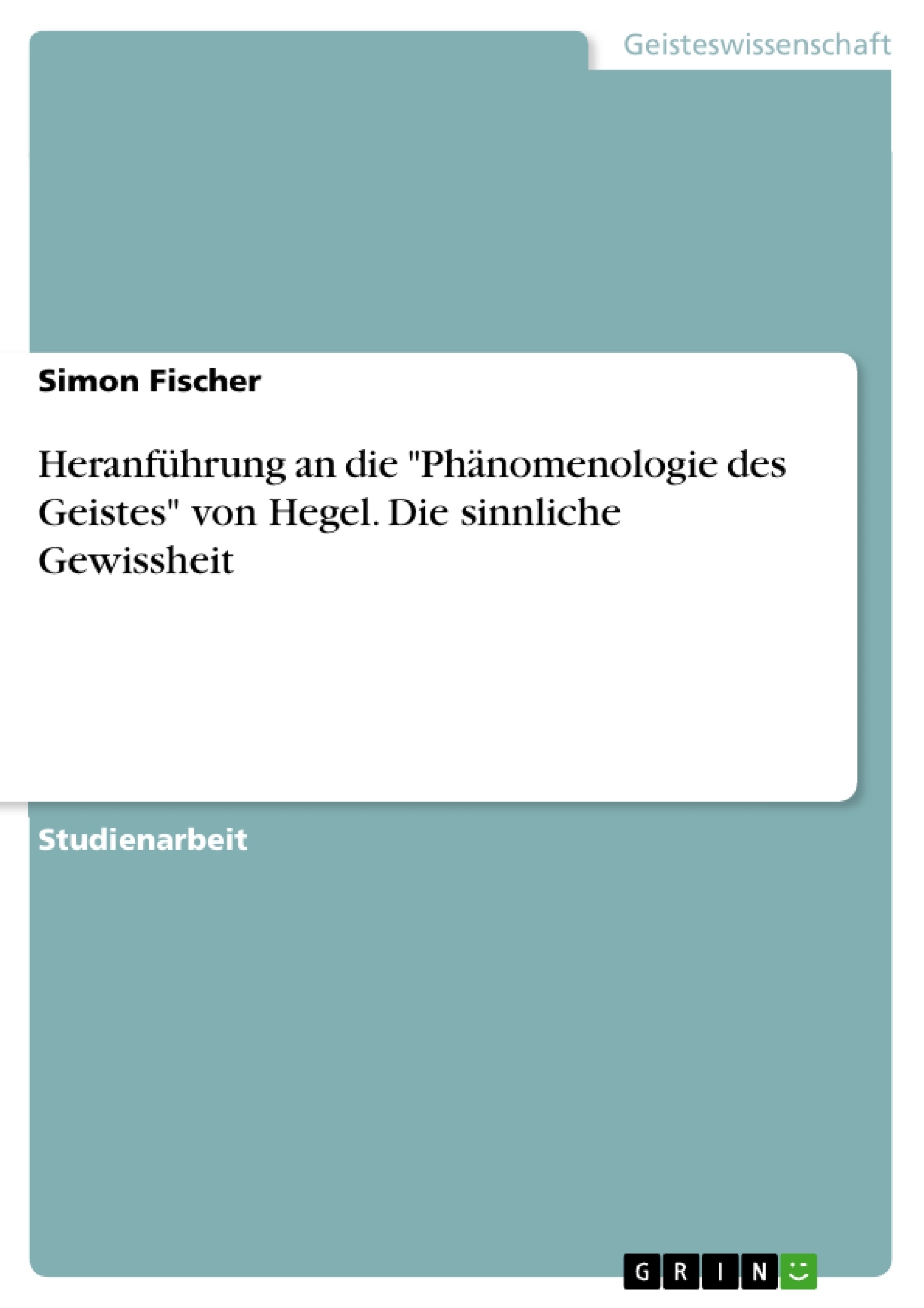
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.