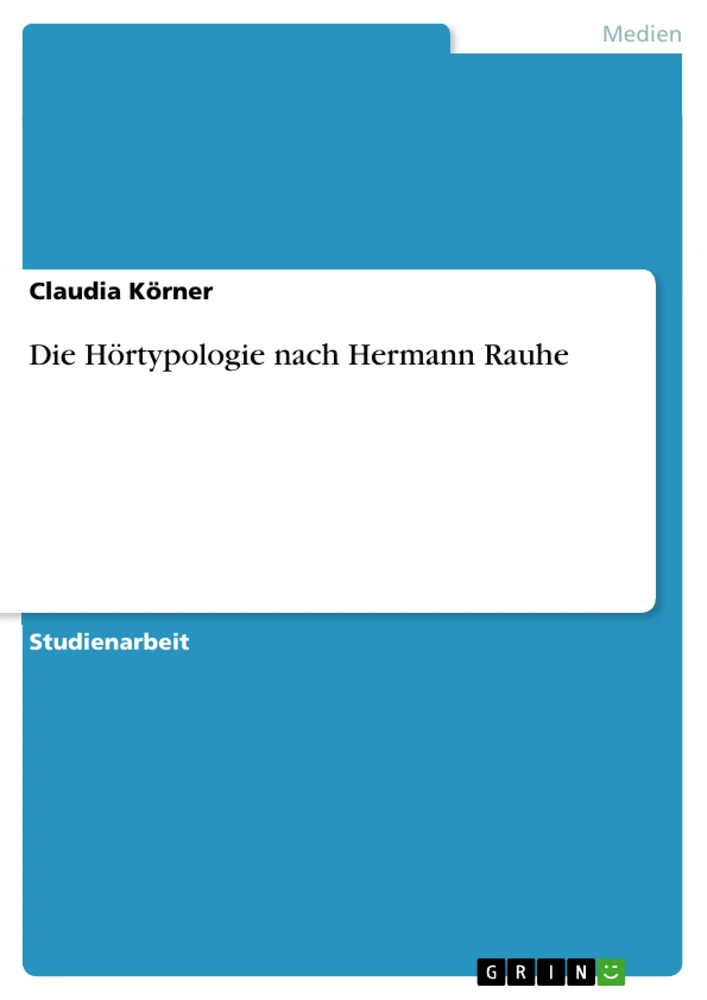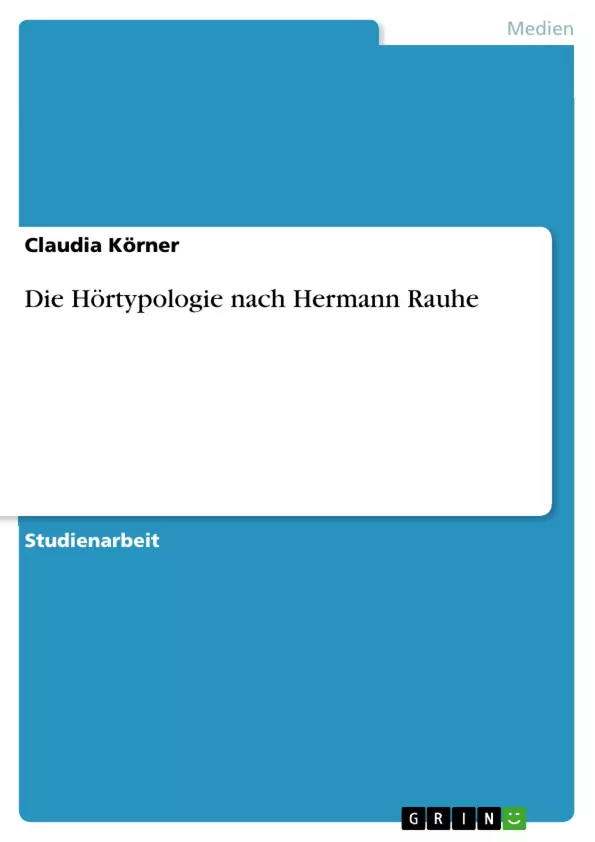Musik gibt es seit dem Beginn der Menschheit. Sie existiert in allen Kulturen und gilt sowohl bei Verhaltensforschern als auch bei Soziologen als wichtiges Medium zur Kommunikation (Liedtke 1985). Keine andere Kunst vermag es, unsere Emotionen auf diese Weise auszudrücken. Dabei ist die Musik aus dem Bedürfnis der Interaktion und Kommunikation heraus entstanden (Zalfen 2012). Diese Verbindung zwischen Musik und Kommunikation versucht die musik-psychologische Wissenschaft zu erforschen. Hierbei spielt die Musikrezeption eine wesentliche Rolle.
Doch in den letzten Jahren hat die Musik einen unverkennbaren Wandel erlebt. (Hasler 2014). Sie hat ihre eigentliche Bedeutung verloren und wird in der Industrie genutzt, um Produkte besser zu vermarkten und unsere Emotionen zu beeinflussen. (Wang 2014). Musik ist allgegenwärtig geworden und der Zusammenhang geht verloren, da wir sie nichtmehr bewusst wahrnehmen (Riggenbach 2000). Sie wird durch elektronische Massenmedien oberflächlich und wir können keinen persönlichen Bezug mehr dazu nehmen. Dennoch zeigt sich, dass gerade in Phasen wie der Pubertät oder der frühen Kindheit die Musik eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Sie ist entscheidend bei der Ausbildung unserer Identität und Entwicklung (Riggenbach, 2000). Es zeigt sich, dass wir im Laufe unseres Lebens Musik bewusst und unbewusst wahrnehmen. Es ist jedoch unklar, auf welche Art und Weise die Musikrezeption wirkt.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Hörtypologie von Hermann Rauhe und die Unterteilung in bewusstes und unbewusstes Hören vorzustellen.
Dafür bedarf es einer theoretischen Grundlage der Musikrezeption. Es werden dafür zunächst die biologischen, physikalischen und lernpsychologischen Grundlagen der Musikwahrnehmung erklärt. Daraufhin wird die Hörtypologie nach Hermann Rauhe vorgestellt und sowohl bewusstes als auch unbewusstes Hören erläutert. Zum Schluss wird dann ein Fazit gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Grundlagen der Musikrezeption
- Biologisch-physiologische Grundlagen
- Physikalische Grundlagen der Musikrezeption
- Lernpsychologische Grundlagen der Musikrezeption
- Hörtypologie nach Hermann Rauhe
- Das unbewusste Hören
- Das bewusste Hören
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, die Hörtypologie von Hermann Rauhe und die Unterscheidung zwischen bewusstem und unbewusstem Hören vorzustellen. Sie erläutert die theoretischen Grundlagen der Musikrezeption, indem sie biologische, physikalische und lernpsychologische Aspekte der Musikwahrnehmung beleuchtet. Die Hörtypologie nach Hermann Rauhe wird anschließend im Detail vorgestellt, wobei sowohl bewusstes als auch unbewusstes Hören beleuchtet werden.
- Die Hörtypologie nach Hermann Rauhe
- Bewusstes und unbewusstes Hören
- Biologische, physikalische und lernpsychologische Grundlagen der Musikrezeption
- Die Rolle der Musik in der Gesellschaft und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Einzelnen
- Der Wandel der Musik im Laufe der Zeit und die Auswirkungen auf die Musikrezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Musik in verschiedenen Kulturen sowie den Wandel der Musikrezeption in den letzten Jahren dar. Sie hebt die Bedeutung der Musik für die Kommunikation und die Entwicklung des Einzelnen hervor. Das erste Kapitel behandelt die allgemeinen Grundlagen der Musikrezeption und umfasst biologisch-physiologische, physikalische und lernpsychologische Aspekte der Musikwahrnehmung.
Schlüsselwörter
Hörtypologie, Hermann Rauhe, Musikrezeption, bewusstes Hören, unbewusstes Hören, biologische Grundlagen, physikalische Grundlagen, lernpsychologische Grundlagen, Musikwahrnehmung.
- Citation du texte
- Claudia Körner (Auteur), 2018, Die Hörtypologie nach Hermann Rauhe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503673