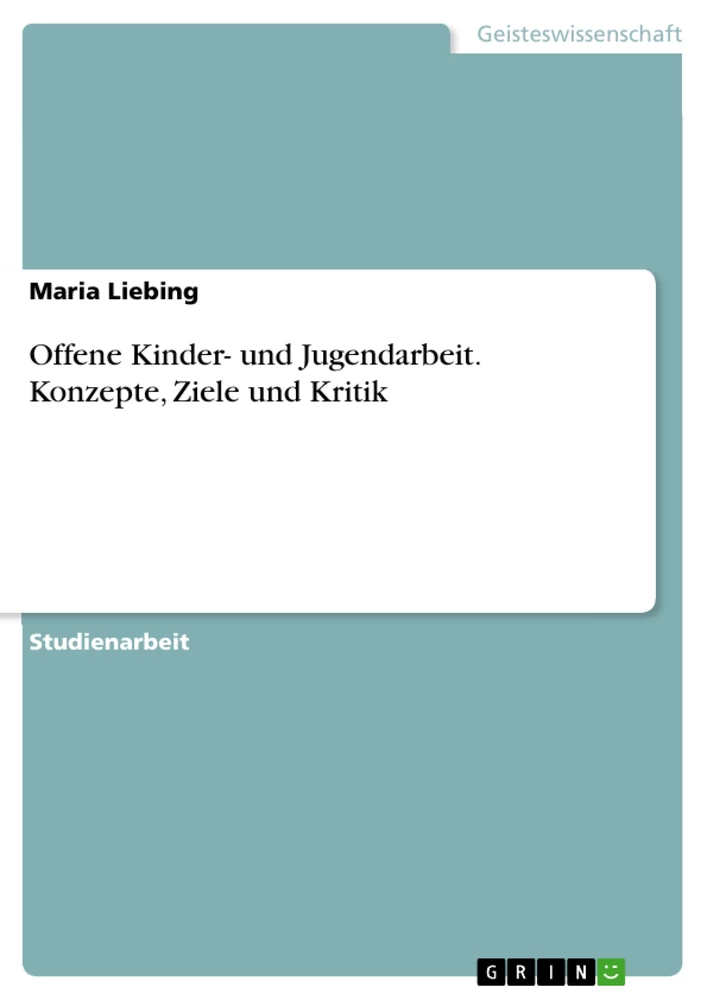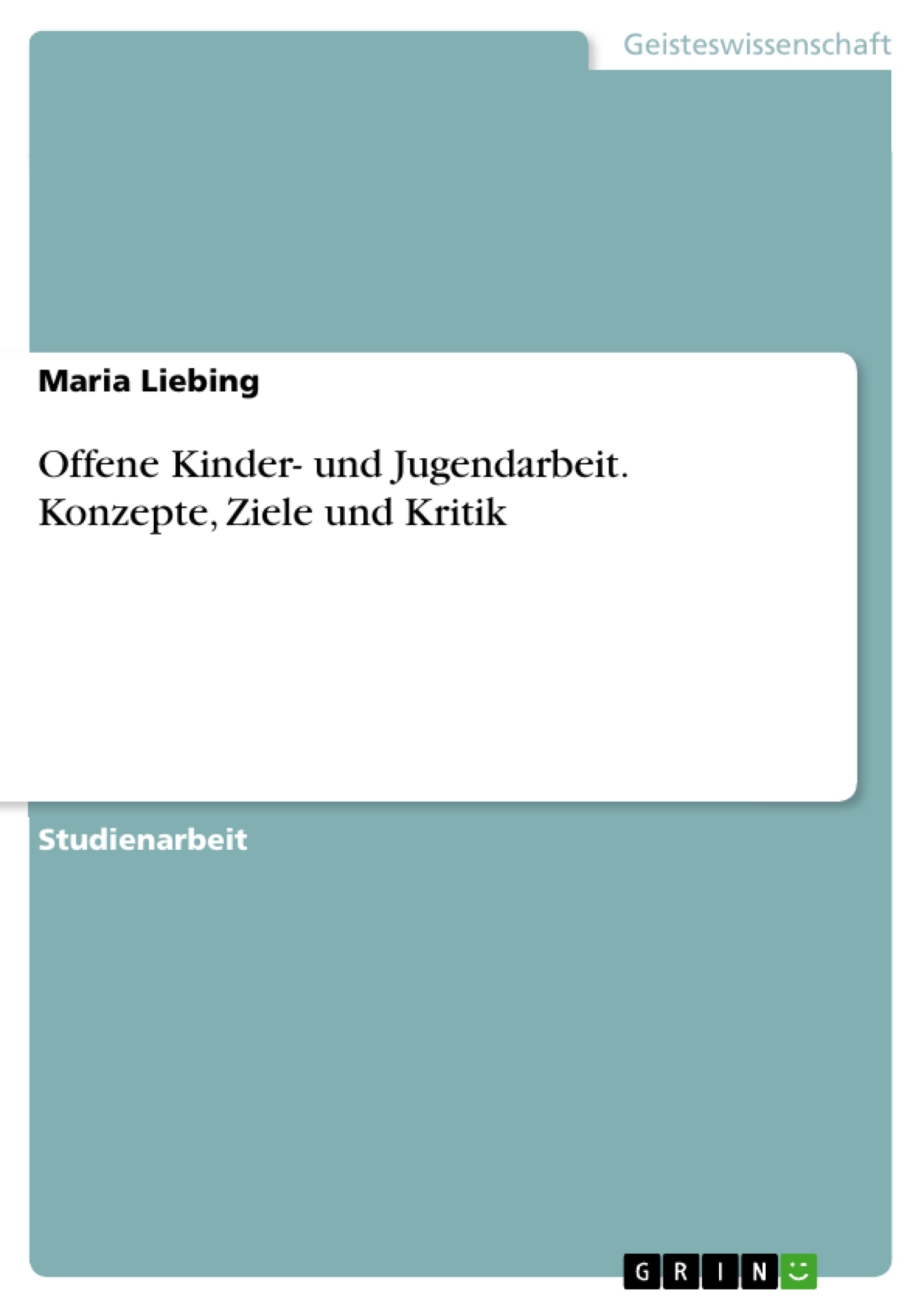"Das alte Konzept der offenen Arbeit, das heißt das Prinzip der Offenheit für alle und jeden, stilisiert im offenen Bereich eines jeden Jugendhauses, in dem sich alle Jugendlichen treffen sollen, geht schon lange an der Wirklichkeit vorbei.“ (Ulrich Deinet) Ziel dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Zitat von Deinet. Hierfür wird zunächst der Begriff "offene Kinder- und Jugendarbeit" näher beleuchtet. Hierzu werden auch die Charakteristika, Prinzipien und Konzepte, die diesem Bereich zugrunde liegen, näher betrachtet. Dabei werden auch die Rechtsgrundlage und die Ziele, die sich daraus für die offene Kinder- und Jugendarbeit ergeben, in den Blick genommen. Anschließend an diese Analyse sollen die aktuelle Situation betrachtet sowie diesbezügliche Kritiken beschrieben werden. Diese Auseinandersetzung soll letztlich dazu führen, das Zitat von Deinet verstehen und einordnen zu können. In diesem Zusammenhang wird auf die Fragen: "Inwieweit ist offene Jugendarbeit noch zeitgemäß? Oder wird sie nicht schon längst funktionalisiert?" eingegangen. Abschließend werden ausblickend weitere Entwicklungsmöglichkeiten und Trends in diesem Arbeitsbereich aufgezeigt.
Die Anfänge der Jugendarbeit waren weniger von Pädagogik und Bildungszielen geprägt. Sie hatten vor allem politischen Charakter. Bis heute gibt es keine einheitliche Definition zur offenen Kinder- und Jugendarbeit als einen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Dies zeigt sich auch in dem sehr bunt aufgestellten Einrichtungsspektrum der offenen Jugendarbeit mit unterschiedlichen theoretischen und konzeptionellen Ausrichtungen, Konzepten und Angeboten. Wenn es keine einheitliche Theorie gibt, so gibt es doch eine fundamentale rechtliche Grundlage und damit einen klaren Rahmen, welcher Ziele und Prinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit festlegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Rechtliche Bestimmungen und Ziele
- § 11 SGB VIII
- Ziele der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Charakteristika und Prinzipien
- Situation heute und Kritik
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Zitat von Deinet, das die Aktualität der offenen Jugendarbeit in Frage stellt. Sie beleuchtet den Begriff „Offene Kinder- und Jugendarbeit“, ihre rechtlichen Grundlagen, Prinzipien und Ziele, sowie die aktuelle Situation und Kritikpunkte. Abschließend werden Entwicklungsmöglichkeiten und Trends aufgezeigt und Deinet's Zitat eingeordnet.
- Definition und historische Entwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Rechtliche Grundlagen und Ziele der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Charakteristika und Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Aktuelle Situation und Herausforderungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Zukünftige Entwicklungen und Trends in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt das Zitat von Deinet vor, welches die Grundlage der Arbeit bildet. Sie umreißt die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
Was ist Offene Kinder- und Jugendarbeit
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff "Offene Kinder- und Jugendarbeit" und geht auf die unterschiedlichen theoretischen und konzeptionellen Ausrichtungen ein. Es betrachtet die Nutzer*innen und ihre sozialen Hintergründe und stellt die Subjekttheorie nach Scherr und den sozialräumlichen Ansatz nach Deinet vor.
Rechtliche Bestimmungen und Ziele
Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere § 11 SGB VIII. Es erläutert die darin festgelegten Ziele, wie die Förderung der Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement junger Menschen.
Charakteristika und Prinzipien
In diesem Kapitel werden die Prinzipien der Freiwilligkeit und Machtarmut in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erläutert. Es wird betont, dass die Angebote niedrigschwellig und attraktiv für die jungen Menschen sein müssen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die rechtliche Grundlage der Offenen Kinder- und Jugendarbeit?
Die fundamentale rechtliche Grundlage ist der § 11 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), der Ziele wie Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement festlegt.
Welche Kernprinzipien kennzeichnen die Offene Jugendarbeit?
Zentrale Prinzipien sind die Freiwilligkeit der Teilnahme, die Niedrigschwelligkeit der Angebote sowie die sogenannte „Machtarmut“, die ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Pädagogen und Jugendlichen fördern soll.
Was besagt die Kritik von Ulrich Deinet zur offenen Arbeit?
Deinet kritisiert, dass das alte Konzept der Offenheit für „alle und jeden“ in Jugendhäusern oft an der Realität vorbeigeht. Die Arbeit untersucht, inwieweit die offene Jugendarbeit heute noch zeitgemäß ist oder bereits funktionalisiert wurde.
Was ist der sozialräumliche Ansatz?
Dieser Ansatz nach Deinet betrachtet die Lebenswelten der Jugendlichen in ihrem konkreten sozialen Umfeld und Raum, um pädagogische Angebote besser auf ihre tatsächlichen Bedürfnisse abzustimmen.
Gibt es eine einheitliche Definition für Offene Jugendarbeit?
Nein, es gibt keine einheitliche Definition, was sich in einem sehr breiten Spektrum an Einrichtungen mit unterschiedlichen theoretischen und konzeptionellen Ausrichtungen widerspiegelt.
- Arbeit zitieren
- Maria Liebing (Autor:in), 2017, Offene Kinder- und Jugendarbeit. Konzepte, Ziele und Kritik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503674