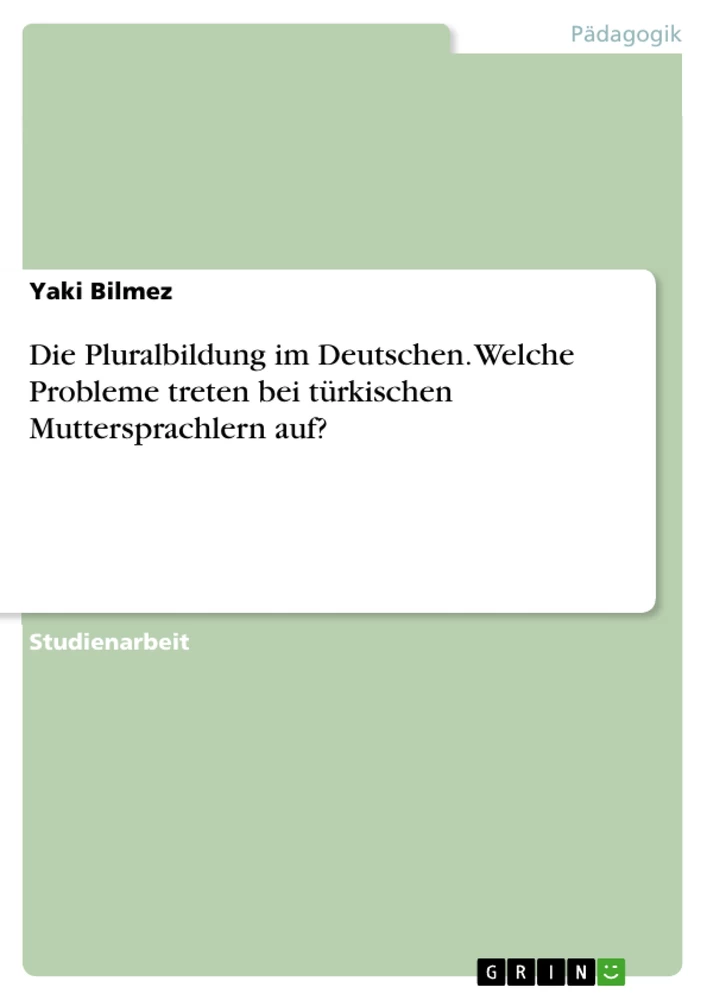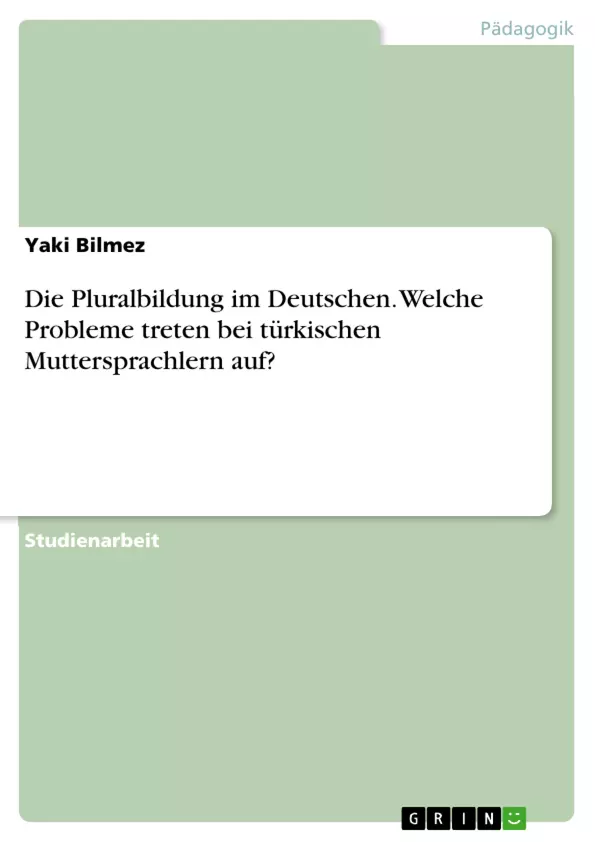Das Ziel dieser Arbeit ist es, sich genauer mit der Bildung und Markierung des Plurals auseinanderzusetzen, um die sprachlichen Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Türkischen zu verdeutlichen. Dazu werden die Formen und Funktionen des Plurals im Verlauf dieser Arbeit an den beiden Sprachen untersucht. Die Arbeit gliedert sich zunächst in Begriffserklärungen wie Kontrastivhypothese, Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb und geht dann näher darauf ein, wie das Pluralsystem im Deutschen und Türkischen funktioniert, um eine gewisse Verständigungsgrundlage für das folgende Kapitel zu verschaffen. Im weiteren Verlauf wird der Gebrauch des Plurals im Türkischen mit dem Deutschen verglichen und mit Beispielen veranschaulicht. Abschließend wird auf den Beispielen basierend folgende Frage beantwortet: Welche Phänomene erscheinen beim Erwerb der Pluralbildung bei Deutschlernern mit Türkisch als Erstsprache?
Durch die zunehmende Globalisierung ist Migration zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden und somit steigen auch die Anforderungen an sprachlichen Kompetenzen, denn diese werden besonders in der Arbeitswelt zu den Schlüsselqualifikationen gezählt. Zudem ist es notwendig, wie Sprachwissenschaftlerin Keim betont, eine angemessene Kommunikationsfähigkeit zu besitzen, wenn man in einer Sprache umfassend handeln will. Im Jahr 2015 lebten 81,4 Millionen Menschen in Deutschland, wovon 17,1 Millionen einen Migrationshintergrund hatten. Von diesen 17,1 Millionen waren 54,6 Prozent Deutsche und 45,4 Prozent Ausländer. Die Migranten müssen sich in einem neuen Land an die neue Kultur anpassen und werden mit einer Fremdsprache konfrontiert.
Dabei stellen die türkischen Lerner gerade im deutschen Raum eine der größten Lerngruppen im Bereich Deutsch als Fremdsprache dar, da sie die größte Ausländergruppe in Deutschland vertreten. Das heißt auch, dass viele Lehrkräfte ihnen in ihrem Arbeitsalltag begegnen und ihnen dabei helfen, die deutsche Sprache zu erlernen. Diese Lerner besitzen in der Regel fast keine Sprachkenntnis der deutschen Sprache und es lässt sich vermuten, dass diese Lerner Schwierigkeiten beim Erwerb der deutschen Sprache haben. Da viele Schwierigkeiten beim Erwerb einer neuen Sprache auftreten können, beschränkt sich diese Arbeit mit der Pluralbildung und den damit verbundenen Problemen bei türkischen Lernern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliches
- 2.1. Grundlegendes zur Spracherwerbsforschung
- 2.2. Kontrastivhypothese
- 2.3. Erstspracherwerb
- 2.4. Zweitspracherwerb
- 3. Deutsches und türkisches Pluralsystem im Vergleich
- 3.1. Pluralsystem im Deutschen
- 3.2. Pluralsystem im Türkischen
- 4. Komplexität der deutschen Pluralbildung für türkischsprachige Deutschlerner
- 5. Ausblick
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die türkischsprachige Lernende beim Erwerb der deutschen Pluralbildung erleben. Ziel ist es, die sprachlichen Unterschiede zwischen dem Deutschen und Türkischen im Hinblick auf die Pluralbildung zu analysieren und die daraus resultierenden Schwierigkeiten für Lerner aufzuzeigen.
- Untersuchung des deutschen und türkischen Pluralsystems im Vergleich
- Analyse der Komplexität der deutschen Pluralbildung für türkischsprachige Lerner
- Identifizierung von Phänomenen im Erwerb der Pluralbildung
- Bedeutung der Kontrastivhypothese für den Zweitspracherwerb
- Einblick in die grundlegenden Aspekte der Spracherwerbsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Pluralbildung im Kontext des Deutschlernens für türkischsprachige Lerner ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der sprachlichen Kompetenzen in der globalisierten Welt und stellt die Herausforderungen für Migranten beim Spracherwerb dar.
Das zweite Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Kontrastivhypothese, Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb, um einen theoretischen Rahmen für die Analyse der Pluralbildung zu schaffen. Es geht dabei auch auf die Begriffe Transfer und Interferenz im Zusammenhang mit dem Spracherwerb ein.
Kapitel drei vergleicht das Pluralsystem des Deutschen und Türkischen, um die sprachlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Dieser Vergleich legt die Grundlage für die Analyse der Schwierigkeiten, die türkischsprachige Lerner beim Erwerb der deutschen Pluralbildung haben.
Kapitel vier untersucht die Komplexität der deutschen Pluralbildung für türkischsprachige Lerner. Es analysiert die Herausforderungen, die sich aus den Unterschieden zwischen den beiden Sprachen ergeben, und geht auf typische Fehler und Schwierigkeiten ein.
Schlüsselwörter
Zweitspracherwerb, Pluralbildung, Kontrastivhypothese, Transfer, Interferenz, Deutsch als Fremdsprache, Türkisch als Erstsprache, Spracherwerbsforschung, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben türkische Muttersprachler Probleme mit dem deutschen Plural?
Das deutsche Pluralsystem ist mit seinen vielen Endungen und Umlauten deutlich komplexer als das regelmäßige türkische System.
Was besagt die Kontrastivhypothese?
Sie geht davon aus, dass Unterschiede zwischen Erst- und Zweitsprache zu Lernschwierigkeiten (Interferenzen) führen, während Gemeinsamkeiten das Lernen erleichtern (Transfer).
Wie funktioniert der Plural im Türkischen?
Im Türkischen wird der Plural sehr regelmäßig durch die Suffixe -lar oder -ler gebildet, was einen starken Kontrast zum Deutschen darstellt.
Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitspracherwerb?
Die Arbeit definiert diese Begriffe im Rahmen der Spracherwerbsforschung, um die spezifischen Hürden für Migranten zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt die Globalisierung für den Spracherwerb?
Durch Migration steigen die Anforderungen an sprachliche Kompetenzen, da diese als Schlüsselqualifikation in der Arbeitswelt gelten.
- Citar trabajo
- Yaki Bilmez (Autor), 2018, Die Pluralbildung im Deutschen. Welche Probleme treten bei türkischen Muttersprachlern auf?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503744