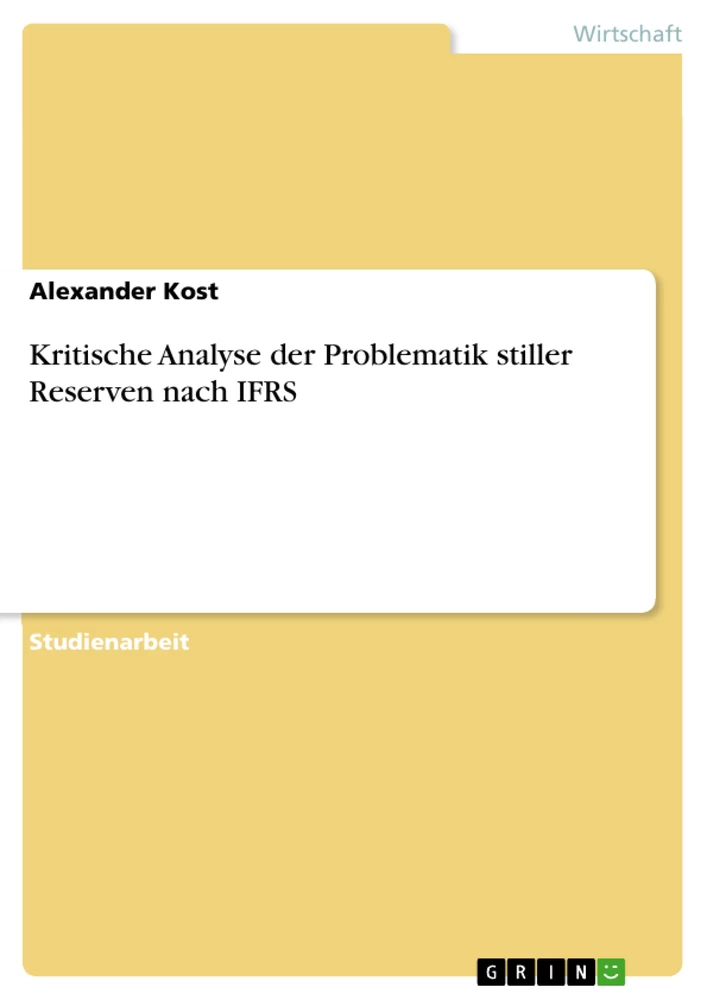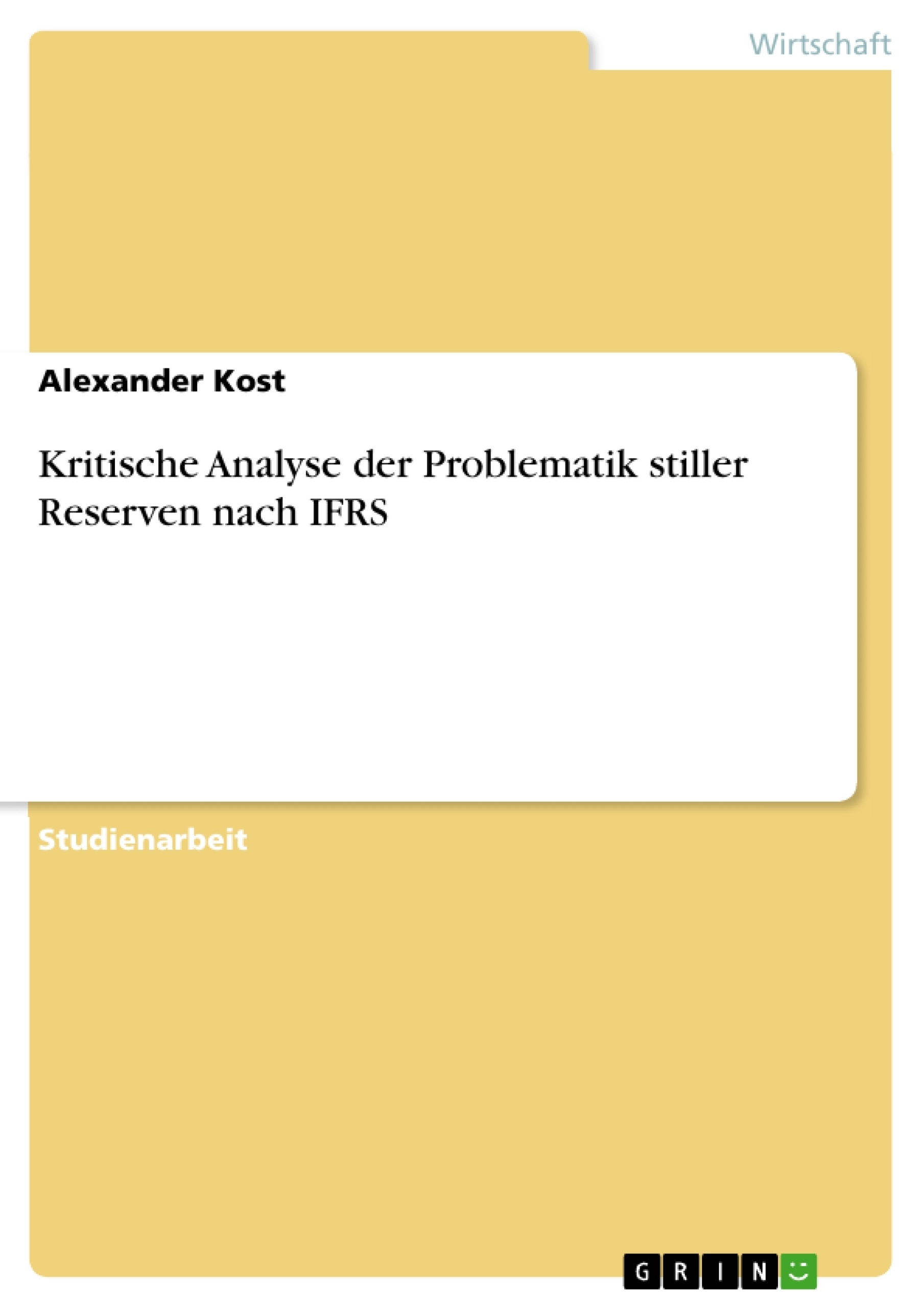Die traditionelle deutsche Rechnungslegung nach HGB weist offenkundig zahlreiche Schwachpunkte auf, die u. a. auf die Anwendung des im HGB-Abschluss ausgeprägten Vorsichtsprinzips zurückzuführen sind. Über die Berücksichtigung der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften wird durch die Möglichkeit der Legung stiller Reserven bisher großer Einfluss auf den Vermögens- und Erfolgsausweis genommen. Dies führt zu einer Verzerrung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und wirkt sich aus der Sicht eines (potentiellen) Investors negativ auf dessen Investitionsentscheidung aus. Aus diesem Grund wird die Forderung nach einer Vereinheitlichung der internationalen Rechnungslegung zunehmend schärfer.
Die Existenz stiller Reserven und die damit verbundene unvollständige Darstellung der Vermögens- und Ertragssituation haben daher zu einer intensiven Diskussion um die Internationalisierung des deutschen Rechnungslegungssystems geführt. Vor diesem Hintergrund erfreuen sich die internationalen Rechnungslegungsnormen, wie z. B. die IFRS, zunehmender Beliebtheit.
Bei den IFRS handelt es sich, im Gegensatz zum gläubigerschutzorientierten HGB, um ein informationsspezifiziertes Rechnungslegungssystem mit prognostischem Charakter. Es soll u. a. (potentiellen) Investoren einen tiefen Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens geben, was eigentlich die Vermeidung stiller Reserven implizieren sollte. Aufgrund dieser Zielrichtung sind die IFRS daher oft mit der Voreinschätzung verbunden, nicht durch stille Reserven verzerrt zu sein.
In dieser Arbeit soll zunächst die Entstehung stiller Reserven dargestellt werden. Anhand ausgewählter IFRS-Standards wird aufzeigt, dass auch im IFRS-Jahresabschluss erhebliche Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven, u. a. durch die Berücksichtigung des fair value als Bewertungsmaßstab, bestehen und somit die Bilanzanalyse auch in Zukunft erheblich erschwert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Problemdarstellung
- 2 Entstehungsmöglichkeiten stiller Reserven
- 3 Ausgewählte bilanzielle Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Anlagevermögen nach IFRS
- 3.1 Sachanlagen (IAS 16)
- 3.1.1 Klassifizierung
- 3.1.2 Möglichkeiten der Entstehung stiller Reserven
- 3.2 Immaterielle Vermögenswerte (IAS 38)
- 3.2.1 Klassifizierung
- 3.2.2 Möglichkeiten der Entstehung stiller Reserven
- 4 Ausgewählte bilanzielle Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Umlaufvermögen nach IFRS (hier: Vorräte nach IAS 2)
- 4.1 Klassifizierung
- 4.2 Möglichkeiten der Entstehung stiller Reserven
- 5 Ausgewählte bilanzielle Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Fremdkapital nach IFRS (hier: Rückstellungen nach IAS 37)
- 5.1 Klassifizierung
- 5.2 Möglichkeiten der Entstehung stiller Reserven
- 6 Zusammenfassende Wertung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist eine kritische Analyse der Problematik stiller Reserven im Kontext der International Financial Reporting Standards (IFRS). Dabei wird insbesondere untersucht, inwiefern die IFRS trotz ihrer informationsspezifischen Ausrichtung und des prognostischen Charakters die Bildung stiller Reserven ermöglichen. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Entstehungsmöglichkeiten stiller Reserven und beleuchtet ausgewählte bilanzielle Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Fremdkapital nach IFRS.
- Die Entstehung von stillen Reserven und die Unterscheidung zwischen Ansatzreserven und Bewertungsreserven.
- Die Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Anlagevermögen nach IFRS, insbesondere im Hinblick auf Sachanlagen (IAS 16) und immaterielle Vermögenswerte (IAS 38).
- Die Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Umlaufvermögen nach IFRS, insbesondere im Hinblick auf Vorräte nach IAS 2.
- Die Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Fremdkapital nach IFRS, insbesondere im Hinblick auf Rückstellungen nach IAS 37.
- Die Bedeutung des Fair Value als Bewertungsmaßstab im Kontext stiller Reserven.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problematik stiller Reserven im Kontext des traditionellen deutschen Rechnungslegungsstandards (HGB) und der zunehmenden Bedeutung der Internationalisierung der Rechnungslegung. Kapitel zwei beschäftigt sich mit den verschiedenen Entstehungsarten stiller Reserven, die in Ansatzreserven und Bewertungsreserven unterteilt werden. Die Kapitel drei, vier und fünf untersuchen anhand von ausgewählten IFRS-Standards die Möglichkeiten zur Legung stiller Reserven im Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Fremdkapital. Dabei wird der Fokus auf die jeweilige Klassifizierung der relevanten Vermögenswerte und die Berücksichtigung des Fair Value als Bewertungsmaßstab gelegt. Die Arbeit endet mit einer zusammenfassenden Wertung der Problematik stiller Reserven im Kontext der IFRS.
Schlüsselwörter
Stille Reserven, IFRS, HGB, Rechnungslegung, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Fremdkapital, Fair Value, Sachanlagen, Immaterielle Vermögenswerte, Vorräte, Rückstellungen, Bilanzanalyse.
- Arbeit zitieren
- Alexander Kost (Autor:in), 2006, Kritische Analyse der Problematik stiller Reserven nach IFRS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50387