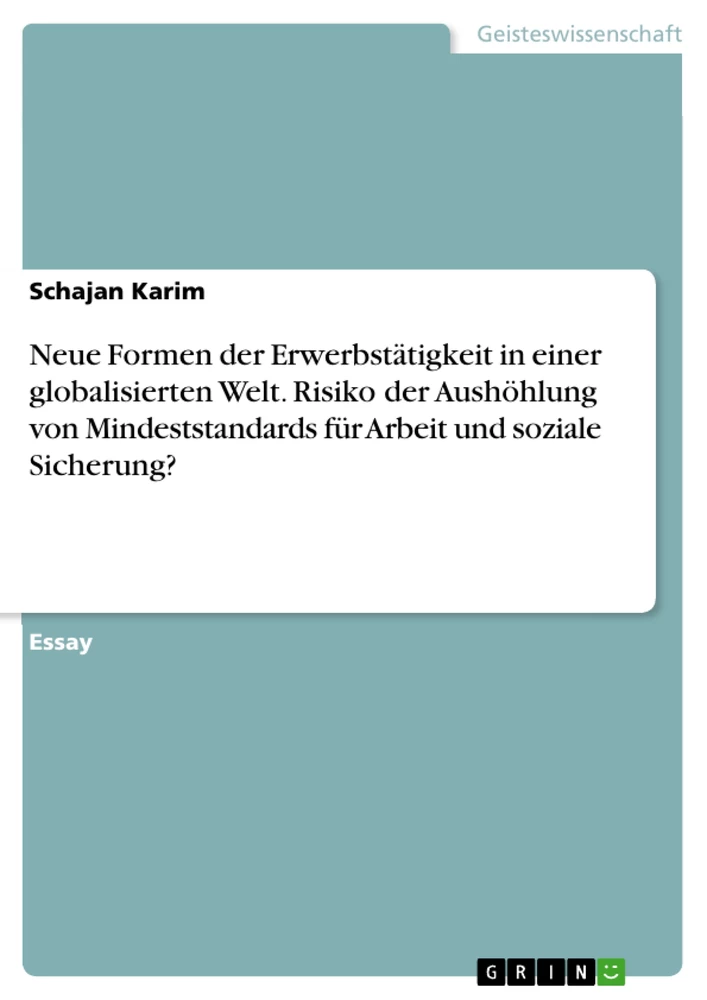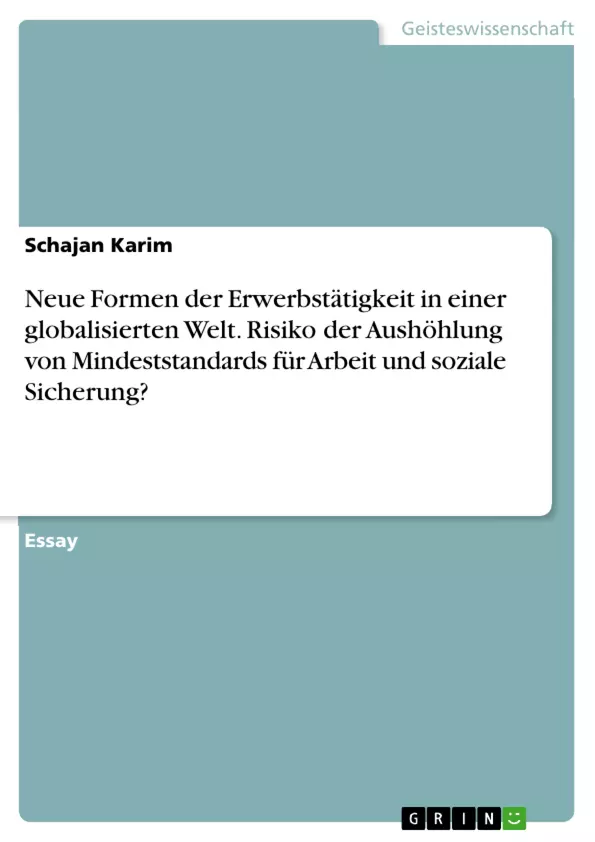Die vorliegende, wissenschaftliche Arbeit soll den Artikel „Neue Formen der Erwerbstätigkeit in einer globalisierten Welt: Risiko der Aushöhlung von Mindeststandards für Arbeit und soziale Sicherung?“ von Annette Niederfranke und Malte Drewes kurz und prägnant analysieren und reflektieren. Dabei wird zunächst der Inhalt des Artikels komprimiert wiedergegeben, um ein Basisverständnis für die weiteren Analysepunkte zu schaffen. Anschließend werden die zentralen Fragestellungen klamüsert. Diese geben einen Überblick auf die folgenden angeführten Theorien der AutorInnen. Anknüpfend wird offengelegt, welchen Hypothesen der Artikel zugrunde lag und wie die Herangehensweise der Bearbeitung dieser erfolgte. Zuletzt werden die Argumentationslinien angeführt und um das ganze abzurunden, die Hauptargumente resümiert sowie ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Thema des Artikels
- Zentrale Fragestellungen
- Theorien der AutorInnen
- Hypothesen und Methodik der Hypothesenbehandlung
- Argumentationslinien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Artikel von Annette Niederfranke und Malte Drewes analysiert die Auswirkungen der Globalisierung, Automatisierung und Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Er beschäftigt sich mit der Frage, ob diese Entwicklungen zu einer Aushöhlung von Mindeststandards für Arbeit und soziale Sicherung führen könnten.
- Neue Formen der Erwerbstätigkeit in der globalisierten Welt
- Risiken für die soziale Sicherung
- Rolle der Plattformökonomie
- Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und ihre Ziele
- Demographische Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
2. Thema des Artikels
Der Artikel beleuchtet die Veränderungen in der Arbeitswelt, die durch neue, atypische Arbeitsformen wie Teilzeit- und Rufbereitschaft, Leiharbeit, Solo-Selbständigkeit und Arbeit in der Gig Ökonomie entstehen. Außerdem werden demographische Entwicklungen und der technologische Wandel im Zusammenhang mit der Plattformökonomie betrachtet.
3. Zentrale Fragestellungen
Der Artikel stellt Fragen zum Einfluss der Globalisierung, Digitalisierung und Mechanisierung auf die soziale Sicherung und die Kernarbeitsnormen der ILO.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Artikels sind: Globalisierung, Digitalisierung, Automatisierung, Plattformökonomie, Arbeit, Soziale Sicherung, Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Atypische Arbeitsformen, Mindeststandards.
Häufig gestellte Fragen
Was sind atypische Arbeitsformen in der globalisierten Welt?
Dazu gehören Teilzeit- und Rufbereitschaft, Leiharbeit, Solo-Selbständigkeit sowie Tätigkeiten in der Gig- und Plattformökonomie.
Besteht die Gefahr einer Aushöhlung von Mindeststandards?
Die Arbeit untersucht das Risiko, dass durch Globalisierung und Digitalisierung soziale Sicherungssysteme und Kernarbeitsnormen geschwächt werden könnten.
Welche Rolle spielt die ILO (Internationale Arbeitsorganisation)?
Die ILO setzt Kernarbeitsnormen fest, deren Einhaltung durch neue Erwerbsformen wie die Plattformökonomie zunehmend herausgefordert wird.
Wie beeinflusst die Demografie die soziale Sicherung?
Demografische Entwicklungen verschärfen den Druck auf die sozialen Sicherungssysteme, während gleichzeitig die Erwerbsbiografien instabiler werden.
Was ist das Fazit von Niederfranke und Drewes?
Der Artikel plädiert für eine Anpassung der sozialen Sicherungssysteme, um auch in einer digitalisierten und globalisierten Welt Mindeststandards für alle Erwerbstätigen zu garantieren.
- Quote paper
- Schajan Karim (Author), 2019, Neue Formen der Erwerbstätigkeit in einer globalisierten Welt. Risiko der Aushöhlung von Mindeststandards für Arbeit und soziale Sicherung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504002