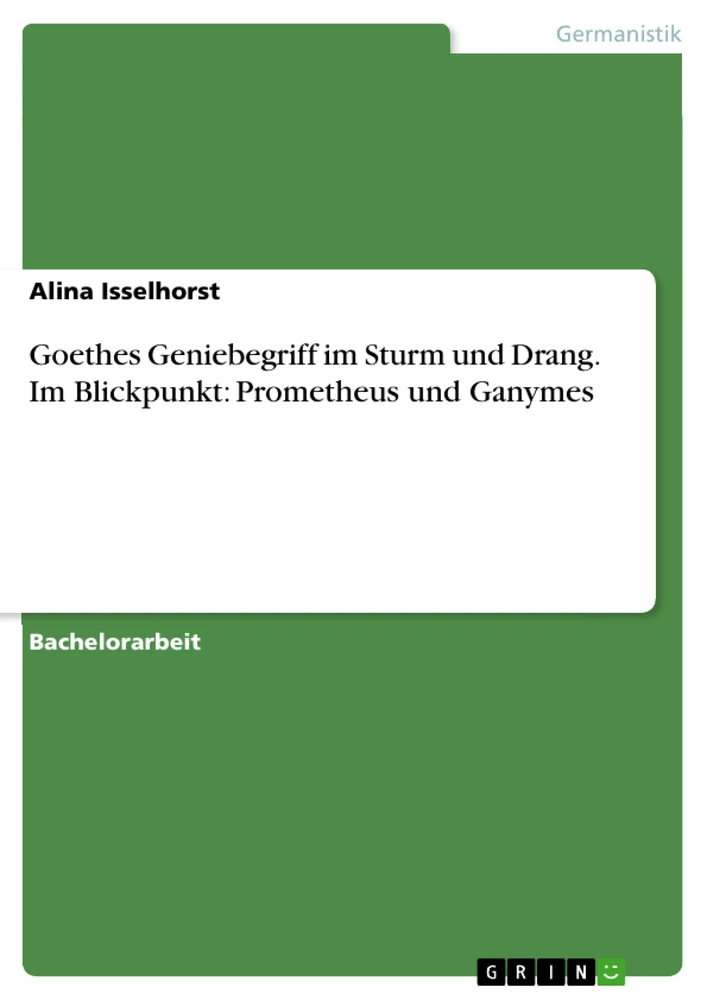Die literarische Epoche des Sturms und Drangs wird nicht ohne Grund auch als Geniezeit bezeichnet. Die Beschäftigung mit dem Geniebegriff erreichte im 18. Jahrhundert vor allem durch das neue Lebensgefühl der Stürmer und Dränger ihren Höhepunkt. Für sie standen die Kreativität und die Loslösung von bisherigen Autoritäten im Fokus. Sie sahen als Genie eine Person an, die sich aus eigenen Fähigkeiten in ihrem Kunstwerk selbst verwirklicht, ohne sich dabei von autoritären Einflüssen und Regeln bestimmen oder beeinflussen zu lassen. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe, welcher heutzutage selber als Universalgenie bekannt ist, hat sich reichlich mit dem Geniegedanken beschäftigt. Den Anstoß dafür boten unter anderem die Treffen mit Johann Gottfried Herder und die Beschäftigung mit seinem Genie- Exempel William Shakespeare.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorieteil
2.1 Der Geniebegriff- theoretische und geschichtliche Grundlagen
2.2 Shakespeare
2.2.1 Shakespeare als Genie- Paradigma
2.2.2 Goethes Rede „Zum Shäkespears Tag“ aus dem Jahr 1771
2.3 Goethes Hymnen um 1770 als Höhepunkt der Geniezeit unter dem Einfluss Pindars
2.4 Zusammenfassung des Theorieteils
3. Gedichtanalysen unter Einbezug des Theorieteils
3.1 Prometheus
3.1.1 Das Gedicht
3.1.2 Veröffentlichung des Gedichts und die mythologische Figur Prometheus
3.1.3 Interpretation des Gedichts vor dem Hintergrund des Geniegedankens im Sturm und Drang
3.2 Ganymed
3.2.1 Das Gedicht
3.2.2 Veröffentlichung des Gedichts und die mythologische Figur Ganymed
3.2.3 Interpretation des Gedichts vor dem Hintergrund des Geniegedankens im Sturm und Drang
3.3 Vergleich beider Gedichte
3.4 Zusammenfassung der Gedichtanalysen
4. Ausblick
5. Literaturverzeichnis
-
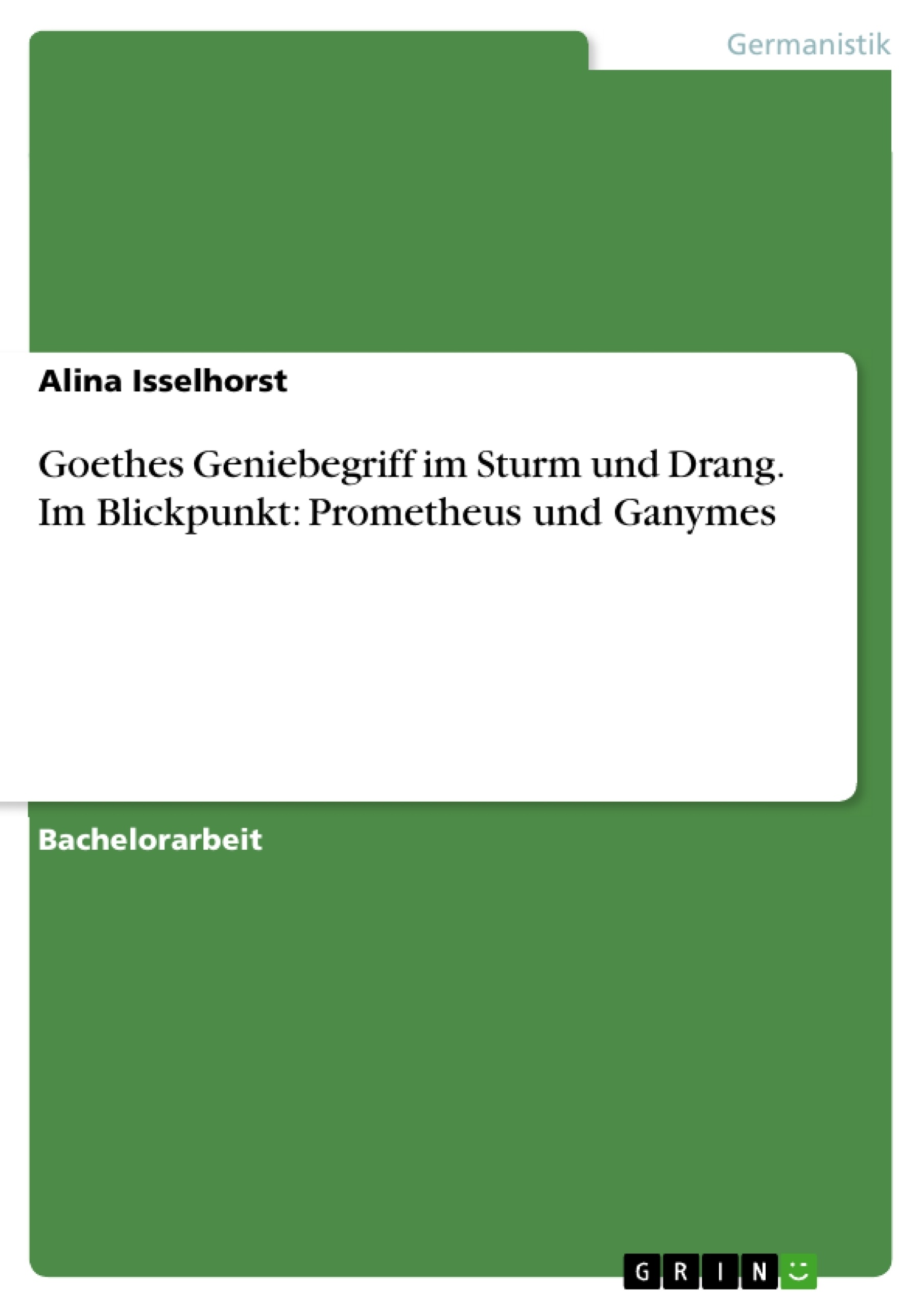
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.