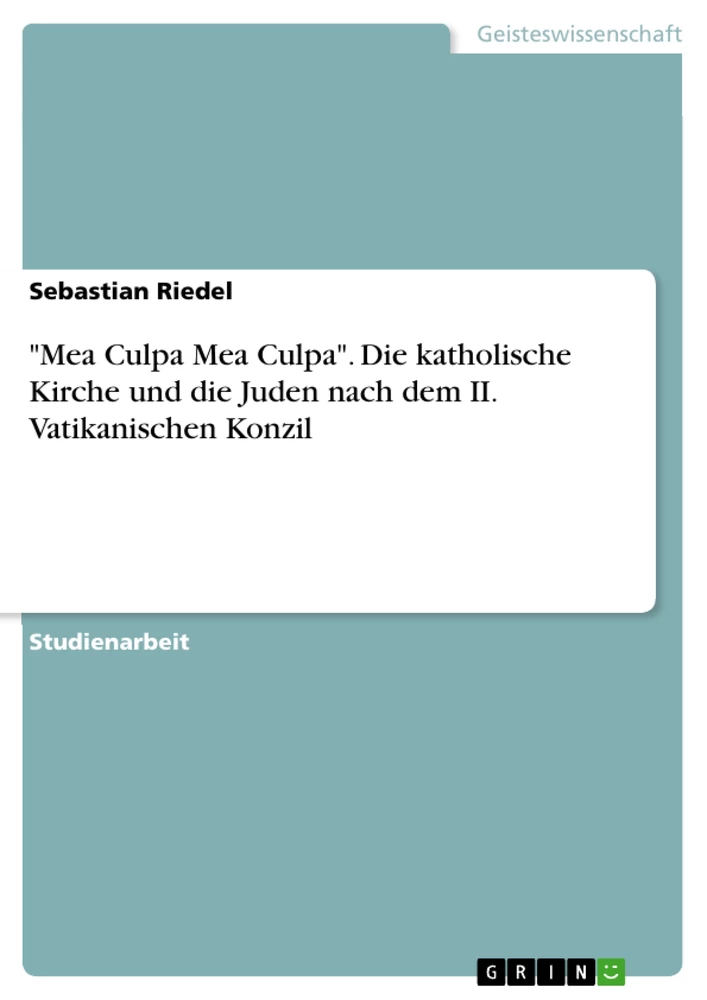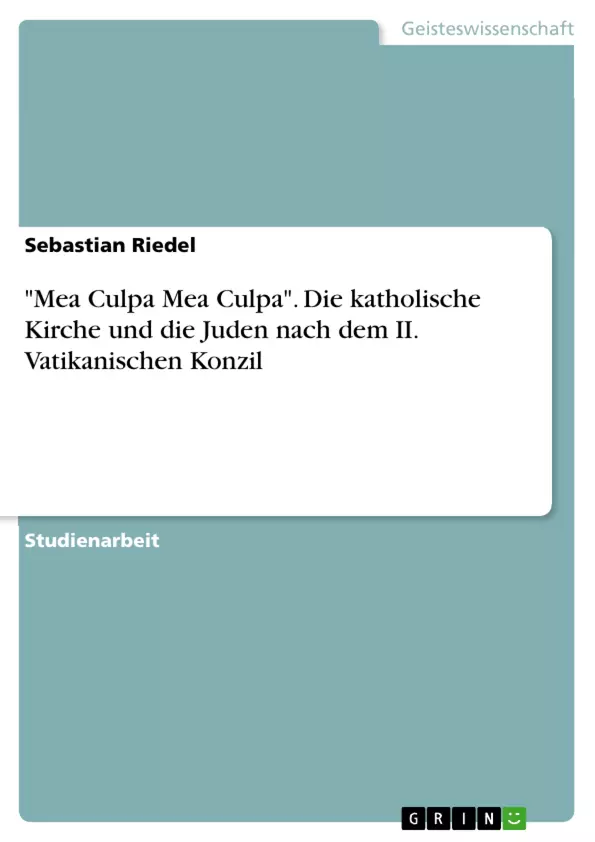Bei der Vorabrecherche zu dieser Arbeit hat sich schnell gezeigt, dass man um die Konzilserklärung des zweiten Vatikanischen Konzils, "über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen" nicht umhinkommt, will man sich mit dem Thema befassen. Zu grundlegend und radikal war der Wandel im Verhältnis der Kirche zum Judentum, der mit der Promulgation dieses Dokuments im Oktober 1965 eingeleitet wurde. Ziel dieser Hausarbeit ist demnach zunächst ein Blick auf die Entstehungsgeschichte von Nostra Aetate, um anhand dessen den historischen und politischen Kontext herauszuarbeiten. In weiterer Folge und vor dem Hintergrund der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse sollen dann die theologischen "Knackpunkte" der Erklärung zur Sprache kommen. Wenngleich es in Anbetracht des Themas wünschenswert wäre, auch eine umfassende Wirkungsgeschichte von Nostra Aetate darzulegen, so kann dies im Rahmen dieser Hausarbeit, aus Gründen begrenzten Umfangs, nicht geleistet werden. In der Conclusio sollen künftige Entwicklungen dennoch wenigstens kurz zur Sprache kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung & Vorwort
- 1.1. Vorwort zur vorliegenden Hausarbeit
- 1.2. Thematischer Einstieg
- 2. Vorgeschichte von Nostra Aetate
- 2.1. Papst Johannes XXIII.
- 2.2. Jules Isaac
- 2.3. Haltung „der Juden“ zum Konzil
- 2.4. Entstehung von Konzilstexten
- 3. Die Entstehungsgeschichte von Nostra Aetate
- 3.1. Die Geburtsstunde von Nostra Aetate
- 3.2. Die Wardi-Affäre
- 3.3. Die Judenerklärung im Ökumenismus-Schema
- 3.4. Die Judenerklärung im Kirchen-Schema
- 4. Theologie
- 5. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die katholische Kirche und ihr Verhältnis zum Judentum nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, insbesondere im Kontext der Konzilsdeklaration Nostra Aetate. Die Arbeit analysiert die Entstehungsgeschichte von Nostra Aetate, beleuchtet den historischen und politischen Kontext und untersucht die theologischen Kernpunkte der Erklärung. Der begrenzte Umfang verhindert eine umfassende Wirkungsanalyse, jedoch werden zukünftige Entwicklungen kurz angesprochen.
- Die Entstehungsgeschichte von Nostra Aetate und der Einfluss wichtiger Persönlichkeiten wie Papst Johannes XXIII. und Jules Isaac.
- Der historische und politische Kontext der Erklärung, einschließlich der Shoah und des vorherigen antijüdischen Klimas innerhalb der Kirche.
- Die theologischen Kernpunkte von Nostra Aetate und deren Bedeutung für das Verhältnis zwischen Katholizismus und Judentum.
- Die Rolle des Zweiten Vatikanischen Konzils im Wandel des katholischen Verständnisses vom Judentum.
- Ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im jüdisch-katholischen Dialog.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung & Vorwort: Die Einleitung führt in das Thema „Mea Culpa Mea Culpa - Die katholische Kirche und die Juden nach dem II. Vatikanischen Konzil“ ein und beschreibt den Kontext der Hausarbeit, die im Rahmen eines Seminars an der Universität Salzburg verfasst wurde. Der thematische Einstieg betont die zentrale Bedeutung von Nostra Aetate für das Verständnis des Verhältnisses zwischen Kirche und Judentum nach dem Konzil und skizziert den Aufbau der Arbeit: die Entstehungsgeschichte von Nostra Aetate, die theologischen Aspekte und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Der begrenzte Umfang der Arbeit wird ebenfalls erwähnt.
2. Vorgeschichte von Nostra Aetate: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte der Konzilsdeklaration Nostra Aetate. Es beschreibt die überraschende Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils im Kontrast zum Ersten Vatikanischen Konzil und hebt die wichtigen historischen Ereignisse und gesellschaftlichen Veränderungen hervor, die zur Notwendigkeit eines solchen Konzils beitrugen, insbesondere die Shoah und die jahrhundertelange antijüdische Haltung vieler Christen. Die Rolle von Papst Johannes XXIII. und seine Bemühungen um die christliche Einheit und die Verbesserung des Verhältnisses zum Judentum werden ausführlich dargestellt, ebenso wie der Einfluss des französischen Historikers Jules Isaac und seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem christlichen Antisemitismus.
Häufig gestellte Fragen zu „Mea Culpa Mea Culpa - Die katholische Kirche und die Juden nach dem II. Vatikanischen Konzil“
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht das Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, insbesondere im Kontext der Konzilsdeklaration Nostra Aetate. Sie analysiert die Entstehungsgeschichte, den historischen und politischen Kontext und die theologischen Kernpunkte der Erklärung.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte von Nostra Aetate, den Einfluss wichtiger Persönlichkeiten wie Papst Johannes XXIII. und Jules Isaac, den historischen und politischen Kontext (einschließlich der Shoah und des vorherigen antijüdischen Klimas), die theologischen Kernpunkte von Nostra Aetate und deren Bedeutung für das Verhältnis zwischen Katholizismus und Judentum, die Rolle des Zweiten Vatikanischen Konzils im Wandel des katholischen Verständnisses vom Judentum und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im jüdisch-katholischen Dialog.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung & Vorwort, Vorgeschichte von Nostra Aetate, Die Entstehungsgeschichte von Nostra Aetate, Theologie und Conclusio. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Die Kapitel zur Vor- und Entstehungsgeschichte beleuchten den historischen und politischen Kontext sowie wichtige Persönlichkeiten. Die Theologie wird behandelt und abschließend ein Ausblick gegeben.
Welche Personen spielen eine wichtige Rolle in der Hausarbeit?
Papst Johannes XXIII. und Jules Isaac spielen eine zentrale Rolle als einflussreiche Persönlichkeiten, die die Entwicklung von Nostra Aetate maßgeblich beeinflusst haben.
Welchen Zeitraum umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Zeit um das Zweite Vatikanische Konzil und die Folgen der Deklaration Nostra Aetate für das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem Judentum. Sie betrachtet sowohl die Vorgeschichte als auch einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Quellen werden in der Hausarbeit verwendet? (Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn die Originalquelle die Quellenangaben enthält).
Diese Information ist in dem gegebenen Textausschnitt nicht enthalten. Die Quellenangaben sind in der vollständigen Hausarbeit zu finden.
Wo wurde die Hausarbeit verfasst?
Die Hausarbeit wurde im Rahmen eines Seminars an der Universität Salzburg verfasst.
Welche Limitationen weist die Arbeit auf?
Der begrenzte Umfang der Arbeit verhindert eine umfassende Wirkungsanalyse von Nostra Aetate. Zukünftige Entwicklungen werden nur kurz angesprochen.
- Quote paper
- Sebastian Riedel (Author), 2016, "Mea Culpa Mea Culpa". Die katholische Kirche und die Juden nach dem II. Vatikanischen Konzil, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504096