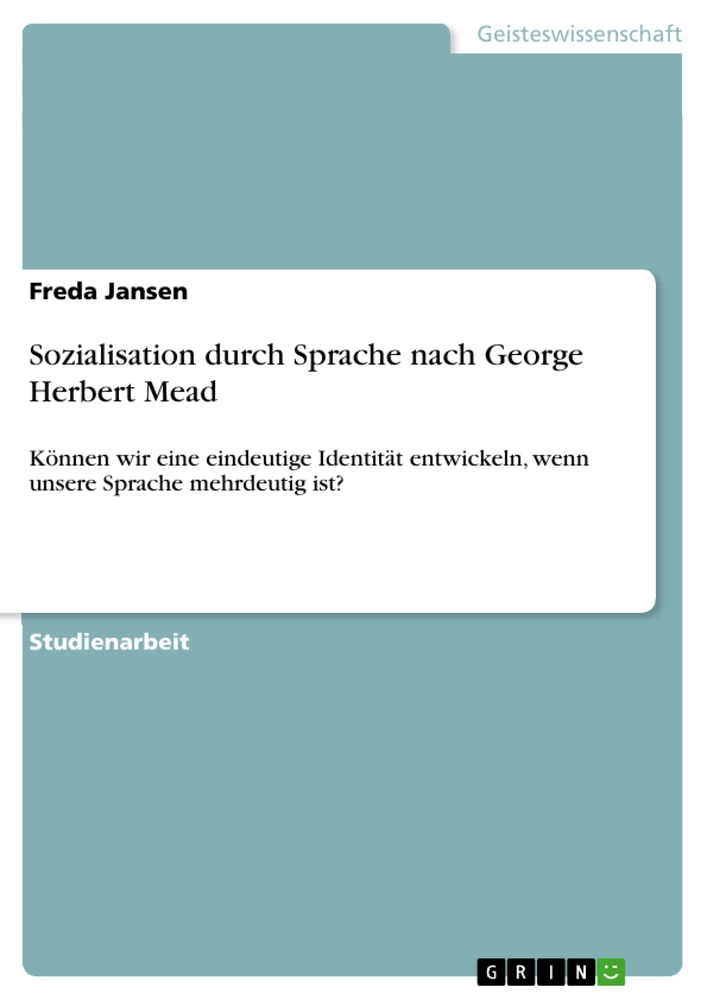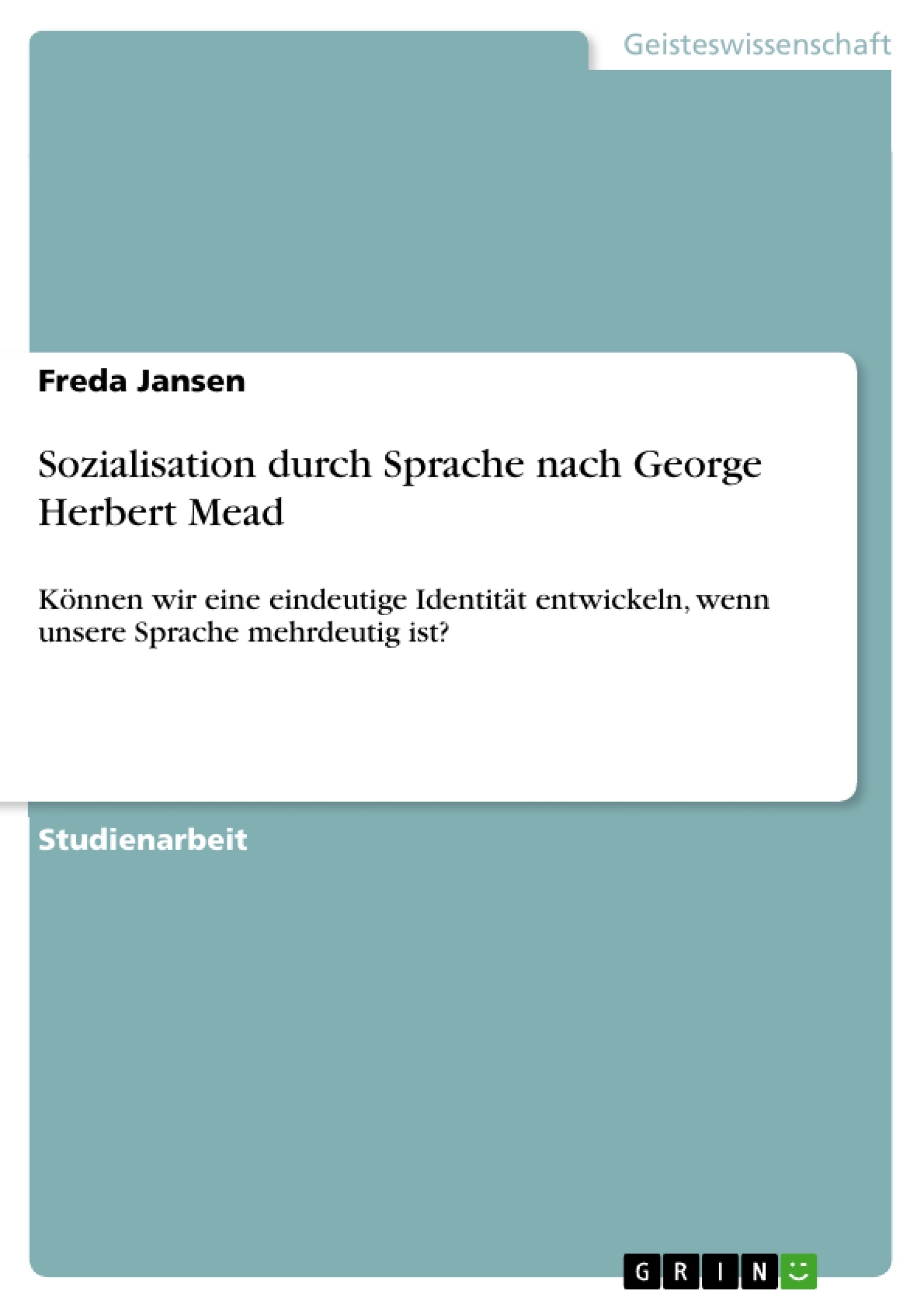Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Sprachentstehungstheorie von George Herbert Mead. Als Forschungsgrundlage bezieht sie sich im Wesentlichen auf das Buch "Geist, Identität und Gesellschaft" von George Herbert Mead. Auf Grundlage der daraus gewonnenen Eindrücke hat sich folgende Leitfrage ergeben: Können wir eine eindeutige Identität entwickeln, wenn unsere Sprache mehrdeutig ist? Da es verschiedene Arten gibt, wie ein Wort mehrdeutig aufgefasst werden kann, beschränkt sich die Autorin auf eine Art und Weise. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Äquivokation, also den Umstand, dass zwei Wörter gleich klingen, aber je nach Gebrauch und Auffassung des Empfängers unterschiedliche Bedeutungen haben können. Auch laut Baumgart gibt es verschiedene Arten der Sprache. Die Sprache der Gesten, die Sprache des Mienenspiels und die Sprache der Worte oder die vokale Geste. Letztere ist das, worauf sich diese Hausarbeit im Kern bezieht und die mit der Äquivokation einhergeht.
Mead sieht die Identität als "Objekt für sich selbst" an. Die Identität eines Menschen ist nichts, was eins mit dem Körper ist, sondern abgegrenzt davon zu betrachten. Des Weiteren ist die Identität eines Menschen nicht von Geburt an vorhanden, sondern entwickelt sich erst im Laufe seines Lebens durch einen gesellschaftlichen Prozess, in dem der Mensch Erfahrungen macht und Tätigkeiten ausführt. Diese Erfahrungen werden im Austausch mit der Gruppe (oder anderen Individuen) gemacht, in der sich jener Mensch befindet oder der er sich zuordnet. Je nach diesem Umfeld entwickelt sich die Identität eines jeden Einzelnen verschieden, beziehungsweise übernimmt man bestimmte Verhaltensmuster oder Denkweisen. Findet dieser Prozess nicht statt, so entsteht laut Mead auch keine Identität. Dieser Prozess ist auch auf die Sprache übertragbar. Ein weiterer Punkt ist, dass jedes Individuum nie seine komplette Identität gegenüber seinem sozialen Umfeld preisgibt. Es gibt also Teile der Identität, die wir verdrängen, entweder bewusst oder unbewusst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DEFINITION WICHTIGER GRUNDBEGRIFFE
- 3. DIE IDENTIÄTSENTWICKLUNG NACH MEAD DURCH DEN FAKTOR SPRACHE
- 4. MEHRDEUTIGKEIT DEUTSCHER WÖRTER (MIT BEISPIELEN)
- 5. KOMMUNIKATION IN DER SCHULE
- 5.1. LEHRER - SCHÜLER KOMMUNIKATION
- 5.2. SCHÜLER - SCHÜLER KOMMUNIKATION
- 6. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Meads Theorie der Sozialisation durch Sprache, insbesondere die Frage, ob eine eindeutige Identität trotz der Mehrdeutigkeit von Sprache entwickelt werden kann. Der Fokus liegt auf der Äquivokation, der Mehrdeutigkeit von Wörtern aufgrund gleicher Klangform, aber unterschiedlicher Bedeutung. Die Arbeit analysiert den Prozess der Identitätsentwicklung nach Mead, die Rolle der Sprache und des sozialen Kontextes dabei, sowie die Herausforderungen, die durch mehrdeutige Sprache entstehen können.
- Meads Theorie der Identitätsentwicklung
- Der Einfluss von Sprache auf die Identitätsbildung
- Die Rolle der Äquivokation in der Kommunikation
- Der soziale Kontext und seine Bedeutung für die Sprachentwicklung
- Kommunikation in schulischen Settings
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht Meads Theorie der Sprachentstehung und deren Einfluss auf die Identitätsentwicklung. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann trotz mehrdeutiger Sprache eine eindeutige Identität entwickelt werden? Der Fokus wird auf die Äquivokation gelegt, also die Mehrdeutigkeit von Wörtern mit gleicher Klangform, aber unterschiedlicher Bedeutung. Die Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf Meads Werk „Geist, Identität und Gesellschaft“ (1973).
2. Definition wichtiger Grundbegriffe: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe Meads, wie Identität als „Objekt für sich selbst“, die Unterscheidung zwischen „SELF“, „ME“ und „I“ im Prozess der Identitätsentwicklung und die Bedeutung des „role-taking“ für die Rollenübernahme und Identifizierung mit anderen. Es wird betont, dass Identität nicht angeboren, sondern im gesellschaftlichen Prozess durch Austausch und Erfahrung entwickelt wird. Die Sprache wird als essentieller Bestandteil dieses Prozesses hervorgehoben, da sie die Kommunikation und Verständigung in der Gesellschaft ermöglicht.
3. Identitätsentwicklung nach Mead durch den Faktor Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet Meads These, dass der Sprachprozess maßgeblich für die Identitätsentwicklung ist. Im Gegensatz zu Watson, der die gesellschaftliche Komponente vernachlässigt, betont Mead die Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft durch Sprache. Sprache wird als Ausdruck des „denkenden Wesens“ dargestellt, die vokale Geste als Grundlage für die Sprachentwicklung und den Geist. Die Bedeutung der Übereinstimmung von selbst ausgelösten und bei anderen ausgelösten Gesten für die erfolgreiche Kommunikation wird hervorgehoben. Missverständnisse entstehen, wenn unterschiedliche Interpretationen desselben Wortes vorliegen.
Schlüsselwörter
Mead, Sozialisation, Sprache, Identität, Äquivokation, Identitätsentwicklung, „SELF“, „ME“, „I“, vokale Geste, Kommunikation, Gesellschaft, Mehrdeutigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Meads Theorie der Identitätsentwicklung und die Mehrdeutigkeit von Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht George Meads Theorie der Sozialisation und Identitätsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses von Sprache, insbesondere der Mehrdeutigkeit von Wörtern (Äquivokation). Die zentrale Frage lautet: Kann trotz mehrdeutiger Sprache eine eindeutige Identität entwickelt werden?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Meads Theorie der Identitätsentwicklung, den Einfluss von Sprache auf die Identitätsbildung, die Rolle der Äquivokation in der Kommunikation, den sozialen Kontext der Sprachentwicklung und die Kommunikation in schulischen Settings (Lehrer-Schüler und Schüler-Schüler Kommunikation).
Welche Konzepte von Mead werden erklärt?
Die Arbeit erläutert zentrale Begriffe aus Meads Theorie, wie „SELF“, „ME“, „I“, die Bedeutung des „role-taking“ (Rollenübernahme) und die Entwicklung der Identität als „Objekt für sich selbst“ im gesellschaftlichen Kontext. Die vokale Geste als Grundlage der Sprachentwicklung und des Geistes wird ebenfalls erklärt.
Wie wird die Rolle der Sprache in der Identitätsentwicklung dargestellt?
Die Arbeit betont die zentrale Rolle der Sprache in Meads Theorie der Identitätsentwicklung. Sprache ermöglicht Kommunikation und Verständigung und ist essentiell für den Austausch und die Erfahrung, die die Identitätsbildung prägen. Die Mehrdeutigkeit von Sprache (Äquivokation) wird als Herausforderung für die Entwicklung einer eindeutigen Identität betrachtet.
Welche Bedeutung hat die Äquivokation (Mehrdeutigkeit) in der Arbeit?
Die Äquivokation, also die Mehrdeutigkeit von Wörtern mit gleicher Klangform aber unterschiedlicher Bedeutung, steht im Mittelpunkt der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie diese Mehrdeutigkeit den Prozess der Identitätsentwicklung beeinflusst und zu Missverständnissen in der Kommunikation führen kann.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Definition wichtiger Grundbegriffe, Identitätsentwicklung nach Mead durch den Faktor Sprache, Mehrdeutigkeit deutscher Wörter (mit Beispielen), Kommunikation in der Schule (Lehrer-Schüler und Schüler-Schüler Kommunikation) und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Mead, Sozialisation, Sprache, Identität, Äquivokation, Identitätsentwicklung, „SELF“, „ME“, „I“, vokale Geste, Kommunikation, Gesellschaft, Mehrdeutigkeit.
Auf welches Werk von Mead bezieht sich die Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf Meads Werk „Geist, Identität und Gesellschaft“ (1973).
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann trotz mehrdeutiger Sprache eine eindeutige Identität entwickelt werden?
Werden Beispiele für die Mehrdeutigkeit deutscher Wörter gegeben?
Ja, die Arbeit enthält Beispiele für die Mehrdeutigkeit deutscher Wörter (Äquivokation), um den Punkt zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Freda Jansen (Author), 2019, Sozialisation durch Sprache nach George Herbert Mead, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504164