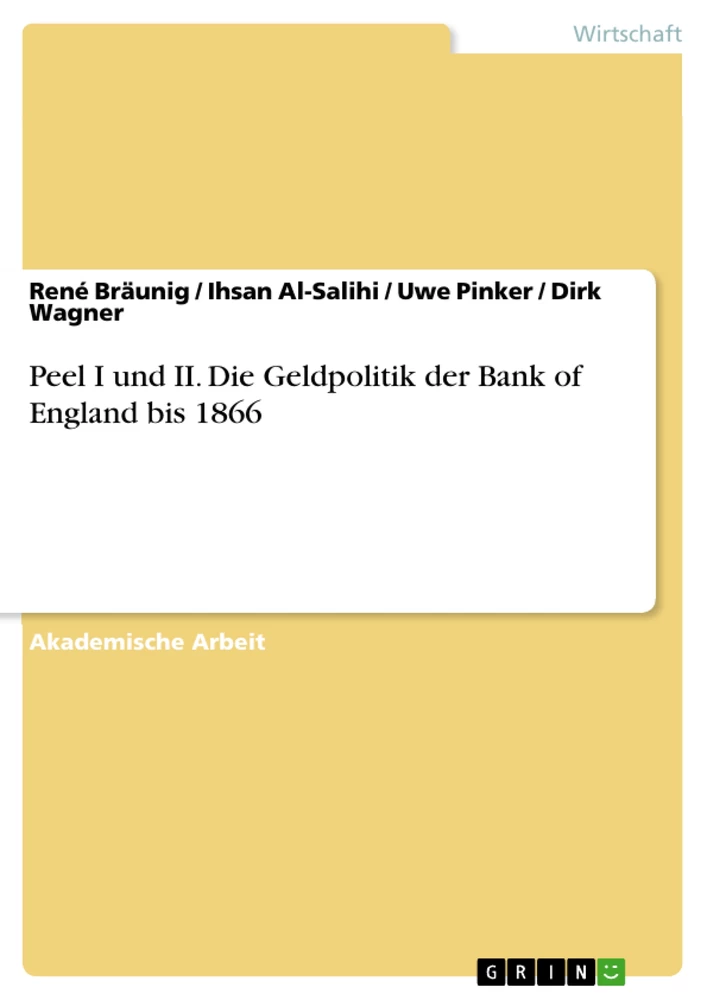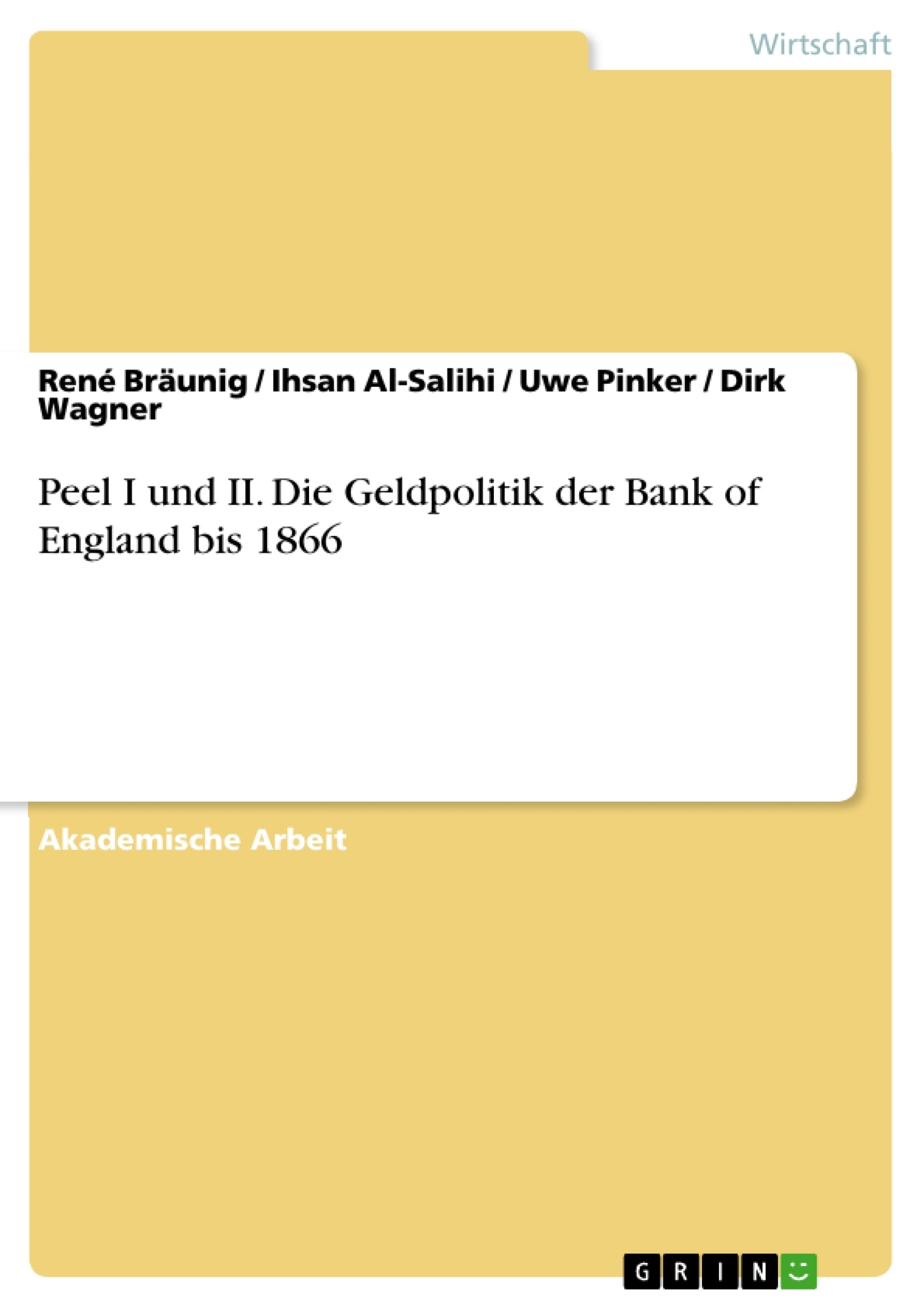Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung der Geldpolitik der "Bank of England" bis 1866. Anhand der Geschichte der Bank of England läßt sich beispielhaft die Notwendigkeit und die Rolle der Zentralbank innerhalb einer Volkswirtschaft im industriellen Zeitalter nachvollziehen. Der Übergang zur gesetzlichen Goldwährung wurde in England 1816 vollendet, Silber diente danach nur noch als Scheidemünze bis zu 40 Schilling.
In der Wirtschaftskrise, die auf das Ende der napoleonischen Kriege folgte, gingen 1816/17 fast 90 Notenbanken Bankrott, in der Handelskrise 1825/26 noch mal 70. Die privaten Notenbanken hatten in den letzten beiden Jahren vor dem Ausbruch der Handelskrise ihren Notenumlauf mehr als verdoppelt und waren diesem nun nicht gewachsen.
Das Bankpublikum wurde durch die Bank of England beruhigt, die unter Abgabe eigener großer Goldvorräte alle Kreditforderungen bewilligte. Die Krise hatte zwar nicht die Banknote als Umlaufmittel in Mißkredit gebracht, aber das Dilemma offenbart, daß entweder ungenügende Barmittel für Geschäftsbeziehungen bereitstehen oder aber die Fähigkeit zur Barzahlung unmöglich ist. Premierminister Lord Liverpool hielt deshalb die Gründung kapitalstarker Notenbanken für notwendig. 1826 erfolgte die Gründung von weiteren Notenbanken in Wales und England ( außerhalb Londons ), die als Aktiengesellschaften organisiert sind. 1833 wird die Banknote der Bank of England " legal tender ".
Inhaltsverzeichnis
- Abriß der Geschichte der Bank of England
- Geschichtlicher Hintergrund Teil I
- Die Currency - Theorie
- Die Quantitätstheorie als Ausgangspunkt
- Das rein metallische Geldwesen
- Der gemischte Zustand des Geldwesens
- Die Bewegung der Geldmenge in beiden Systemen
- Das Prinzip des gleichmäßigen Schwankens von Notenzirkulation und Barfonds
- Spätere Modifizierung der Currency - Theorie
- Banking - Theorie
- Die Sicherung der Einlösbarkeit der Noten
- Fullarton über den Einfluß von Horten auf den Metallwert
- Geschichtlicher Hintergrund Teil II
- Peelsche Bankakte 1844 - 1866
- Die Notenabteilung
- Die Bankabteilung
- Aus einer Rede vom 6. und 20. Mai 1866
- Peel's Gesetzentwurf
- Die Notenausgabe in Schottland und Irland
- Schwächen der 2. Peelschen Bankakte
- Stellungnahme von Currency - Theoretikern
- Das offene Diskontfenster ( kurzer Ausblick)
- Wagner `sche Kritik der Currency - Theorie
- Kritik am Begriff des Geldes in der Currency - Theorie
- Kritik der Notenmengenregulierung
- Tooke`scher Fundamentalsatz ( Umkehrung der Currencytheorie )
- Wagner `sche Kritik der Peel`schen Bankakte von 1844
- Überspekulation und Wirkung der Peel'schen Bankakte von 1844
- Lender of last Ressort
- Strukturbedingte Probleme der Bank of England
- Geschichtlicher Hintergrund Teil III
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Geldpolitik der Bank of England im 19. Jahrhundert, insbesondere die Auswirkungen der beiden Peel'schen Bankakte von 1844 und 1866. Sie befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Currency-Theorie und der Banking-Theorie und untersucht deren praktische Relevanz im Kontext der britischen Geldpolitik. Die Arbeit hinterfragt zudem die Kritik an der Currency-Theorie durch Carl Friedrich Wagner und analysiert die Bedeutung der Bank of England als Lender of last Resort.
- Die Entwicklung der Bank of England und ihre Rolle im britischen Finanzsystem
- Die Currency-Theorie und ihre Anwendung in der Geldpolitik der Bank of England
- Die Peelschen Bankakte von 1844 und 1866 und ihre Auswirkungen auf das britische Bankensystem
- Kritik an der Currency-Theorie und der Peelschen Bankakte
- Die Bedeutung der Bank of England als Lender of last Resort
Zusammenfassung der Kapitel
- Abriß der Geschichte der Bank of England: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Bank of England vom Jahr 1694 bis zur Einführung der Peelschen Bankakte 1844. Es beleuchtet die Entwicklung des Bankwesens in England, die Einführung des legal tender status für Banknoten und die Herausforderungen, denen sich die Bank of England im 19. Jahrhundert stellen musste.
- Geschichtlicher Hintergrund Teil I: Dieses Kapitel beschreibt den wirtschaftlichen und politischen Kontext in England im frühen 19. Jahrhundert, insbesondere die Phase der industriellen Revolution und die Auswirkungen der napoleonischen Kriege. Es beleuchtet die Herausforderungen des damaligen Bankwesens, die zu zahlreichen Bankenzusammenbrüchen führten.
- Die Currency - Theorie: Dieses Kapitel widmet sich der Currency-Theorie, die die Bedeutung der Geldmenge für die Preisstabilität betont. Es diskutiert die verschiedenen Ansätze der Quantitätstheorie, das Konzept des rein metallischen Geldwesens und des gemischten Geldwesens, sowie die Auswirkungen von Notenzirkulation und Barfonds auf die Geldmenge.
- Banking - Theorie: Dieses Kapitel behandelt die Banking-Theorie, die sich mit den Funktionen des Bankwesens und der Sicherung der Einlösbarkeit von Banknoten beschäftigt. Es stellt die Argumentation von Fullarton dar, der die Bedeutung von Horten für den Metallwert hervorhob.
- Geschichtlicher Hintergrund Teil II: Dieses Kapitel setzt die Darstellung des historischen Hintergrunds fort und beleuchtet die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Einführung der Peelschen Bankakte im Jahr 1844.
- Peelsche Bankakte 1844 - 1866: Dieses Kapitel analysiert die Peelsche Bankakte von 1844, die das britische Bankensystem tiefgreifend reformierte. Es beschreibt die Trennung der Bank of England in eine Notenabteilung und eine Bankabteilung, die Auswirkungen auf die Notenausgabe und die Kontroversen, die die Akte hervorrief.
- Wagner `sche Kritik der Currency - Theorie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik an der Currency-Theorie durch Carl Friedrich Wagner. Es analysiert Wagners Argumente zur Kritik am Begriff des Geldes in der Currency-Theorie, zur Notenmengenregulierung und zur Umkehrung der Currencytheorie durch den Tooke`schen Fundamentalsatz.
- Wagner `sche Kritik der Peel`schen Bankakte von 1844: Dieses Kapitel stellt Wagners Kritik an der Peelschen Bankakte von 1844 dar. Es untersucht die Auswirkungen der Akte auf Überspekulation und die Rolle der Bank of England als Lender of last Resort.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Bank of England, Geldpolitik, Currency-Theorie, Banking-Theorie, Peelsche Bankakte, Lender of last Resort, Inflation, Deflation, Notenausgabe, Geldmenge, Preisstabilität, Finanzsystem, Wirtschaftsgeschichte.
- Citar trabajo
- Diplomkaufmann René Bräunig (Autor), Ihsan Al-Salihi (Autor), Uwe Pinker (Autor), Dirk Wagner (Autor), 1993, Peel I und II. Die Geldpolitik der Bank of England bis 1866, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504282