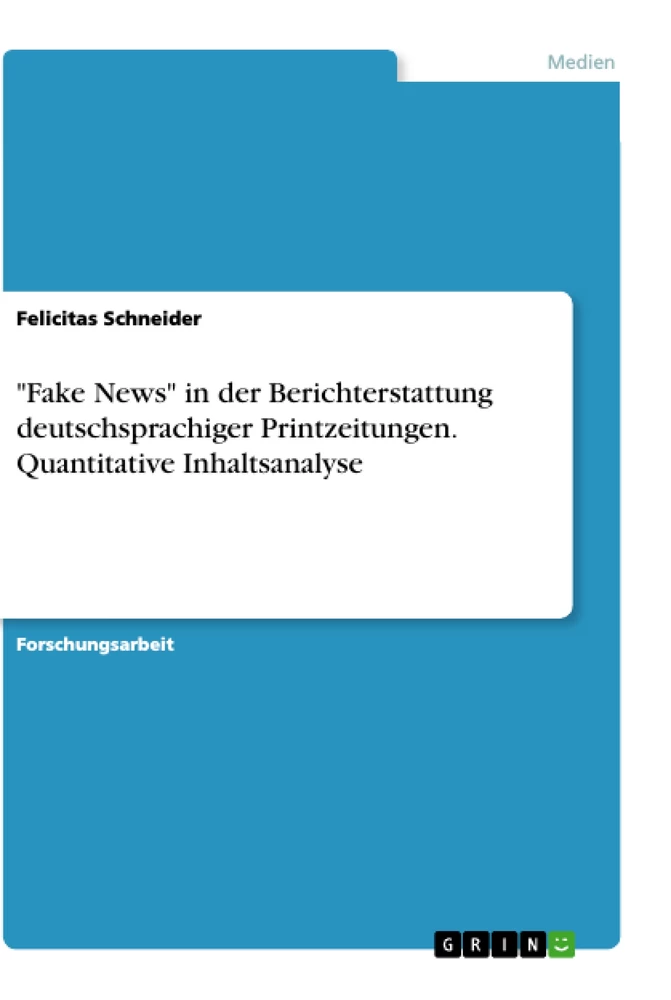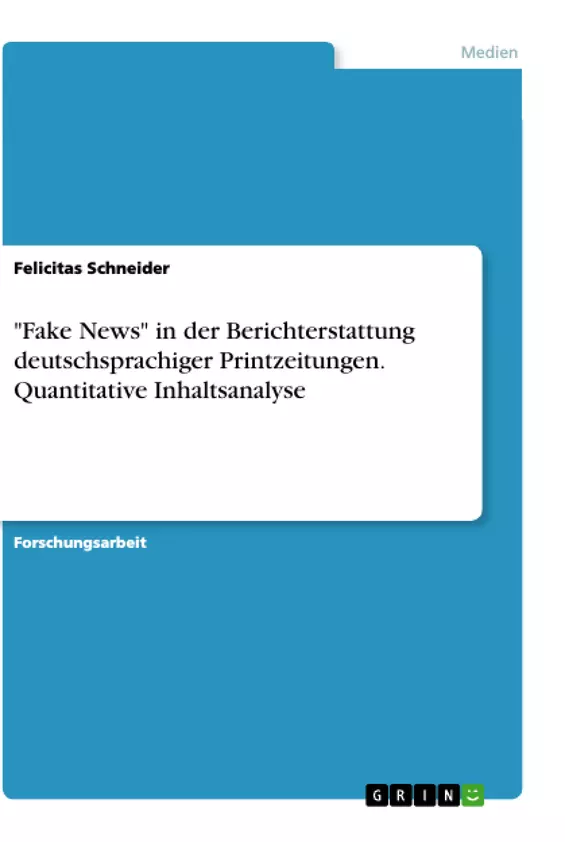Falschmeldungen sind an und für sich kein neues Phänomen, gibt es sie doch schon seit Ende des 19. Jahrhunderts als unwahre Meldungen in Zeitungen über verschiedene Themen. Den Durchbruch in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch schafften sie im Rahmen der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016. Davon ausgehend, wurde der Einfluss und die Verbreitung von Fake News öffentlich stark diskutiert und untersucht. Aufgrund dieser, als intensiv wahrgenommenen Berichterstattung, wurde von den Autorinnen der Studie vermutet, Fake News hätten hohe Relevanz im öffentlichen Diskurs, vor allem in Zusammenhang mit politischen Informationen. Diese These wurde mittels der Analyse von deutschsprachigen Printzeitungsartikeln untersucht. Die gewählte empirische Methode ist die quantitative Inhaltsanalyse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Einbettung
- First-Level-of-Agenda-Setting
- Second-Level-of-Agenda-Setting
- Priming
- Framing
- Fazit der theoretischen Einbettung
- Empirische Untersuchung
- Vorstellung der Methode: Quantitativ Inhaltsanalyse
- Operationalisierung der Fragestellung
- Vorbereitung der Erhebung
- Sample
- Codebuch
- Codiermaske Excel
- Pretest
- Codierung / Durchführung der Untersuchung
- Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse
- Deskriptive Ergebnisse
- Hypothesenprüfende Ergebnisse
- Prüfung Hypothesenkomplex 1
- Prüfung Hypothesenkomplex 2
- Prüfung Hypothesenkomplex 3
- Diskussion und Interpretation
- Schlussbetrachtung & Methodenkritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Berichterstattung deutschsprachiger Printzeitungen über das Phänomen „Fake News“ zu untersuchen. Die Studie analysiert, wie häufig, in welcher Tonalität und mit welchem thematischen Schwerpunkt Fake News in diesen Medien dargestellt werden. Darüber hinaus werden die in der Berichterstattung hervorgehobenen Akteur_Innen und die Relevanz, die dem Thema in den Printmedien zuteil wird, untersucht.
- Häufigkeit der Berichterstattung über Fake News
- Tonalität der Berichterstattung über Fake News
- Thematische Schwerpunkte in der Berichterstattung über Fake News
- Hervorgehobene Akteur_Innen in der Berichterstattung über Fake News
- Relevanz des Themas „Fake News“ in der Berichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema Fake News im Kontext der deutschen Medienlandschaft vor und beschreibt die Relevanz des Themas im öffentlichen Diskurs. Die Forschungsfrage wird formuliert und die Methodik der Untersuchung erläutert.
- Theoretische Einbettung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit relevanten theoretischen Ansätzen, die der Untersuchung zugrunde liegen. Hier werden die Konzepte des Agenda-Settings, Priming und Framing erläutert und ihre Bedeutung für das Verständnis der medialen Wirkung von Fake News aufgezeigt.
- Empirische Untersuchung: Das Kapitel beschreibt die konkrete Durchführung der Studie. Es werden die Methoden der quantitativen Inhaltsanalyse, die Operationalisierung der Forschungsfrage und die Vorbereitung der Datenerhebung vorgestellt. Weiterhin wird auf die Erstellung des Codebuchs, der Codiermaske und die Durchführung des Pretests eingegangen.
- Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es werden sowohl deskriptive Ergebnisse als auch hypothesenprüfende Ergebnisse vorgestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Analyse von Fake News in deutschsprachigen Printzeitungen. Die Untersuchung befasst sich mit dem Phänomen der Fake News, der quantitativen Inhaltsanalyse, der Agenda-Setting-Theorie, Priming, Framing, Medienwirkung, und der Relevanz des Themas im öffentlichen Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Wie definieren sich „Fake News“ im Kontext dieser Studie?
Fake News werden als Falschmeldungen verstanden, die bereits seit dem 19. Jahrhundert existieren, aber besonders seit der US-Wahl 2016 als politisches Instrument im Fokus stehen.
Welche Methode wurde zur Untersuchung der Zeitungsartikel genutzt?
Die Studie verwendet die quantitative Inhaltsanalyse, um Häufigkeit, Tonalität und thematische Schwerpunkte der Berichterstattung in deutschsprachigen Printmedien zu erfassen.
Was ist die Agenda-Setting-Theorie?
Diese Theorie besagt, dass Medien durch die Auswahl und Hervorhebung bestimmter Themen (wie Fake News) bestimmen, welche Probleme die Öffentlichkeit als wichtig wahrnimmt.
Welche Rolle spielen Priming und Framing?
Framing beeinflusst, wie ein Thema interpretiert wird (z.B. als Gefahr für die Demokratie), während Priming die Bewertungsmaßstäbe der Rezipienten prägt.
In welchem Zusammenhang werden Fake News meistens thematisiert?
Die Berichterstattung findet primär im Zusammenhang mit politischen Informationen und deren Einfluss auf den öffentlichen Diskurs statt.
Wann erlebte der Begriff „Fake News“ seinen Durchbruch in Deutschland?
Der Begriff schaffte den Durchbruch in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch maßgeblich im Rahmen der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016.
- Quote paper
- Felicitas Schneider (Author), 2017, "Fake News" in der Berichterstattung deutschsprachiger Printzeitungen. Quantitative Inhaltsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504366