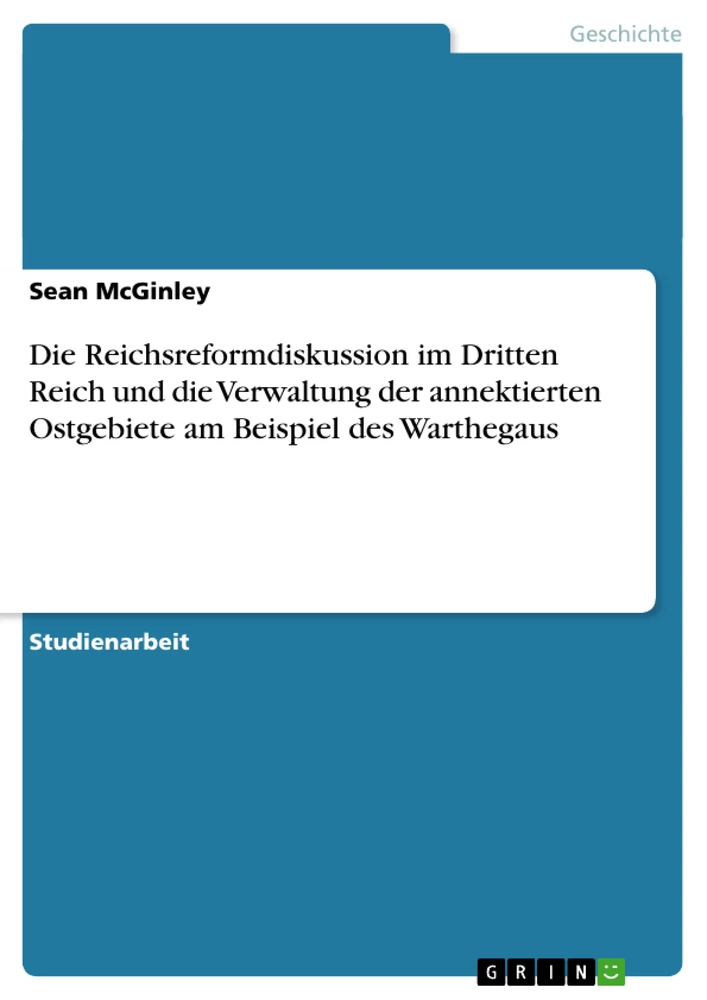Das Interesse der Nationalsozialisten an einer Neuordnung von Verwaltung und Verfassung ergab sich aus zwei Quellen: zum einen die ideologische Motivation, die Strukturen des „Parlamentarismus” auf allen Ebenen zu beseitigen und durch eigene, aus der Staatstheorie der Nationalsozialisten entwickelten Verwaltungsformen zu ersetzen; zum anderen das Bedürfnis, die eigene Macht zu festigen und abzusichern.
Die Ausschaltung des Parlaments durch das Ermächtigungsgesetz sowie die Gleichschaltung der Parteien und Verbände können als erste Schritte in Richtung eines Staates, der entsprechend der NS-Ideologie aufgebaut ist, gesehen werden. Doch nach der Erlangung und Festigung der Macht war es eine viel schwierigere Aufgabe, innerhalb der „Bewegung“ einen Konsens über den weiteren Fortgang der Umgestaltung zu finden. Viele NSDAP-Kader hatten sich in verschiedenen Ämtern eingefunden, allen voran die Reichsstatthalter, und hatten aus ihrer neuen Perspektive andere Interessen als vor der Machtübernahme.
Eine Darstellung der zentralen Themen der Reichsreformdiskussion, der Positionen der Hauptakteure, und eine Schilderung des Verlaufes der Diskussion machen den Inhalt des ersten Teils dieser Arbeit aus. Der schleppende Verlauf der Reform im Altreich, geprägt von einer Vielzahl von Akteuren mit festgefahrenen Positionen, ließ den Blick des interessierten Beobachters auf die eingegliederten Gebiete Österreichs, des Sudetenlandes und Polen fallen. Dort wurden neue Regelungen geschaffen, die mit Blick auf die Verwirklichung der Prinzipien, die im Altreich diskutiert, aber nicht umgesetzt wurden, interessante Ergebnisse erzielten, die zu der These einer „Vorbildfunktion“ der Ostgaue geführt haben. Vor allem der Warthegau wird häufig als „Mustergau“ bezeichnet. Deswegen wird sich der zweite Teil dieser Arbeit auf diese neuen Reichsgau konzentrieren. Dabei sollen genügend Informationen über die Verwaltungssituation, aber auch über die Praxis und Hintergründe der Besatzungspolitik im Warthegau präsentiert werden, um am Ende eine Stellungnahme von der These einer „Musterfunktion“ des Warthegaus abgeben zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bemerkungen zur Literatur
- Die Diskussion um die Neugliederung der Verwaltung im Altreich
- Die Ausgangslage nach dem Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30.1.1934
- Der Standpunkt des NSDAP-Apparates und der Entwurf Adolf Wagners
- Helmut Nicolai
- Franz Albrecht Medicus
- Reichsminister des Innern Wilhelm Frick
- Schilderung und Bewertung des Ablaufs der Reformdiskussion im Altreich
- Die Verwaltung der annektierten Gebiete
- Die ideologische Grundlage der Politik in den neuen Reichsgauen
- Die Verwaltung in Österreich
- Die Verwaltung im Sudetenland
- Die Aufteilung des besetzten Polens
- Der Warthegau
- Das Gebiet und die Verwaltung
- Bevölkerungsentwicklung im späteren Warthegau bis 1939
- Nationalsozialistische Bevölkerungspolitik im Warthegau und den übrigen ehemals polnischen Gebieten
- Die Kirchenpolitik im Warthegau
- Zusammenfassung und Ausblick - der Warthegau als „Muster“ des zukünftigen Reichsaufbaus?
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Reichsreformdiskussion im Dritten Reich und die Verwaltung der annektierten Ostgebiete am Beispiel des Warthegaus. Dabei wird der Fokus auf die ideologische Motivation und die praktische Umsetzung der Reichsreform sowie auf die spezifischen Herausforderungen der Verwaltung in den neuen Reichsgauen gelegt.
- Die ideologische Grundlage der Reichsreform im Dritten Reich
- Die verschiedenen Positionen und Akteure in der Reichsreformdiskussion
- Die Verwaltungspraxis in den annektierten Ostgebieten
- Die Umsetzung nationalsozialistischer Politik im Warthegau
- Die Rolle des Warthegaus als mögliches „Muster“ für den zukünftigen Reichsaufbau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Motivationen und Ziele der Nationalsozialisten hinsichtlich einer Neuordnung der Verwaltung. Sie stellt die wichtigsten Etappen des Prozesses dar, die zur Abschaffung der Eigenständigkeit der deutschen Länder führten und die den Weg für die Reichsreform ebneten.
Kapitel 1 untersucht die Reichsreformdiskussion im Altreich. Es werden die verschiedenen Positionen von prominenten Akteuren wie Adolf Wagner, Helmut Nicolai, Franz Albrecht Medicus und Wilhelm Frick beleuchtet. Es wird auch die Rolle des „Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches“ von 1934 und die daraus resultierende Situation der deutschen Länder analysiert.
Kapitel 2 befasst sich mit der Verwaltung der annektierten Gebiete, wobei der Fokus auf dem Warthegau liegt. Es werden die ideologischen Grundlagen der Politik in den neuen Reichsgauen, die Verwaltung in Österreich, dem Sudetenland und den besetzten polnischen Gebieten sowie die spezifischen Herausforderungen und Maßnahmen im Warthegau beleuchtet.
In Kapitel 2.5 werden die Bevölkerungsentwicklung, die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik und die Kirchenpolitik im Warthegau im Detail behandelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Reichsreform, Verwaltung, Ostgebiete, Warthegau, Nationalsozialismus, Besatzungspolitik, Bevölkerungspolitik, Kirchenpolitik, Mustergau. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der ideologischen Grundlagen, der Akteure und der konkreten Umsetzung der Reichsreform im Dritten Reich, insbesondere im Kontext der Verwaltung der annektierten Ostgebiete, mit besonderem Augenmerk auf den Warthegau.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Reichsreform im Dritten Reich?
Ziel war die Beseitigung parlamentarischer Strukturen und die Gleichschaltung der Verwaltung nach nationalsozialistischen Idealen zur Festigung der Macht.
Warum galt der Warthegau als "Mustergau"?
Im Warthegau konnten neue Verwaltungsformen und radikale Bevölkerungspolitiken ohne die Widerstände der traditionellen Strukturen des Altreichs umgesetzt werden.
Wer waren die Hauptakteure der Reformdiskussion?
Zu den Akteuren gehörten unter anderem Wilhelm Frick (Reichsinnenminister) sowie NSDAP-Kader wie Adolf Wagner und Helmut Nicolai.
Welche Rolle spielte die Bevölkerungspolitik im Warthegau?
Die Politik war geprägt von der Vertreibung der polnischen Bevölkerung und der Ansiedlung von Volksdeutschen im Rahmen der nationalsozialistischen Rassenideologie.
Was bewirkte das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches von 1934?
Es hob die Hoheitsrechte der Länder auf und unterstellte die Landesregierungen der Reichsgewalt, was die zentrale Machtbasis der Nationalsozialisten stärkte.
- Quote paper
- Sean McGinley (Author), 2004, Die Reichsreformdiskussion im Dritten Reich und die Verwaltung der annektierten Ostgebiete am Beispiel des Warthegaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50440