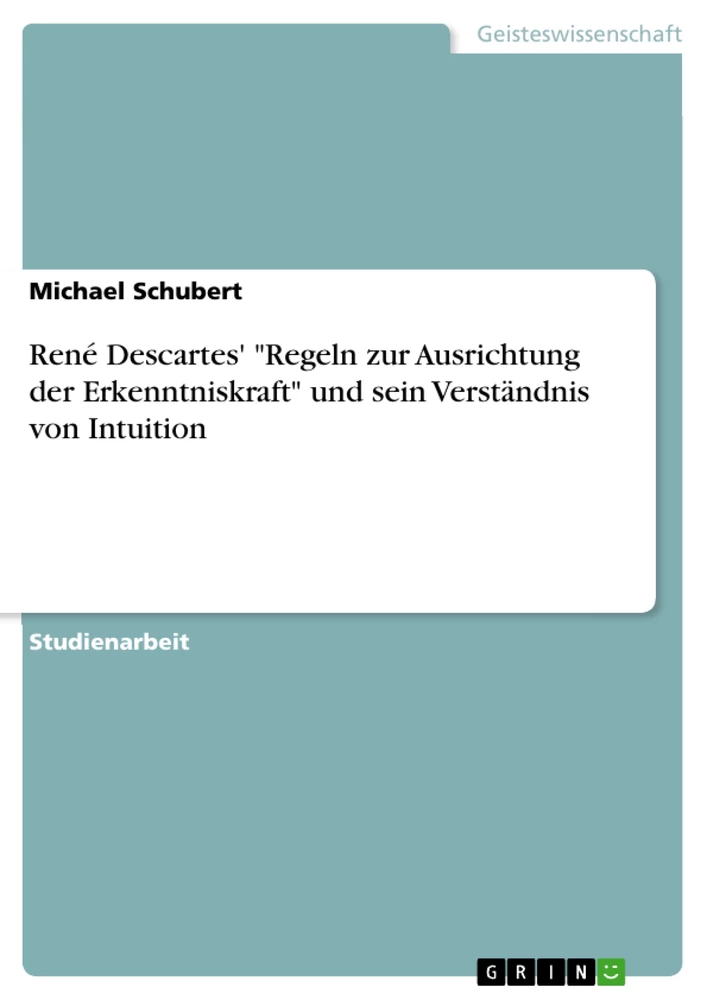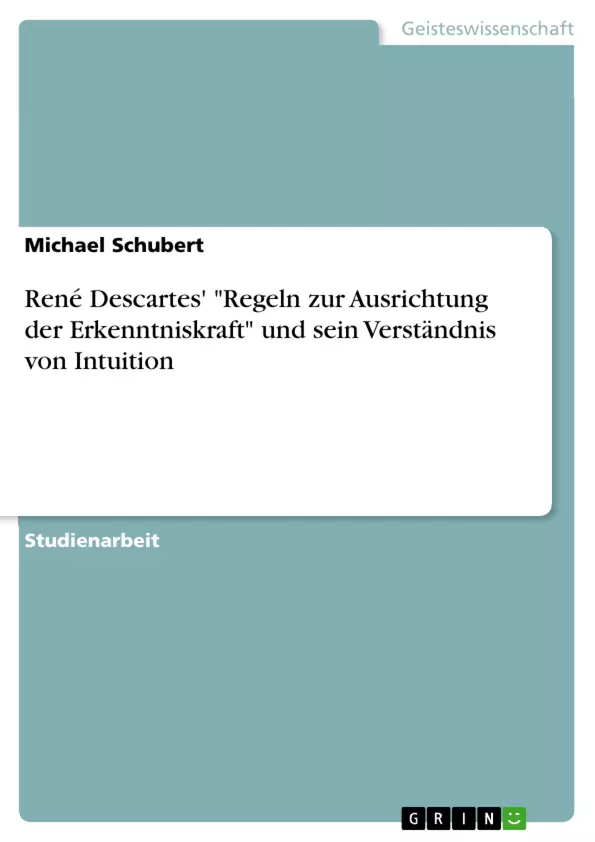Diese Arbeit beschäftigt sich mit René Descartes' "Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft" und seinem Verständnis von Intuition. Zunächst wird erklärt, was allgemein unter Intuition zu verstehen ist und wodurch sie charakterisiert wird. Es folgt ein Überblick über den Wandel des Intuitionsverständnisses in den traditionellen Erkenntnislehren. Danach befasst sich die Arbeit mit Descartes' Erkenntnisziel und -methode sowie seinem Verständnis von Intuition.
René Descartes gilt als Begründer des von der Vernunft des Menschen überzeugten modernen Rationalismus. Sein vernichtendes Urteil über das herrschende Bildungsideal und seine heftige Kritik über das Wissen seiner Zeit führten ihn zum "Prinzip des methodischen Zweifels". Descartes forderte ein Universalverfahren für jede Art der Erkenntnis und die Beschreibung von festen Regeln zur Lenkung des Geistes. Er formulierte seinen bekannten Grundastz "cogito, ergo sum" - "Ich denke, also bin ich" nach radikalen Zweifeln an der eigenen Erkenntnisfähigkeit als unfehlbares Fundament.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Fragestellung und Vorgehensweise
- II. Was versteht man unter Intuition und welche Kriterien liegen ihr zugrunde?
- III. Wie hat sich das Verständnis von Intuition in den Erkenntnislehren gewandelt?
- IV. Hauptteil: Descartes Erkenntnismethode
- IV.I Sein Erkenntnisziel: Neubegründung jeder Erkenntnis
- IV.II Sein Ausgangspunkt: Der methodische Zweifel
- IV.III Die Hauptregeln seiner Erkenntnismethode
- V. Welche Rolle nehmen Intuitionen in Descartes Erkenntnislehre ein?
- VI. Fazit: Descartes im Rückblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Intuitions- und Evidenzlehre René Descartes und analysiert die Rolle von Intuitionen in seinem Erkenntnisprozess. Die Arbeit beleuchtet Descartes' methodischen Zweifel und seine Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, um seine Suche nach einem sicheren Fundament für Erkenntnis zu verstehen.
- Das Verständnis von Intuition und intuitive Erkenntnis
- Der Wandel des Intuitionsverständnisses in der Geschichte der Erkenntnistheorie
- Descartes' Erkenntnisziel und seine methodischen Ansätze
- Die Bedeutung von Intuitionen in Descartes' Philosophie
- Bewertung der Grenzen und Möglichkeiten intuitiver Erkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Fragestellung und Vorgehensweise: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle von Intuitionen im Erkenntnisprozess und dem Wandel des Intuitionsverständnisses in der Geschichte der Erkenntnistheorie. Sie fokussiert sich auf René Descartes' Erkenntnislehre als Fallbeispiel und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Klärung des Intuitionsbegriffs, die Darstellung des Wandels des Intuitionsverständnisses und schließlich eine Analyse von Descartes' Erkenntnistheorie umfasst. Descartes' Streben nach einem sicheren Fundament für das Wissen und seine Kritik an der herrschenden Bildungsideal seiner Zeit bilden den Kontext der Untersuchung. Die "Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft" werden als Grundlage der Arbeit genannt.
II. Was versteht man unter Intuition und welche Kriterien liegen ihr zugrunde?: Dieses Kapitel untersucht den vielschichtigen Begriff der Intuition und unterscheidet zwischen Intuition und intuitiver Erkenntnis. Es wird deutlich, dass Intuition keine eindeutige Definition besitzt und oft im Widerspruch zum bewussten Denken steht. Es werden drei Kriterien für intuitive Erkenntnis hervorgehoben: Unmittelbarkeit, Evidenz und schlagartige Erfassung von Sinneswahrnehmungen (im Sinne einer inneren Wahrnehmung). Die Uneinheitlichkeit des Begriffs in verschiedenen philosophischen Traditionen wird ebenfalls thematisiert. Das Kapitel stellt fest, dass der Begriff „intuitive Erkenntnis“ abhängig von den „vorausliegenden epistemologischen Grundpositionen“ ist.
III. Wie hat sich das Verständnis von Intuition in den Erkenntnislehren gewandelt?: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Intuitionsverständnisses in der Geschichte der Philosophie. Es zeigt den deutlichen Dissens zwischen der traditionellen Philosophie, die der Intuition eine zentrale Rolle in der Begründung von Wissen beimisst, und der analytischen Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts, die die Intuition als Erkenntnisquelle ablehnt. Die Kapitel skizziert die Ansichten von Platon und Aristoteles, die beide die intuitive Erkenntnis als wichtig erachteten. Es wird hervorgehoben, dass in der Neuzeit die klassischen metaphysischen Annahmen der Antike aufgegeben wurden und Spinoza's Ansicht der Intuition als höchste Erkenntnisform beleuchtet.
Schlüsselwörter
Intuition, intuitive Erkenntnis, René Descartes, methodischer Zweifel, Erkenntnislehre, Rationalismus, Evidenz, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, Erkenntnistheorie, Wissen, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Descartes' Erkenntnislehre und die Rolle der Intuition
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Intuitions- und Evidenzlehre von René Descartes und analysiert die Rolle von Intuitionen in seinem Erkenntnisprozess. Sie beleuchtet Descartes' methodischen Zweifel und seine Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, um seine Suche nach einem sicheren Fundament für Erkenntnis zu verstehen. Die Arbeit betrachtet auch den Wandel des Intuitionsverständnisses in der Geschichte der Erkenntnistheorie.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Verständnis von Intuition und intuitiver Erkenntnis; den Wandel des Intuitionsverständnisses in der Geschichte der Erkenntnistheorie; Descartes' Erkenntnisziel und seine methodischen Ansätze; die Bedeutung von Intuitionen in Descartes' Philosophie; und eine Bewertung der Grenzen und Möglichkeiten intuitiver Erkenntnis.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung (Fragestellung und Vorgehensweise); Klärung des Begriffs „Intuition“ und zugehöriger Kriterien; Wandel des Intuitionsverständnisses in der Geschichte der Erkenntnistheorie; Descartes' Erkenntnismethode (inkl. Ziel, methodischer Zweifel und Regeln); Die Rolle von Intuitionen in Descartes' Erkenntnislehre; und ein Fazit (Descartes im Rückblick).
Was versteht die Hausarbeit unter Intuition und welche Kriterien werden dafür verwendet?
Die Hausarbeit untersucht den vielschichtigen Begriff der Intuition und unterscheidet zwischen Intuition und intuitiver Erkenntnis. Drei Kriterien für intuitive Erkenntnis werden hervorgehoben: Unmittelbarkeit, Evidenz und schlagartige Erfassung von Sinneswahrnehmungen (als innere Wahrnehmung). Die Uneinheitlichkeit des Begriffs in verschiedenen philosophischen Traditionen wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird der Wandel des Intuitionsverständnisses in der Geschichte der Erkenntnistheorie dargestellt?
Das Kapitel zum Wandel des Intuitionsverständnisses zeigt den Dissens zwischen traditioneller Philosophie (zentrale Rolle der Intuition) und analytischer Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts (Ablehnung der Intuition als Erkenntnisquelle). Die Ansichten von Platon, Aristoteles und Spinoza werden skizziert, wobei der Fokus auf dem Übergang von klassischen metaphysischen Annahmen der Antike zur Neuzeit liegt.
Welche Rolle spielt Descartes' Erkenntnismethode in der Hausarbeit?
Descartes' Erkenntnismethode, insbesondere sein methodischer Zweifel und seine Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, stehen im Mittelpunkt der Analyse. Die Hausarbeit untersucht, wie Descartes nach einem sicheren Fundament für Erkenntnis sucht und wie Intuitionen in diesem Prozess eine Rolle spielen. Sein Streben nach einer Neubegründung jeder Erkenntnis und seine Kritik an der herrschenden Bildungsideal seiner Zeit bilden den Kontext.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Hausarbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Intuition, intuitive Erkenntnis, René Descartes, methodischer Zweifel, Erkenntnislehre, Rationalismus, Evidenz, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, Erkenntnistheorie, Wissen, Philosophie.
- Arbeit zitieren
- Michael Schubert (Autor:in), 2019, René Descartes' "Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft" und sein Verständnis von Intuition, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504448