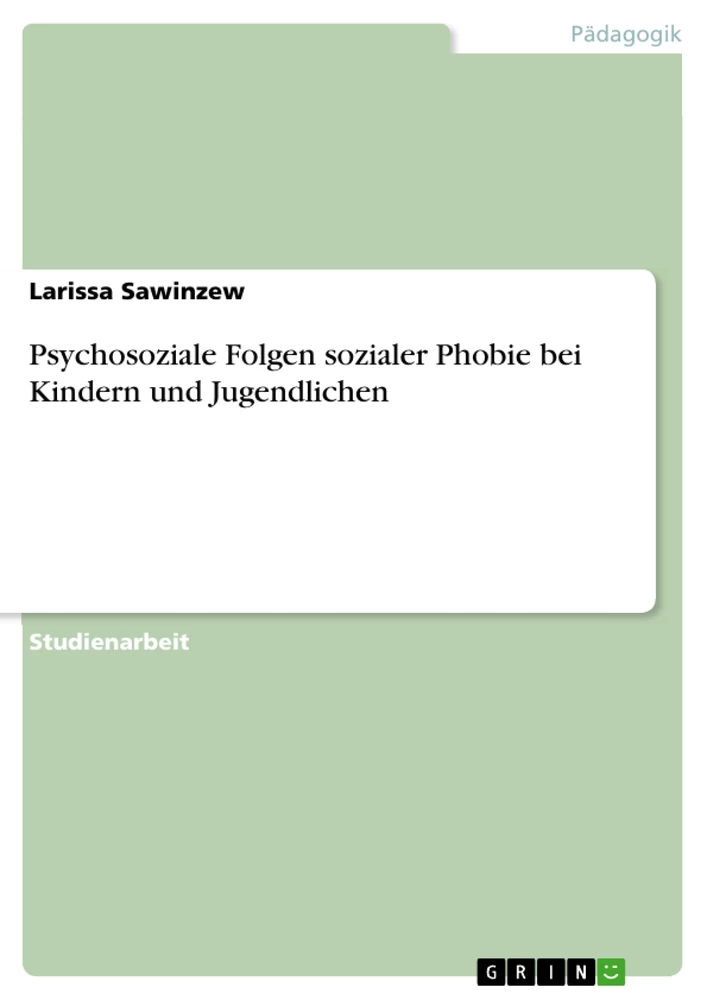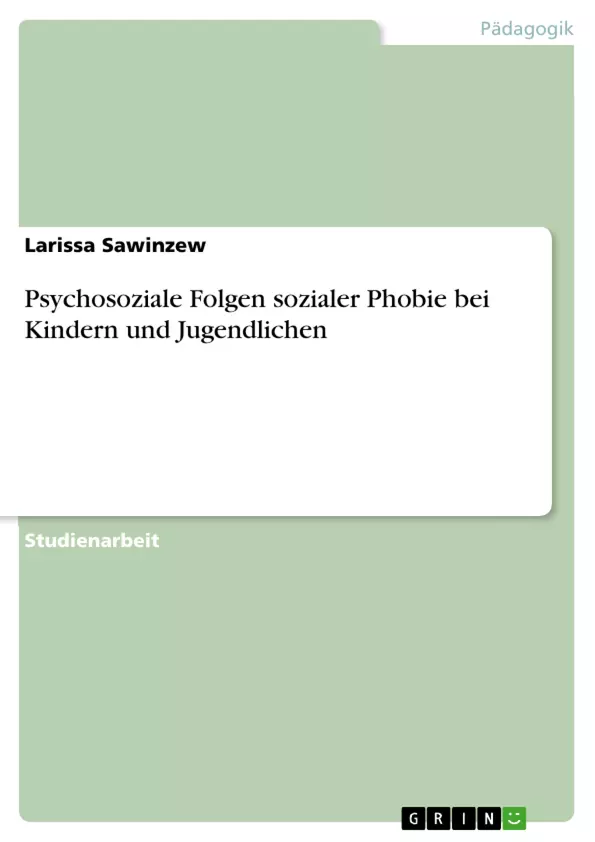Die folgende Hausarbeit befasst sich mit dem Krankheitsbild der sozialen Phobie und untersucht die psychosozialen Folge bei Kindern und Jugendlichen. Zunächst wird auf die Klassifikation der Sozialen Phobie eingegangen. Dabei werden sowohl das Klassifikationssystem DSM-IV als auch das Klassifikationssystem der ICD-10 herangezogen. Auf das klinische Erscheinungsbild eines sozialen Phobikers folgen Epidemiologie und Ätiologie der Störung. Daraufhin wird ein typischer Verlauf einer unbehandelten Sozialen Phobie aufgeführt und in dem darauffolgenden Kapitel werden die daraus resultierenden Beeinträchtigungen in den Bereichen Beruf & Schule und dem sozialen Umfeld dargestellt. Zum Schluss hin wird das Hilfesuchverhalten kurz angeschnitten.
Die Soziale Phobie gehört zu den häufigsten Angststörungen und verursacht bei den Betroffenen einen enormen Leidensdruck, der nicht nur zu Beeinträchtigungen im Beruf sondern auch zu Einschränkungen in sozialen Beziehungen führt. Sie entwickelt sich häufig schon im Kindes- und Jugendalter. Daher ist es wichtig, dass sie rechtzeitig diagnostiziert und behandelt wird, um langfristige Schädigungen zu vermeiden. Jedoch wird die Soziale Phobie nicht sofort erkannt und als einfache Schüchternheit abgetan. Bei Nichtbehandlung bleibt die Angst weiterhin bestehen und führt zu bedeutenden Folgen in dem Leben der Betroffenen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Diagnostik
- Klassifikation nach ICD-10
- Klassifikation nach DSM-IV
- Klinisches Erscheinungsbild
- Epidemiologie
- Ätiologie der Sozialen Phobie
- Verlauf
- Psychosoziale Folgen der Phobie
- Hilfesuchverhalten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Krankheitsbild der sozialen Phobie bei Kindern und Jugendlichen und untersucht die psychosozialen Folgen, die diese Störung mit sich bringt.
- Klassifikation der Sozialen Phobie nach ICD-10 und DSM-IV
- Klinisches Erscheinungsbild der Sozialen Phobie
- Epidemiologie und Ätiologie der Störung
- Typischer Verlauf einer unbehandelten Sozialen Phobie
- Psychosoziale Folgen der Störung in den Bereichen Beruf & Schule und sozialem Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Sozialen Phobie bei Kindern und Jugendlichen ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Sie stellt die Forschungsfrage der Hausarbeit vor: Welche psychosozialen Folgen bringt die soziale Phobie bei Kindern und Jugendlichen mit sich? Die Einleitung gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
- Definition und Diagnostik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Diagnostik der Sozialen Phobie. Es werden die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV vorgestellt und deren Kriterien zur Diagnose der Störung erläutert.
- Klinisches Erscheinungsbild: Hier wird das typische klinische Erscheinungsbild eines sozialphobischen Kindes oder Jugendlichen beschrieben. Es werden die zentralen Symptome und Verhaltensmuster im Zusammenhang mit der Störung dargestellt.
- Epidemiologie: Dieses Kapitel behandelt die Häufigkeit der Sozialen Phobie bei Kindern und Jugendlichen. Es werden Daten zur Verbreitung der Störung in der Bevölkerung vorgestellt.
- Ätiologie der Sozialen Phobie: Hier werden die Ursachen der Sozialen Phobie bei Kindern und Jugendlichen beleuchtet. Es werden verschiedene Faktoren diskutiert, die zur Entstehung der Störung beitragen können.
- Verlauf: Dieses Kapitel untersucht den typischen Verlauf einer unbehandelten Sozialen Phobie. Es werden die verschiedenen Stadien der Entwicklung der Störung beschrieben und die möglichen Folgen eines unbehandelten Verlaufs dargestellt.
- Psychosoziale Folgen der Phobie: Dieses Kapitel befasst sich mit den psychosozialen Folgen, die die Soziale Phobie bei Kindern und Jugendlichen mit sich bringt. Es werden die Auswirkungen der Störung auf das schulische und berufliche Leben sowie auf das soziale Umfeld dargestellt.
- Hilfesuchverhalten: Dieses Kapitel behandelt das Hilfesuchverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Sozialer Phobie. Es werden die Faktoren betrachtet, die die Inanspruchnahme von Hilfe erschweren können, und es werden Hinweise auf die Bedeutung einer frühzeitigen Intervention gegeben.
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Angststörung, Kinder und Jugendliche, psychosoziale Folgen, ICD-10, DSM-IV, klinisches Erscheinungsbild, Epidemiologie, Ätiologie, Verlauf, Hilfesuchverhalten, Behandlung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die psychosozialen Folgen einer sozialen Phobie bei Jugendlichen?
Die Folgen umfassen erhebliche Beeinträchtigungen im schulischen und beruflichen Leben sowie starke Einschränkungen in sozialen Beziehungen und im allgemeinen Wohlbefinden.
Nach welchen Systemen wird die soziale Phobie diagnostiziert?
In der Arbeit werden die Klassifikationssysteme ICD-10 der WHO und das DSM-IV herangezogen, um die Diagnosekriterien zu erläutern.
Warum wird soziale Phobie oft erst spät erkannt?
Häufig wird die Störung fälschlicherweise als einfache Schüchternheit abgetan, was eine frühzeitige Diagnose und Behandlung verhindert.
Wie verläuft eine unbehandelte soziale Phobie?
Ohne Behandlung bleibt die Angst meist bestehen und führt zu chronischen Problemen in der sozialen Interaktion und im beruflichen Fortkommen.
Welche Rolle spielt das Hilfesuchverhalten?
Das Hilfesuchverhalten ist oft durch Scham oder die Angst vor Bewertung gehemmt, weshalb eine frühzeitige Intervention durch das Umfeld entscheidend ist.
- Arbeit zitieren
- Larissa Sawinzew (Autor:in), 2019, Psychosoziale Folgen sozialer Phobie bei Kindern und Jugendlichen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504528