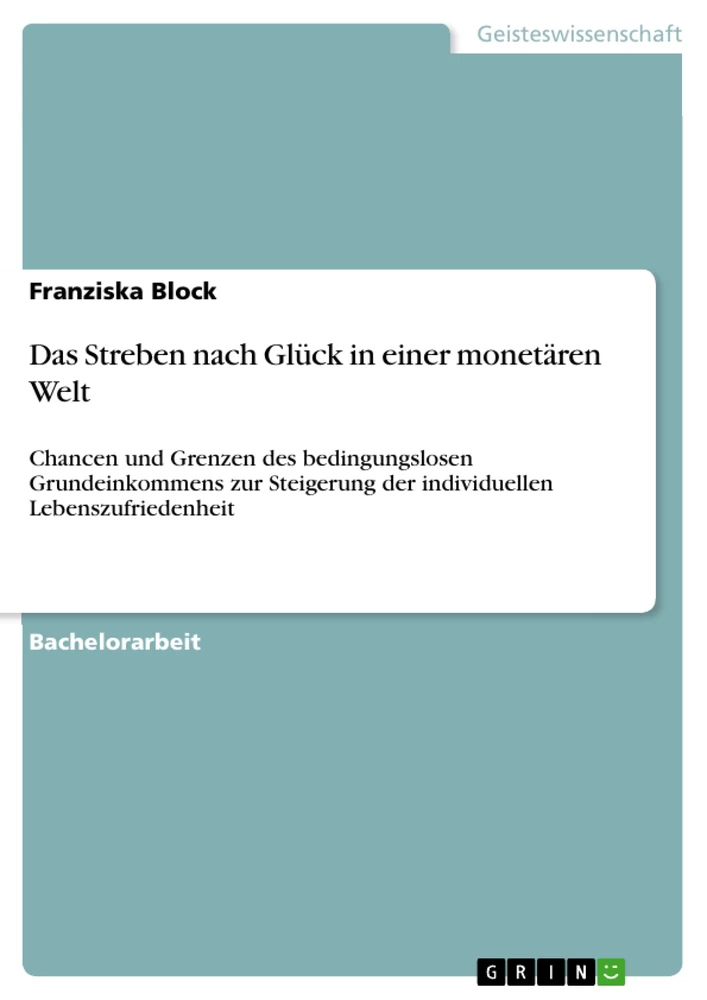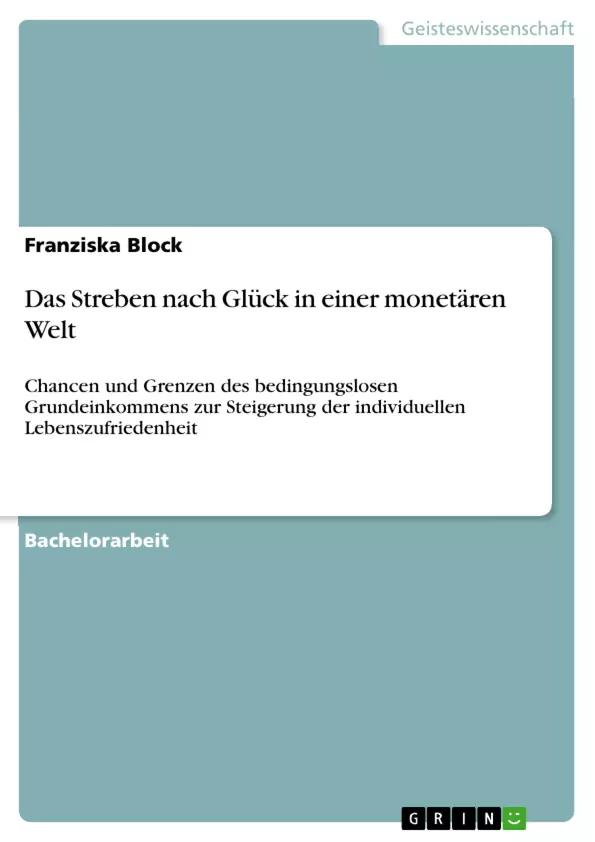Ausgehend von einem ursprünglich antiken philosophischen Interesse am menschlichen Glück hat sich die moderne Glücksforschung als interdisziplinäres Forschungsgebiet etabliert. Vor allem Politiker haben dessen Relevanz für eine zufriedene Gesellschaft erkannt und streben danach, Rahmenbedingungen für eine glückliche Bevölkerung zu schaffen. Besonders in Zeiten globaler Unruhen, steigender sozialer Disparitäten und vermehrter Kritik an der heutigen Leistungs- und Wachstumsgesellschaft weist eine politische Auseinandersetzung mit dem individuellen Lebensglück neuen Handlungsspielraum für nachhaltige Entwicklungsmaßnahmen auf. In Deutschland ließen sich in den letzten Jahren bei stetigem Wirtschaftswachstum zunehmend ungleiche Einkommensverteilungen, eine Verschärfung der Marktabhängigkeit und damit eingeschränkte individuelle Freiheiten der Bevölkerung verzeichnen. In diesem Kontext nahm die öffentliche Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu, welches je nach finanzieller und sozialpolitischer Ausgestaltung weitreichende Auswirkungen auf die individuelle Lebensweise der Menschen haben kann. In dieser Arbeit wurde untersucht, inwieweit ein bedingungsloses Grundeinkommen, basierend auf dem Argument des Gewinns an Freiheit und Autonomie, zu einem ansteigenden Glücksniveau der deutschen Bevölkerung führen könnte. Dabei wurden positive Veränderungen in den Lebensbereichen Arbeit, Einkommen, Familie, Gesundheit und Freizeit angenommen, die sich glückstreibend ausdrücken könnten. Allerdings sind jene Annahmen aufgrund mangelnder empirischer Nachweise nur auf hypothetischer Ebene erfolgt und machen weitere systematische Forschungen unabdingbar.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Theorien der Glücksforschung
- 2.1 Der Glücksbegriff
- 2.1.1 Glück in Philosophie, Psychologie und Soziologie
- 2.1.2 Einflussfaktoren des Glücks
- 2.1.3 Adaption und Glück
- 2.1.4 Messbarkeit des Glücks
- 2.2 Das Konzept des Flow als Zustand des Glücksgefühls
- 2.1 Der Glücksbegriff
- 3. Sozialpolitischer Glücksbegriff
- 3.1 Arbeit, Einkommen und Glück
- 3.2 Aufgaben der Sozialpolitik
- 4. Kulturimpuls Bedingungsloses Grundeinkommen
- 4.1 Konzeptionelle Grundlagen
- 4.1.1 Historische Ausgangslage
- 4.1.2 BGE-Modelle in Deutschland
- 4.1.3 Öffentliche Wahrnehmung in Deutschland
- 4.2 Kultureller Wert der Arbeit
- 4.3 Über das Recht auf Faulheit
- 4.1 Konzeptionelle Grundlagen
- 5. Das bedingungslose Grundeinkommen als Schlüssel zum Glück?
- 5.1 Einfluss auf ausgewählte Lebensbereiche
- 5.1.1 Einkommen
- 5.1.2 Arbeit
- 5.1.3 Familienleben
- 5.1.4 Freizeitgestaltung
- 5.1.5 Gesundheit
- 5.2 Grenzen der Einflussmöglichkeiten
- 5.3 Zusammenfassung der Analyseergebnisse
- 5.1 Einfluss auf ausgewählte Lebensbereiche
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den potenziellen Einfluss eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf die Lebenszufriedenheit der deutschen Bevölkerung. Ausgehend von der Annahme, dass ein BGE zu mehr Freiheit und Autonomie führt, wird analysiert, inwieweit sich dies positiv auf verschiedene Lebensbereiche auswirken könnte und somit das subjektive Glück steigert.
- Der Glücksbegriff in Philosophie, Psychologie und Soziologie
- Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) als sozialpolitische Maßnahme
- Der Einfluss des BGE auf ausgewählte Lebensbereiche (Einkommen, Arbeit, Familie, Freizeit, Gesundheit)
- Grenzen und Herausforderungen der BGE-Einführung bezüglich des Glücks
- Hypothetische Auswirkungen des BGE auf die Steigerung der Lebenszufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Strebens nach Glück ein und beleuchtet dessen Bedeutung in der antiken Philosophie und der modernen Glücksforschung. Sie beschreibt die wachsende politische Relevanz des Glücks und die zunehmende öffentliche Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) als potentielle Maßnahme zur Steigerung der Lebenszufriedenheit in Deutschland. Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Lebensbereichen, die von der Einführung eines BGE profitieren könnten und somit zu einer Steigerung der individuellen Lebenszufriedenheit beitragen könnten.
2. Theorien der Glücksforschung: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung des Glücksbegriffs aus philosophischen, psychologischen und soziologischen Perspektiven. Es analysiert verschiedene Einflussfaktoren auf das Glück, die Adaption an Lebensumstände und die Messbarkeit von Glück. Weiterhin wird das Konzept des "Flow" als Zustand des Glücksgefühls beleuchtet. Der Abschnitt klärt die Mehrdeutigkeit des Begriffs "Glück" im Deutschen und grenzt den zufälligen Glückstreffer von dem holistischen Glücksverständnis ab, das die Arbeit fokussiert.
3. Sozialpolitischer Glücksbegriff: Dieses Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Arbeit, Einkommen und Glück aus sozialpolitischer Sicht. Es untersucht die Aufgaben der Sozialpolitik im Kontext der Glücksforschung und legt den Grundstein für die Betrachtung des BGE als sozialpolitisches Instrument zur Glücksförderung. Das Kapitel beschreibt den Stellenwert von Arbeit, Einkommen und deren Einfluss auf das individuelle Glück.
4. Kulturimpuls Bedingungsloses Grundeinkommen: Dieses Kapitel widmet sich dem Konzept des BGE, beleuchtet dessen konzeptionelle Grundlagen, historische Entwicklung und verschiedene Modelle in Deutschland. Es analysiert die öffentliche Wahrnehmung des BGE und diskutiert dessen kulturelle Bedeutung im Kontext der Wertschätzung von Arbeit sowie die Frage des "Rechts auf Faulheit". Die Entwicklung der Diskussion um das BGE und seine öffentliche Rezeption werden hier thematisiert.
5. Das bedingungslose Grundeinkommen als Schlüssel zum Glück?: In diesem Kapitel wird der potenzielle Einfluss eines BGE auf verschiedene Lebensbereiche wie Einkommen, Arbeit, Familienleben, Freizeitgestaltung und Gesundheit untersucht. Es werden sowohl positive Auswirkungen als auch potenzielle Grenzen und Herausforderungen der BGE-Einführung im Hinblick auf die Steigerung der Lebenszufriedenheit analysiert. Das Kapitel synthetisiert die Ergebnisse der vorherigen Kapitel und liefert eine umfassende Analyse der hypothetischen Auswirkungen des BGE auf das Glück.
Schlüsselwörter
Glück, Lebenszufriedenheit, Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), Sozialpolitik, Glücksforschung, Arbeit, Einkommen, Familie, Freizeit, Gesundheit, Autonomie, Freiheit, ökonomische Auswirkungen, soziale Gerechtigkeit, politische Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Der Einfluss eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die Lebenszufriedenheit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den potenziellen Einfluss eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf die Lebenszufriedenheit der deutschen Bevölkerung. Sie analysiert, inwieweit ein BGE durch mehr Freiheit und Autonomie zu einer Steigerung des subjektiven Glücks führen könnte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Glücksbegriff in Philosophie, Psychologie und Soziologie, das BGE als sozialpolitische Maßnahme, den Einfluss des BGE auf verschiedene Lebensbereiche (Einkommen, Arbeit, Familie, Freizeit, Gesundheit), Grenzen und Herausforderungen der BGE-Einführung und die hypothetischen Auswirkungen des BGE auf die Steigerung der Lebenszufriedenheit.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien der Glücksforschung, die den Glücksbegriff aus philosophischen, psychologischen und soziologischen Perspektiven beleuchten. Sie analysiert Einflussfaktoren auf das Glück, die Adaption an Lebensumstände, die Messbarkeit von Glück und das Konzept des "Flow".
Wie wird der Glücksbegriff in der Arbeit definiert?
Die Arbeit klärt die Mehrdeutigkeit des Begriffs "Glück" und grenzt den zufälligen Glückstreffer von dem holistischen Glücksverständnis ab, das im Fokus der Arbeit steht.
Welche Rolle spielt die Sozialpolitik in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Arbeit, Einkommen und Glück aus sozialpolitischer Sicht. Sie untersucht die Aufgaben der Sozialpolitik im Kontext der Glücksforschung und betrachtet das BGE als sozialpolitisches Instrument zur Glücksförderung.
Wie wird das bedingungslose Grundeinkommen in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit widmet sich dem Konzept des BGE, seinen konzeptionellen Grundlagen, seiner historischen Entwicklung und verschiedenen Modellen in Deutschland. Sie analysiert die öffentliche Wahrnehmung des BGE und diskutiert dessen kulturelle Bedeutung im Kontext der Wertschätzung von Arbeit und die Frage des "Rechts auf Faulheit".
Welche Lebensbereiche werden im Hinblick auf den Einfluss des BGE untersucht?
Die Arbeit untersucht den potenziellen Einfluss eines BGE auf Einkommen, Arbeit, Familienleben, Freizeitgestaltung und Gesundheit. Sowohl positive Auswirkungen als auch potenzielle Grenzen und Herausforderungen werden analysiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit synthetisiert die Ergebnisse der vorherigen Kapitel und liefert eine umfassende Analyse der hypothetischen Auswirkungen des BGE auf das Glück. Sie untersucht, welche Lebensbereiche von der Einführung eines BGE profitieren könnten und somit zu einer Steigerung der individuellen Lebenszufriedenheit beitragen könnten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Glück, Lebenszufriedenheit, Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), Sozialpolitik, Glücksforschung, Arbeit, Einkommen, Familie, Freizeit, Gesundheit, Autonomie, Freiheit, ökonomische Auswirkungen, soziale Gerechtigkeit, politische Maßnahmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in eine Einleitung, Kapitel zu Theorien der Glücksforschung, dem sozialpolitischen Glücksbegriff, dem BGE als Kulturimpuls, dem BGE als Schlüssel zum Glück, einem Fazit, einem Literaturverzeichnis und einem Abbildungsverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Franziska Block (Autor:in), 2017, Das Streben nach Glück in einer monetären Welt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504560