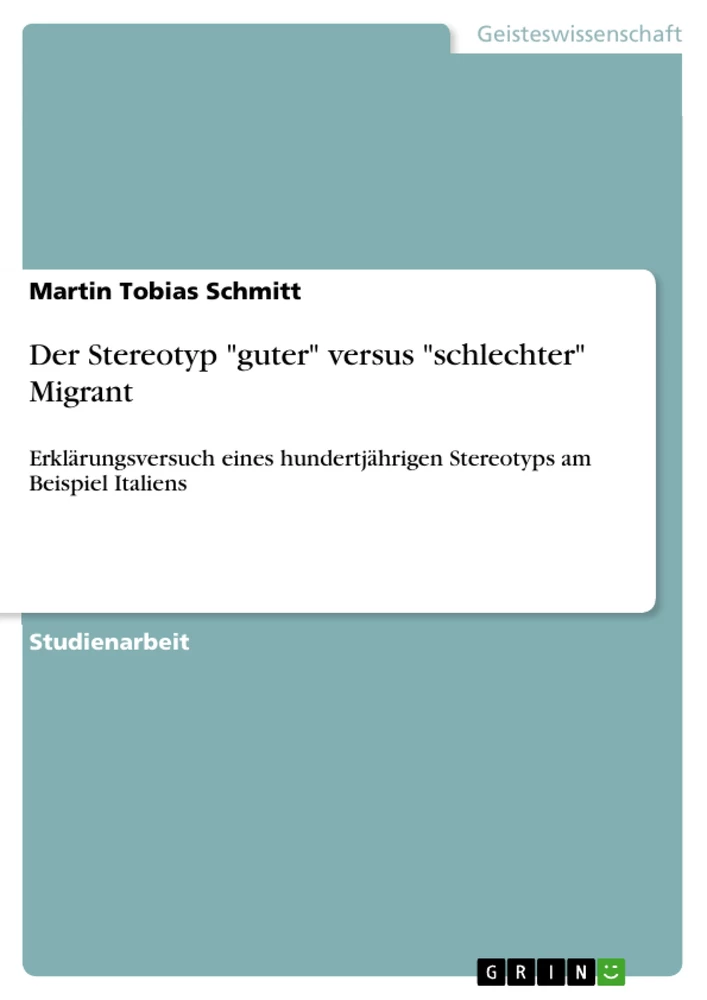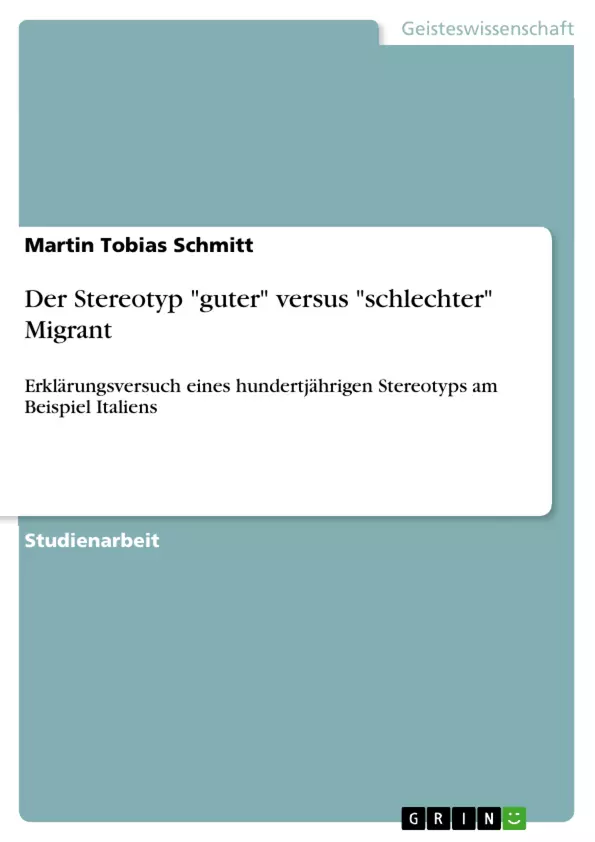Ziel dieser Arbeit ist es, sich an erwartete Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Migranten heranzutasten. Dabei soll ein Erklärungsversuch dafür unternommen werden, ob und warum bestimmte Erwartungshaltungen hinsichtlich der Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Migranten so langlebig zu sein scheinen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum im Kontext von Einwanderung und Migration von Migranten nach mehr als einhundert Jahren scheinbar immer noch ähnliche Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster erwartet werden.
Obrigkeitshörig und Unterordnung, Tüchtigkeit, Pflichtbewusstsein und Wehrlosigkeit wurden bereits um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhunderts von Migranten bei der Einreise in die USA gefordert und von den Einwanderungskommissaren überprüft. Doch auch mehr als einhundert Jahre später gilt in einigen Ländern der Welt für zahlreiche Migranten, dass sie hart arbeitend und pflichtbewusst erscheinen sollen, um als "gute Migranten" in den Grenzen des anderen Nationalstaates toleriert zu werden.
Ist diese Erwartungshaltung tatsächlich über Ländergrenzen und Zeiten hinweg so stabil geblieben? Und wenn ja, wie lässt sie sich erklären? Spielt ein europäischer beziehungsweise westlicher Überlegenheitsgedanke und Überlegenheitsanspruch eine Rolle?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Theorieteil
- 3.1 Erwartete Charakterzüge und Verhaltensweisen der „Anderen“ im kolonialen Diskurs
- 3.2 Erklärungsmuster für diese Erwartungshaltungen laut postkolonialer Theorie
- 3.3 Weitere Kernelemente der postkolonialen Theorie
- 4. Analyseteil
- 4.1 Erwartete Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen im italienischen Diskurs
- 4.2 Sonstige Übereinstimmung mit Kernelementen der postkolonialen Theorie
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die anhaltende Erwartung ähnlicher Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster bei Migrant_innen über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren. Der Fokus liegt auf den von Migrant_innen selbst gezeigten Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften, die im Kontext von Migrationsprozessen und Einwanderung erwartet werden. Die Arbeit nutzt postkoloniale Theorien, um diese anhaltenden Stereotypen zu erklären.
- Anhaltende Stereotypisierung von Migrant_innen
- Anwendung postkolonialer Theorien auf den europäischen Kontext
- Vergleichende Analyse des Migrationsdiskurses in den USA (um 1900) und Italien (heute)
- Der Einfluss von Machtstrukturen auf die Wahrnehmung von Migrant_innen
- Die Konstruktion von „guten“ und „schlechten“ Migrant_innen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der staatlichen Migrationskontrolle und -steuerung ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die anhaltenden Erwartungen an die Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Migrant_innen. Sie vergleicht historische Beispiele aus den USA des 19. Jahrhunderts mit der aktuellen Situation in Italien und legt den Fokus auf die Verhaltensweisen der Migrant_innen selbst als Untersuchungsgegenstand. Postkoloniale Studien werden als theoretischer Rahmen vorgeschlagen, um die anhaltende Stereotypisierung zu erklären.
2. Forschungsstand: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text enthält keine detaillierten Informationen zum Forschungsstand, sodass eine zusammenfassende Beschreibung hier nicht möglich ist. Eine vollständige Hausarbeit würde diesen Abschnitt ausführlich behandeln.)
3. Theorieteil: Dieser Abschnitt befasst sich mit den zentralen Elementen der postkolonialen Theorie und deren Anwendbarkeit auf die Forschungsfrage. Er untersucht, wie im kolonialen Diskurs bestimmte Charakterzüge und Verhaltensweisen von „Anderen“ erwartet und erklärt wurden. Die Analyse konzentriert sich auf die machtvollen Diskurse und Dynamiken, die aus der Kolonialzeit bis heute fortdauern und den Umgang des „Westens“ mit dem „Fremden“ prägen. Die Arbeit diskutiert die Eignung der postkolonialen Theorie zur Analyse des europäischen Migrationsdiskurses und beleuchtet die Konzeption von „Subalternität“ bei Spivak.
4. Analyseteil: Dieser Teil analysiert die in Italien beobachteten Erwartungen an das Verhalten von Migrant_innen und vergleicht diese mit den im kolonialen Diskurs beobachteten Mustern. Die Analyse basiert auf der Studie von Fabini (2017), die zeigt, wie die italienische Polizei das Migrationsrecht als Werkzeug gegen Prostitution und Kriminalität einsetzt. Der Abschnitt untersucht die Übereinstimmungen zwischen den Erwartungen an Migrant_innen in Italien heute und den Erwartungen an Einwanderer in den USA um 1900, die Anthes (1998) und Brandenburg (1904) beschreiben. Die Übereinstimmungen betonen das Fortbestehen von Stereotypen über die „gute“ und „schlechte“ Migrant_in über einen langen Zeitraum.
Schlüsselwörter
Migration, Postkoloniale Theorie, Stereotypen, Italien, USA, illegale Migration, „gute“ und „schlechte“ Migrant_innen, Identitätskonstruktion, Machtstrukturen, Kolonialer Diskurs, Subalternität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anhaltende Stereotypisierung von Migrant*innen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die anhaltende Erwartung ähnlicher Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster bei Migrant*innen über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren. Der Fokus liegt auf den von Migrant*innen selbst gezeigten Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften, die im Kontext von Migrationsprozessen und Einwanderung erwartet werden. Die Arbeit nutzt postkoloniale Theorien, um diese anhaltenden Stereotypen zu erklären.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse des Migrationsdiskurses in den USA (um 1900) und Italien (heute) und bezieht postkoloniale Theorien zur Erklärung der anhaltenden Stereotypisierung mit ein. Der Fokus liegt auf den Verhaltensweisen der Migrant*innen selbst.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die postkoloniale Theorie, um die anhaltenden Stereotypen über Migrant*innen zu erklären. Sie untersucht, wie im kolonialen Diskurs bestimmte Charakterzüge und Verhaltensweisen von „Anderen“ erwartet und erklärt wurden und wie diese Muster bis heute fortdauern. Die Konzeption von „Subalternität“ nach Spivak wird ebenfalls beleuchtet.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Erwartungen an das Verhalten von Migrant*innen in Italien und vergleicht diese mit den im kolonialen Diskurs beobachteten Mustern. Sie bezieht sich auf die Studie von Fabini (2017) über den Einsatz des Migrationsrechts durch die italienische Polizei gegen Prostitution und Kriminalität und vergleicht dies mit den Beschreibungen von Anthes (1998) und Brandenburg (1904) zu Einwanderern in den USA um 1900.
Welche Kernthemen werden behandelt?
Kernthemen sind die anhaltende Stereotypisierung von Migrant*innen, die Anwendung postkolonialer Theorien auf den europäischen Kontext, der Einfluss von Machtstrukturen auf die Wahrnehmung von Migrant*innen und die Konstruktion von „guten“ und „schlechten“ Migrant*innen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen Forschungsstand (der im vorliegenden Text jedoch nicht detailliert beschrieben wird), einen Theorieteil (mit Fokus auf postkoloniale Theorie), einen Analyseteil (Vergleich Italien/USA) und ein Fazit/Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Migration, Postkoloniale Theorie, Stereotypen, Italien, USA, illegale Migration, „gute“ und „schlechte“ Migrant*innen, Identitätskonstruktion, Machtstrukturen, Kolonialer Diskurs und Subalternität.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Warum bestehen anhaltende Erwartungen an die Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Migrant*innen über einen so langen Zeitraum hinweg?
Welche Quellen werden genannt?
Genannt werden unter anderem Fabini (2017), Anthes (1998) und Brandenburg (1904).
- Citar trabajo
- Martin Tobias Schmitt (Autor), 2019, Der Stereotyp "guter" versus "schlechter" Migrant, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504646