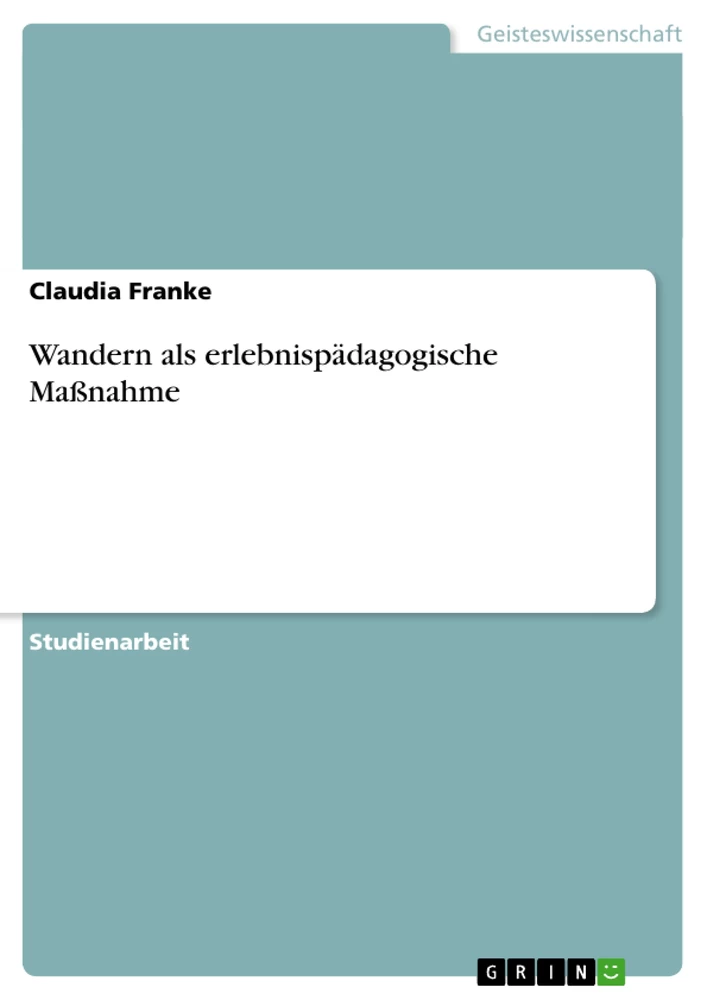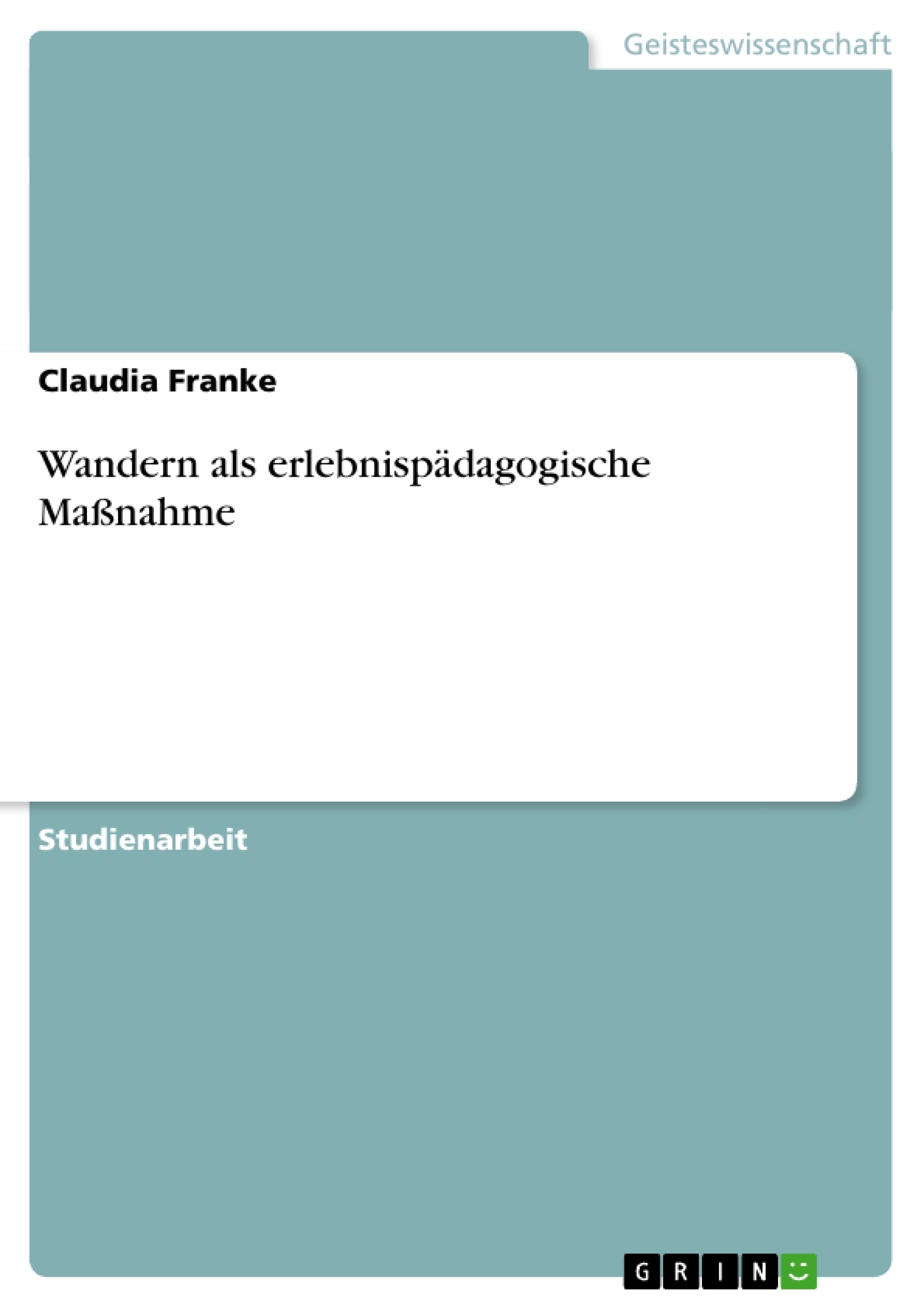Erlebnispädagogik: Erziehen durch außergewöhnliche Situationen. Was für eine Idee und was für Möglichkeiten verbergen sich wohl dahinter. Seit dem Seminar „Erlebnispädagogik“ habe ich einen ersten Eindruck gewonnen, wie wirkungsvoll und vielfältig diese handlungsorientierte Methode sein kann. Betrachtet man die Gesellschaft, in der wir gegenwärtig leben, muss man nach den Missständen nicht lange suchen. Spontaneität und Eigeninitiative nehmen immer mehr ab und „Individualismus“ wurde zum neuen Massenziel erklärt. Das Leben vieler Deutschen ist geprägt von Hektik, Selbstgefälligkeit und festgefahrenen Strukturen. Die Erlebnispädagogik bietet Elemente, die diesen gesellschaftlichen Mängeln entgegen wirken können. In nichtalltäglichen Situationen wird versucht, den Einzelnen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen zu stellen, um damit Erfahrungen zu ermöglichen, aus denen für den Alltag neue Einsichten, Einstellungen oder Verhaltenspotentiale erwachsen sollen.
Diese Form der Pädagogik hat gegenwärtig recht gute Chancen: In dem Maß, in dem Erlebnis– und Erfahrungsräume für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene eingeengt werden oder völlig verschwinden, und in dem eigenes unmittelbares Erleben aus unserer Zeit und Lebenswelt verdrängt wird, in diesem Maße scheint der Bedarf am Erlebnis zu wachsen. Leider zählen Hilfsbereitschaft, Neugierde, Hingabe, Zusammenarbeit etc. nicht mehr zur ‚Grundausstattung’ jedes Individuums und sind längst nicht mehr selbstverständlich. Die Erlebnispädagogik bietet Elemente, wo beispielsweise durch Projekte oder Expeditionen ein Zugang zu solchen Kompetenzen vermittelt werden soll. Deshalb scheint es auch nicht verwunderlich, dass Erlebnispädagogik reformpädagogischer Tradition heute vorwiegend an den Rändern unserer Gesellschaft zu finden ist. Dort, wo bereits die Einstiege in ein Erleben erschwert wurden und Lebensprozesse tatsächliche Gratwanderungen sind. Wodurch aber sollte man ‚Erleben können’ und Lebensgestaltung besser lernen und entwickeln können als eben durch vitales, aktives, unmittelbares Erleben? Im folgenden habe ich mich mit dem Wandern als einer erlebnispädagogischen Maßnahme in diesem Sinne speziell auseinandergesetzt. Nachdem ich einen groben Überblick über Wirkungsmodelle und verschiedenen Aktivitäten der Erlebnispädagogik gebe, stelle ich das Wandern bzw. Pilgern vor und schildere diese Maßnahme mit persönlichen Erfahrungen am Beispiel des spanischen Jacobsweges.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ERLEBNISPÄDAGOGIK
- KURT HAHN
- VERSCHIEDENE WIRKUNGSMODELLE DER ERLEBNISPÄDAGOGIK
- EINE AUSWAHL VON ERLEBNISPÄDAGOGISCHEN AKTIVITÄTEN
- ,,AUF DEM WEG“………………
- NOTWENDIGKEIT DES WANDERNS FÜR JUGENDLICHE
- DER JAKOBSWEG..
- PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN
- TRANSFERPROBLEMATIK
- SCHLUSSWORT..........\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Erlebnispädagogik und untersucht das Wandern als erlebnispädagogische Maßnahme. Die Arbeit beleuchtet die Ursprünge der Erlebnispädagogik und verschiedene Wirkungsmodelle, um anschließend das Wandern als eine konkrete Aktivität im Kontext der Erlebnispädagogik zu betrachten.
- Die Bedeutung von Kurt Hahn als Vater der Erlebnispädagogik
- Die verschiedenen Wirkungsmodelle der Erlebnispädagogik, wie das „The mountain speaks for themselves" Modell und das „Outward Bound“ Modell
- Die Rolle des Wanderns als erlebnispädagogische Maßnahme
- Der Jakobsweg als Beispiel für ein erlebnispädagogisches Projekt
- Die Transferproblematik und die Übertragbarkeit von erlebnispädagogischen Erfahrungen in den Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Erlebnispädagogik in der heutigen Gesellschaft dar und führt in das Thema des Wanderns als erlebnispädagogische Maßnahme ein. Kapitel 2 beleuchtet die Ursprünge der Erlebnispädagogik und stellt die Person Kurt Hahn sowie verschiedene Wirkungsmodelle vor. Kapitel 3 fokussiert sich auf das Wandern als erlebnispädagogische Maßnahme, wobei insbesondere der Jakobsweg als Beispiel für ein erlebnispädagogisches Projekt behandelt wird. Das Kapitel beleuchtet auch die Notwendigkeit des Wanderns für Jugendliche und schildert praktische Erfahrungen. Kapitel 4 befasst sich mit der Transferproblematik und der Übertragbarkeit von erlebnispädagogischen Erfahrungen in den Alltag. Das Schlusswort fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, Kurt Hahn, Wirkungsmodelle, Wandern, Jakobsweg, Transferproblematik, Erfahrung, Abenteuer, Natur, Gemeinschaft, Selbstfindung.
- Arbeit zitieren
- Claudia Franke (Autor:in), 2003, Wandern als erlebnispädagogische Maßnahme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50465