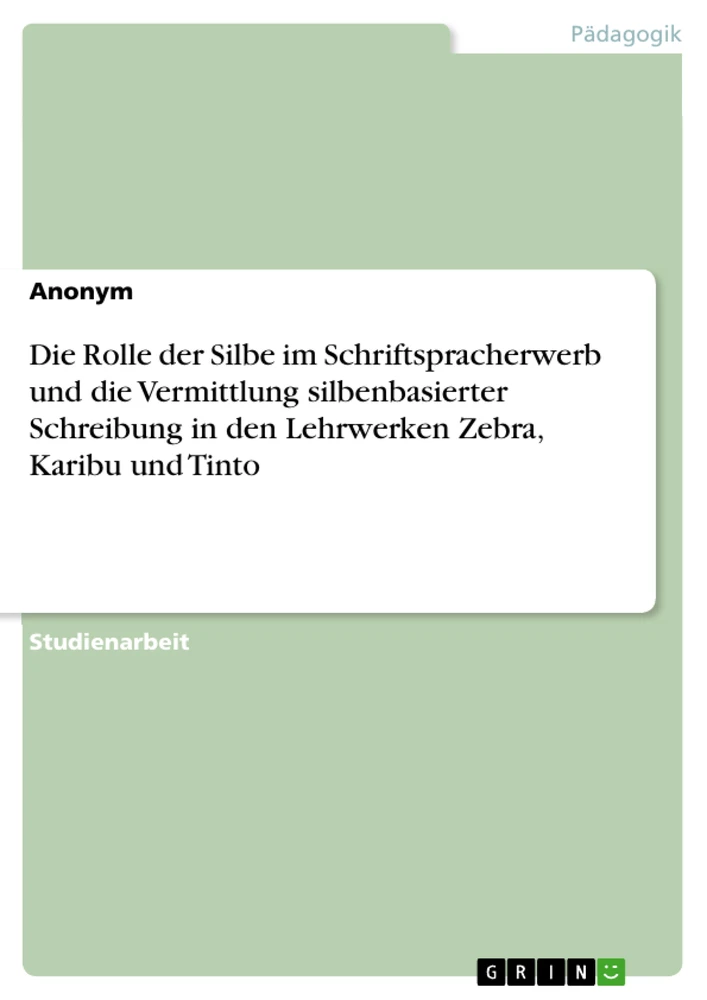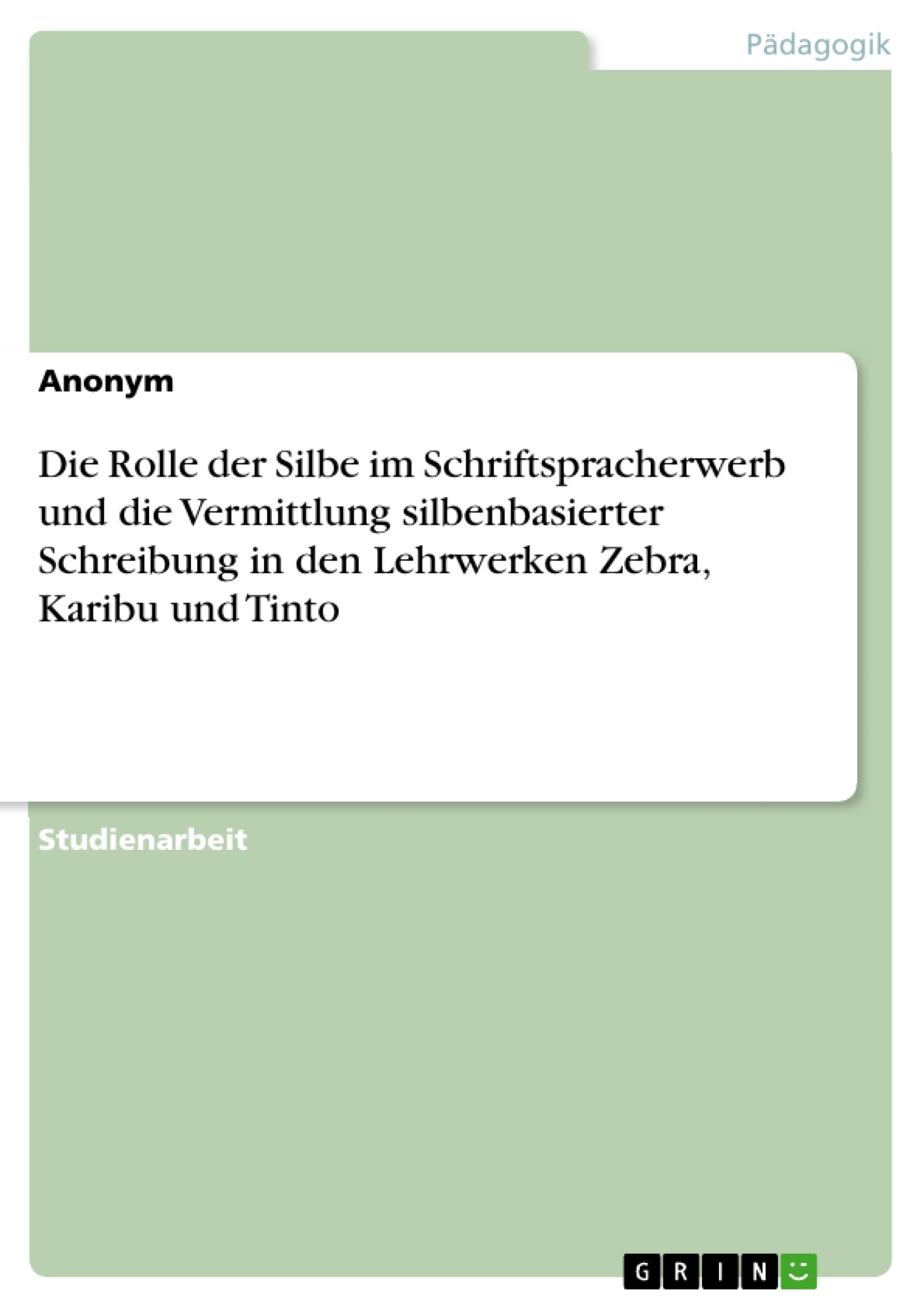Obwohl die metasprachlichen Fähigkeiten von Vorschulkindern stark von vorschulischen Erfahrungen abhängen, ist davon auszugehen, dass sie zumindest schon eine diffuse Vorstellung von Sprachlauten haben. Dies zeigt sich beispielsweise in Singspielen, wie "Drei Chinesen mit dem Kontrabass". Auffallend an derartigen Sprachspielen ist vor allem ihre Silbenbasiertheit. So werden im hier angeführten Beispiel Silbenkerne ausgetauscht, wobei zu beobachten ist, dass sie dafür eher die Vokale aus der betonten, statt aus der unbetonten Silbe wählen.
Doch auch in anderen Klatsch- und Singspielen zeigt sich die Fähigkeit von Vorschülern und Vorschülerinnen "silbische und prosodische (die Wortbedeutung betreffende) Strukturen zu analysieren". Eine solche Fähigkeit zur sprachlichen Reflexion nennt sich "phonologische Bewusstheit". Sie gilt als die "wichtigste Voraussetzung für den erfolgreichen Einstieg ins Lesen und Schreiben". Gemeint ist damit "die Fähigkeit, ein lautliches Wort mit seiner Silben- und Betonungsstruktur in untergeordnete Einheiten […] zu gliedern".
Diese Fähigkeit zur Sprachwahrnehmung kann in der Schule genutzt werden, um über wahrgenommene Lauteigenschaften ins Gespräch zu kommen. Stattdessen zeigt sich in den Fibellehrgängen oft, dass ihnen diese eher abgewöhnt wird. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel zu analysieren, wie die silbenbasierte Schreibung in den Lehrwerken Zebra, Karibu und Tinto vermittelt wird und auf Grundlage des theoretischen Wissens über die besondere Rolle der Silbe im Schriftspracherwerb, zu prüfen, ob die Vermittlung sinnvoll gestaltet ist oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Rolle der Silbe im Schriftspracherwerb
- 3. Bezug zum Kernlehrplan in NRW
- 4. Analyse der Lehrwerke
- 4.1 Kriterien zur Analyse der Lehrwerke
- 4.2 Zebra
- 4.3 Karibu
- 4.4 Tinto
- 5. Eignung der Lehrwerke für die Vermittlung silbenbasierter Schreibung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Vermittlung silbenbasierter Schreibung in den Lehrwerken Zebra, Karibu und Tinto. Sie befasst sich mit der Rolle der Silbe im Schriftspracherwerb und untersucht, ob die Vermittlung der silbenbasierten Schreibung in den Lehrwerken sinnvoll gestaltet ist. Dazu wird die silbenanalytische Methode nach Röber und ihre Erweiterung durch Bredel als geeignete Methode zur Vermittlung vorgestellt.
- Die Rolle der Silbe im Schriftspracherwerb
- Silbenanalytische Methode nach Röber und ihre Erweiterung
- Analyse der Lehrwerke Zebra, Karibu und Tinto
- Eignung der Lehrwerke für die Vermittlung silbenbasierter Schreibung
- Bezug zum Kernlehrplan in NRW
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Schriftspracherwerbs und die Bedeutung phonologischer Bewusstheit vor. Sie führt die Lehrwerke Zebra, Karibu und Tinto ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Rolle der Silbe im Schriftspracherwerb, erklärt die silbenanalytische Methode nach Röber und geht auf hilfreiche und weniger hilfreiche Methoden zur Vermittlung silbenbasierter Schreibung ein. Kapitel 3 stellt den Bezug zum Kernlehrplan NRW her und definiert Kriterien zur Analyse der Vermittlung silbenbasierter Schreibung in Lehrwerken. Kapitel 4 untersucht die Lehrwerke Zebra, Karibu und Tinto anhand der Kriterien und analysiert Lehrhandreichungen und Aufgabenbeispiele.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Silben, silbenbasierte Schreibung, phonologische Bewusstheit, Lehrwerke, Zebra, Karibu, Tinto, Analyse, Vermittlung, Kernlehrplan NRW, silbenanalytische Methode, Röber, Bredel.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Rolle der Silbe im Schriftspracherwerb und die Vermittlung silbenbasierter Schreibung in den Lehrwerken Zebra, Karibu und Tinto, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505333