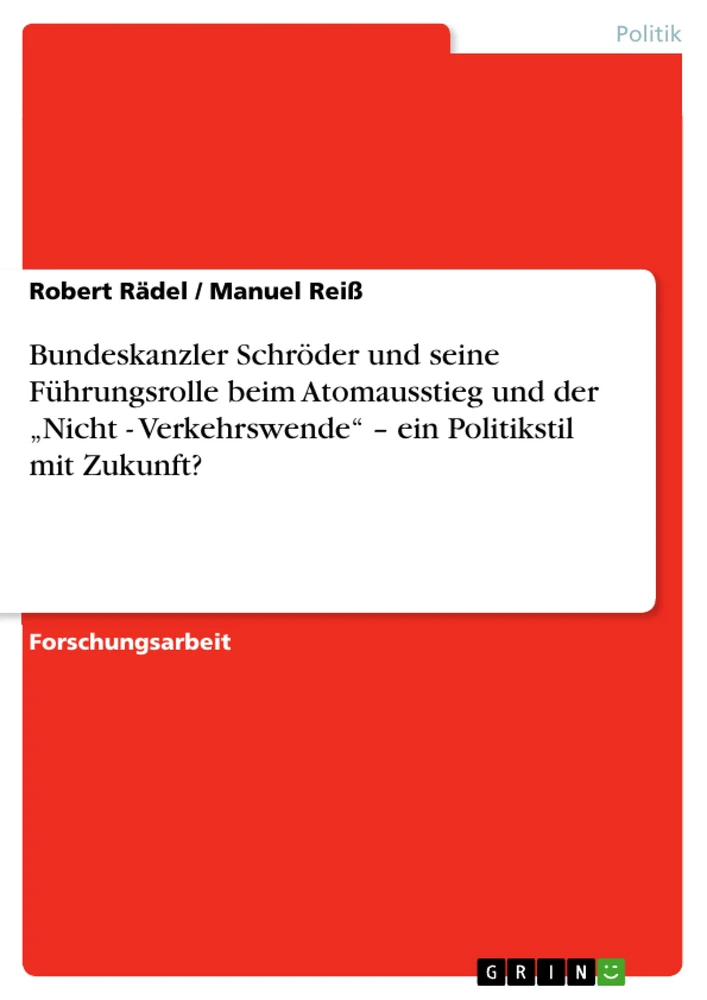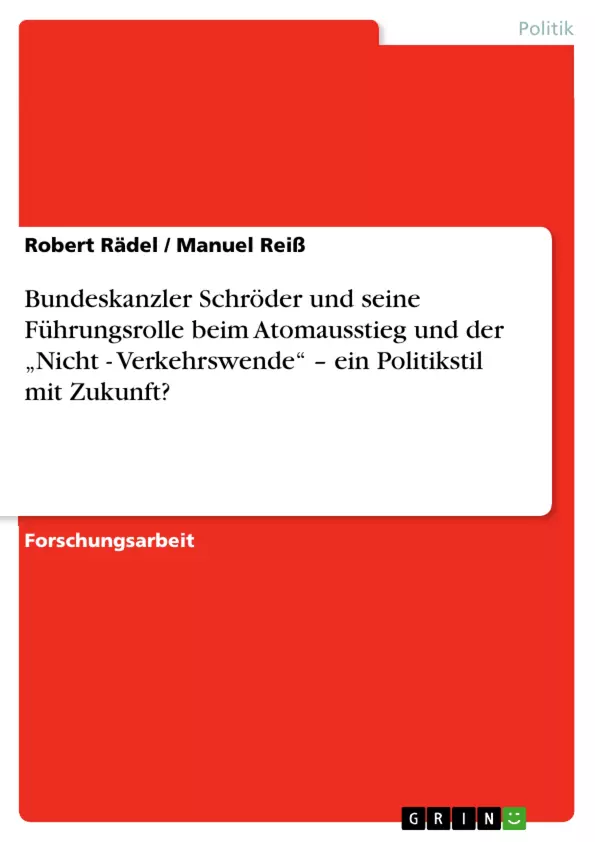Gerhard Schröder gilt als moderater Sozialdemokrat mit Affinität zur Wirtschaft, der (umweltpolitische) Utopien immer den gesellschaftspolitischen Realitäten unterordnet, den Konsens mit allen Akteuren sucht und es versteht, die Medien im Sinne seiner kurzfristigen Politik für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Inwieweit konnte er seinen Politikstil in den Policyprozessen und seine Grundauffassungen im Policyoutput der Themenfelder Atomausstieg und Verkehrspolitik durchsetzen? Wie hat das Interaktionsverhältnis zwischen Gerhard Schröder und anderen – regierungsrelevanten - Akteuren seine Handlungsspielräume verändert? Inwieweit war der Kanzler an der Herstellung der Ergebnisse in Atom- und Verkehrspolitik involvierend, moderierend und gar steuernd beteiligt; welchen Anteil hatte er am Gelingen oder Nicht-Gelingen? Medienorientierung, Personalisierung, Demoskopieausrichtung, Entparlamentarisierung (in diesem Fall durch Konsensrunden) sind Entwicklungen der letzten Jahre, alle gleichzeitig auch gebündelt in einer Person: Gerhard Schröder ist damit ein ideales Anschauungsobjekt zur Überprüfung.
An der Schnittstelle von Politikfeld- und Regierungsstilanalyse ist es spannend zu erfahren, wie sich der „Genosse der Bosse“ und „Autokanzler“ in den Atomausstiegsverhandlungen bzw. in den Auseinandersetzungen mit dem kleinen Koalitionspartner um eine Verkehrswende die umwelt- und wirtschaftspolitischen Zielkonflikte verhielt und seine Interessen verfolgte.
Gerhard Schröder hat sich als ein Regierungschef erwiesen , der es dank seines Politikstils schaffte, in beiden untersuchten Politikfeldern Ergebnisse zu erreichen, die inhaltlich seinem Willen entsprachen und sich machtpolitisch für ihn ausgezahlt haben. Schröders Stilmix aus Medienorientierung, Konsensrunden und Machtworten hat in beiden Fällen für ein für ihn positives Ergebnis gesorgt, weil er flexible und pragmatische Führungsinstrumente zulässt, die im hochkomplexen politischen System Deutschlands notwendig sind, um für umstrittene Probleme Lösungen zu finden. Neben persönlicher Entschlossenheit und Souveränität verleihendem Vorwissen ist es für einen Regierungschef wichtig, sich auf den Rückhalt verschiedener Akteure zu stützen. Ohne Atomausstieg wäre Schröders Koalition schon früh zerbrochen, und ohne Segen des ADAC und der Autoindustrie wäre er nicht wieder gewählt worden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Grundlagen: Gerhard Schröder und das rot-grüne Projekt
- I. Annäherung an Gerhard Schröder
- 1.) Gradlinigkeit und Machtinstinkt – eine politische Karriere
- 2.) Der Politikstil Gerhard Schröders
- a. Kanzlerprinzip und Chefsachen-Mythos
- b. Der Medienkanzler
- c. Bilanz
- 3.) Energiepolitik in den Augen von Gerhard Schröder: ein notwendiges Übel?
- a. Atomausstieg als Aufsteigerthema
- b. Atomausstieg aus der Sicht eines Ministerpräsidenten
- c. Atomausstieg und Gerhard Schröder: Auf dem Weg zum „Konsenskanzler“
- 4.) Der „Autokanzler“
- II. Die umweltpolitischen Rahmenbedingungen des rot-grünen Projekts
- 1.) Ein neuer Aufbruch?
- 2.) Das grüne Programm
- 3.) Das sozialdemokratische Programm
- 4.) Wahlergebnis und Koalitionsverhandlungen
- 5.) Das rot-grüne Kabinett
- I. Annäherung an Gerhard Schröder
- C. Der Energiekonsens
- I. Der Weg zum Energiekonsens unter Bundeskanzler Gerhard Schröder
- II. Entscheidende Einflussfaktoren, fehlende Veto-Spieler?
- 1.) Die SPD
- 2.) Zwei Minister, zwei Meinungen
- a. Müller der loyale Vermittler
- b. Trittin der illoyale Querdenker
- 3.) Die Grünen
- 4.) Energieunternehmen
- III. Die Rolle des Kanzlers - Weg und Ziel als Beispiele für Schröders Führungsstil
- IV. Bilanz
- D. Alles beim Alten. Rot-grüne Verkehrspolitik unter Autokanzler Schröder
- I. Die verkehrspolitischen Herausforderungen von Rot-Grün
- II. Verkehrspolitische Entscheidungen der ersten rot-grünen Regierung
- III. Entscheidende Akteure und Einflussfaktoren
- 1.) Drei Verkehrsminister, keine Verkehrswende
- 2.) Ein schwacher Umwelt-, sparsamer Finanz- und industrienaher Wirtschaftsminister
- 3.) Betonierte Sozis und ohnmächtige Grüne
- 4.) Mächtige Autofahrer, heimliche Verkehrsminister und ungehörte Umweltschützer
- IV. Die Rolle des Kanzlers
- V. Bilanz
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Politikstil von Bundeskanzler Gerhard Schröder anhand des Atomausstiegs und der Verkehrspolitik während der 14. Wahlperiode. Ziel ist es, die Durchsetzungsstärke Schröders und den Einfluss des Interaktionsverhältnisses mit anderen Akteuren auf seine Handlungsspielräume zu analysieren. Die Vergleichbarkeit beider Politikfelder hinsichtlich institutioneller Besetzung und Akteursfelds ermöglicht eine fundierte Analyse.
- Analyse des Politikstils von Gerhard Schröder
- Bewertung der Durchsetzungsstärke Schröders im Atomausstieg
- Untersuchung des Scheiterns der Verkehrswende unter Schröder
- Einfluss der Interaktion mit anderen Akteuren auf Schröders Handlungsspielraum
- Relevanz von Medienorientierung, Personalisierung und Konsensfindung für den Regierungsstil
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Gerhard Schröders Politikstil auf den Atomausstieg und die Verkehrspolitik in der 14. Wahlperiode. Sie begründet die Wahl dieser Themenfelder durch ihre Vergleichbarkeit und die Kontroversen zwischen Wirtschafts- und Umweltinteressen. Die Arbeit untersucht, inwieweit Schröders Politikstil – geprägt von Medienorientierung und Konsensfindung – seine Handlungsspielräume beeinflusste und zum Erfolg oder Misserfolg in diesen Politikfeldern beitrug. Die Aktualität des Themas liegt in der Relevanz von Schröders Regierungsstil für aktuelle politische Entwicklungen.
B. Grundlagen: Gerhard Schröder und das rot-grüne Projekt: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Gerhard Schröders politische Karriere, seinen Politikstil (einschließlich seiner Medienpräsenz und seines Umgangs mit dem Kanzlerprinzip) und seine Sicht auf die Energiepolitik, insbesondere den Atomausstieg. Es analysiert die umweltpolitischen Rahmenbedingungen des rot-grünen Projekts, inklusive der Programme von SPD und Grünen, Wahlergebnissen und Koalitionsverhandlungen. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse von Schröders Handeln im Kontext der rot-grünen Koalition und seiner spezifischen politischen Herangehensweise.
C. Der Energiekonsens: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Prozess der Atomausstiegsentscheidung unter Schröder. Es untersucht die Rolle verschiedener Akteure wie der SPD, der Grünen und der Energieunternehmen sowie die Bedeutung von Personen wie Joschka Fischer und Jürgen Trittin. Der Fokus liegt auf Schröders Führungsstil und seinem Beitrag zum Erreichen eines Kompromisses im Bereich der Energiepolitik. Es wird detailliert analysiert, wie er Konflikte zwischen verschiedenen Interessengruppen managte und wie seine Vorgehensweise zum letztendlichen Ergebnis des Atomausstiegs beitrug.
D. Alles beim Alten. Rot-grüne Verkehrspolitik unter Autokanzler Schröder: Dieses Kapitel analysiert die verkehrspolitischen Herausforderungen und Entscheidungen der ersten rot-grünen Regierung. Es untersucht die Rolle der beteiligten Akteure, darunter die Verkehrsminister und die Interessenvertretungen der Automobilindustrie und des Umweltschutzes. Das Kapitel beleuchtet, warum trotz der grünen Beteiligung in der Koalition keine substantielle Verkehrswende stattfand und wie Schröders Politikstil diesen Verlauf beeinflusste. Es wird eingehend darauf eingegangen, wie unterschiedliche Interessen und die Machtverhältnisse zwischen den Akteuren die verkehrspolitische Entwicklung prägten.
Schlüsselwörter
Gerhard Schröder, Politikstil, Atomausstieg, Verkehrswende, Rot-Grün, Koalitionspolitik, Energiepolitik, Umweltpolitik, Medienwirkung, Konsensfindung, Akteurskonstellation, Policyprozess, Policyoutput.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Politikstils von Gerhard Schröder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Politikstil von Bundeskanzler Gerhard Schröder anhand des Atomausstiegs und der Verkehrspolitik während seiner ersten Amtszeit (14. Wahlperiode). Der Fokus liegt auf der Untersuchung seiner Durchsetzungsstärke und des Einflusses der Interaktion mit anderen Akteuren auf seine Handlungsspielräume in diesen beiden Politikfeldern.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht Schröders Politikstil, seine Durchsetzungsfähigkeit beim Atomausstieg, das Scheitern der Verkehrswende unter seiner Kanzlerschaft, den Einfluss der Interaktion mit anderen Akteuren auf sein Handeln, sowie die Relevanz von Medienorientierung, Personalisierung und Konsensfindung für seinen Regierungsstil. Es werden sowohl der Energiekonsens als auch die verkehrspolitischen Entscheidungen der rot-grünen Regierung detailliert analysiert.
Welche Akteure werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse berücksichtigt eine Vielzahl von Akteuren, darunter die SPD, die Grünen, Energieunternehmen, verschiedene Minister (z.B. Joschka Fischer, Jürgen Trittin), die Automobilindustrie und Umweltschutzorganisationen. Es wird untersucht, wie die Interaktion und die Machtverhältnisse zwischen diesen Akteuren die Entscheidungen in der Energie- und Verkehrspolitik beeinflussten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen (Schröder und das rot-grüne Projekt), Der Energiekonsens (Atomausstieg), Rot-grüne Verkehrspolitik (oder das Scheitern der Verkehrswende), und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas und analysiert die Rolle Schröders und anderer Akteure.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse des Atomausstiegs und der Verkehrspolitik, um den Politikstil Schröders und seine Handlungsspielräume zu untersuchen. Es wird die Interaktion zwischen verschiedenen Akteuren analysiert, um die Einflussfaktoren auf die politischen Entscheidungen zu verstehen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Schröders Politikstil, geprägt von Medienorientierung und Konsensfindung, seine Handlungsspielräume beeinflusste und zum Erfolg oder Misserfolg im Atomausstieg und der Verkehrspolitik beitrug. Die Ergebnisse werden im Fazit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Gerhard Schröder, Politikstil, Atomausstieg, Verkehrswende, Rot-Grün, Koalitionspolitik, Energiepolitik, Umweltpolitik, Medienwirkung, Konsensfindung, Akteurskonstellation, Policyprozess, Policyoutput.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit dem Politikstil von Gerhard Schröder, der deutschen Energie- und Verkehrspolitik sowie der Funktionsweise von Koalitionsregierungen auseinandersetzen möchten.
- Arbeit zitieren
- Robert Rädel (Autor:in), Manuel Reiß (Autor:in), 2005, Bundeskanzler Schröder und seine Führungsrolle beim Atomausstieg und der „Nicht - Verkehrswende“ – ein Politikstil mit Zukunft?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50541